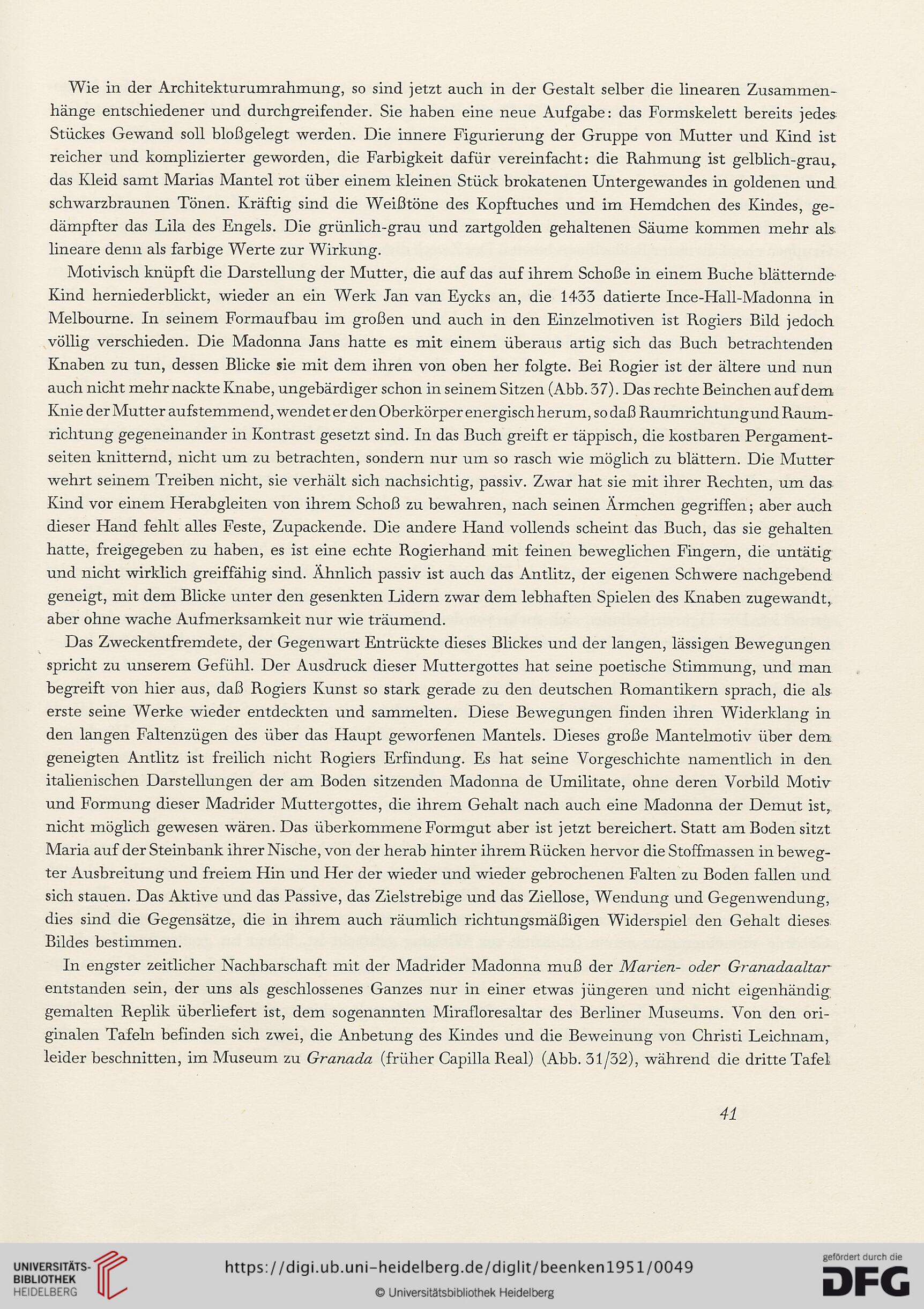Wie in der Architekturumrahmung, so sind jetzt auch in der Gestalt selber die linearen Zusammen-
hänge entschiedener und durchgreifender. Sie haben eine neue Aufgabe: das Formskelett bereits jedes
Stückes Gewand soll bloßgelegt werden. Die innere Figurierung der Gruppe von Mutter und Kind ist
reicher und komplizierter geworden, die Farbigkeit dafür vereinfacht: die Rahmung ist gelblich-grau,
das Kleid samt Marias Mantel rot über einem kleinen Stück brokatenen Untergewandes in goldenen und
schwarzbraunen Tönen. Kräftig sind die Weißtöne des Kopftuches und im Hemdchen des Kindes, ge-
dämpfter das Lila des Engels. Die grünlich-grau und zartgolden gehaltenen Säume kommen mehr als
lineare denn als farbige Werte zur Wirkung.
Motivisch knüpft die Darstellung der Mutter, die auf das auf ihrem Schoße in einem Buche blätternde
Kind herniederblickt, wieder an ein Werk Jan van Eycks an, die 1433 datierte Ince-Hall-Madonna in
Melbourne. In seinem Formaufbau im großen und auch in den Einzelmotiven ist Rogiers Bild jedoch
völlig verschieden. Die Madonna Jans hatte es mit einem überaus artig sich das Buch betrachtenden
Knaben zu tun, dessen Blicke sie mit dem ihren von oben her folgte. Bei Rogier ist der ältere und nun
auch nicht mehr nackte Knabe, ungebärdiger schon in seinem Sitzen (Abb. 37). Das rechte Beinchen auf dem
Knie der Mutter aufstemmend, wendet er den Oberkörper energisch herum, so daß Raumrichtungund Raum-
richtung gegeneinander in Kontrast gesetzt sind. In das Buch greift er täppisch, die kostbaren Pergament-
seiten knitternd, nicht um zu betrachten, sondern nur um so rasch wie möglich zu blättern. Die Mutter
wehrt seinem Treiben nicht, sie verhält sich nachsichtig, passiv. Zwar hat sie mit ihrer Rechten, um das
Kind vor einem Herabgleiten von ihrem Schoß zu bewahren, nach seinen Ärmchen gegriffen; aber auch
dieser Hand fehlt alles Feste, Zupackende. Die andere Hand vollends scheint das Buch, das sie gehalten
hatte, freigegeben zu haben, es ist eine echte Rogierhand mit feinen beweglichen Fingern, die untätig
und nicht wirklich greiffähig sind. Ähnlich passiv ist auch das Antlitz, der eigenen Schwere nachgebend
geneigt, mit dem Blicke unter den gesenkten Lidern zwar dem lebhaften Spielen des Knaben zugewandt,
aber ohne wache Aufmerksamkeit nur wie träumend.
Das Zweckentfremdete, der Gegenwart Entrückte dieses Blickes und der langen, lässigen Bewegungen
spricht zu unserem Gefühl. Der Ausdruck dieser Muttergottes hat seine poetische Stimmung, und man
begreift von hier aus, daß Rogiers Kunst so stark gerade zu den deutschen Romantikern sprach, die als
erste seine Werke wieder entdeckten und sammelten. Diese Bewegungen finden ihren Widerklang in
den langen Faltenzügen des über das Haupt geworfenen Mantels. Dieses große Mantelmotiv über dem
geneigten Antlitz ist freilich nicht Rogiers Erfindung. Es hat seine Vorgeschichte namentlich in den
italienischen Darstellungen der am Boden sitzenden Madonna de Umilitate, ohne deren Vorbild Motiv
und Formung dieser Madrider Muttergottes, die ihrem Gehalt nach auch eine Madonna der Demut ist,
nicht möglich gewesen wären. Das überkommene Formgut aber ist jetzt bereichert. Statt am Boden sitzt
Maria auf der Steinbank ihrer Nische, von der herab hinter ihrem Rücken hervor die Stoffmassen in beweg-
ter Ausbreitung und freiem Hin und Her der wieder und wieder gebrochenen Falten zu Boden fallen und
sich stauen. Das Aktive und das Passive, das Zielstrebige und das Ziellose, Wendung und Gegenwendung,
dies sind die Gegensätze, die in ihrem auch räumlich richtungsmäßigen Widerspiel den Gehalt dieses
Bildes bestimmen.
In engster zeitlicher Nachbarschaft mit der Madrider Madonna muß der Marien- oder Granadaaltar
entstanden sein, der uns als geschlossenes Ganzes nur in einer etwas jüngeren und nicht eigenhändig
gemalten Replik überliefert ist, dem sogenannten Mirafloresaltar des Berliner Museums. Von den ori-
ginalen Tafeln befinden sich zwei, die Anbetung des Kindes und die Beweinung von Christi Leichnam,
leider beschnitten, im Museum zu Granada (früher Capilla Real) (Abb. 31/32), während die dritte Tafel
41
hänge entschiedener und durchgreifender. Sie haben eine neue Aufgabe: das Formskelett bereits jedes
Stückes Gewand soll bloßgelegt werden. Die innere Figurierung der Gruppe von Mutter und Kind ist
reicher und komplizierter geworden, die Farbigkeit dafür vereinfacht: die Rahmung ist gelblich-grau,
das Kleid samt Marias Mantel rot über einem kleinen Stück brokatenen Untergewandes in goldenen und
schwarzbraunen Tönen. Kräftig sind die Weißtöne des Kopftuches und im Hemdchen des Kindes, ge-
dämpfter das Lila des Engels. Die grünlich-grau und zartgolden gehaltenen Säume kommen mehr als
lineare denn als farbige Werte zur Wirkung.
Motivisch knüpft die Darstellung der Mutter, die auf das auf ihrem Schoße in einem Buche blätternde
Kind herniederblickt, wieder an ein Werk Jan van Eycks an, die 1433 datierte Ince-Hall-Madonna in
Melbourne. In seinem Formaufbau im großen und auch in den Einzelmotiven ist Rogiers Bild jedoch
völlig verschieden. Die Madonna Jans hatte es mit einem überaus artig sich das Buch betrachtenden
Knaben zu tun, dessen Blicke sie mit dem ihren von oben her folgte. Bei Rogier ist der ältere und nun
auch nicht mehr nackte Knabe, ungebärdiger schon in seinem Sitzen (Abb. 37). Das rechte Beinchen auf dem
Knie der Mutter aufstemmend, wendet er den Oberkörper energisch herum, so daß Raumrichtungund Raum-
richtung gegeneinander in Kontrast gesetzt sind. In das Buch greift er täppisch, die kostbaren Pergament-
seiten knitternd, nicht um zu betrachten, sondern nur um so rasch wie möglich zu blättern. Die Mutter
wehrt seinem Treiben nicht, sie verhält sich nachsichtig, passiv. Zwar hat sie mit ihrer Rechten, um das
Kind vor einem Herabgleiten von ihrem Schoß zu bewahren, nach seinen Ärmchen gegriffen; aber auch
dieser Hand fehlt alles Feste, Zupackende. Die andere Hand vollends scheint das Buch, das sie gehalten
hatte, freigegeben zu haben, es ist eine echte Rogierhand mit feinen beweglichen Fingern, die untätig
und nicht wirklich greiffähig sind. Ähnlich passiv ist auch das Antlitz, der eigenen Schwere nachgebend
geneigt, mit dem Blicke unter den gesenkten Lidern zwar dem lebhaften Spielen des Knaben zugewandt,
aber ohne wache Aufmerksamkeit nur wie träumend.
Das Zweckentfremdete, der Gegenwart Entrückte dieses Blickes und der langen, lässigen Bewegungen
spricht zu unserem Gefühl. Der Ausdruck dieser Muttergottes hat seine poetische Stimmung, und man
begreift von hier aus, daß Rogiers Kunst so stark gerade zu den deutschen Romantikern sprach, die als
erste seine Werke wieder entdeckten und sammelten. Diese Bewegungen finden ihren Widerklang in
den langen Faltenzügen des über das Haupt geworfenen Mantels. Dieses große Mantelmotiv über dem
geneigten Antlitz ist freilich nicht Rogiers Erfindung. Es hat seine Vorgeschichte namentlich in den
italienischen Darstellungen der am Boden sitzenden Madonna de Umilitate, ohne deren Vorbild Motiv
und Formung dieser Madrider Muttergottes, die ihrem Gehalt nach auch eine Madonna der Demut ist,
nicht möglich gewesen wären. Das überkommene Formgut aber ist jetzt bereichert. Statt am Boden sitzt
Maria auf der Steinbank ihrer Nische, von der herab hinter ihrem Rücken hervor die Stoffmassen in beweg-
ter Ausbreitung und freiem Hin und Her der wieder und wieder gebrochenen Falten zu Boden fallen und
sich stauen. Das Aktive und das Passive, das Zielstrebige und das Ziellose, Wendung und Gegenwendung,
dies sind die Gegensätze, die in ihrem auch räumlich richtungsmäßigen Widerspiel den Gehalt dieses
Bildes bestimmen.
In engster zeitlicher Nachbarschaft mit der Madrider Madonna muß der Marien- oder Granadaaltar
entstanden sein, der uns als geschlossenes Ganzes nur in einer etwas jüngeren und nicht eigenhändig
gemalten Replik überliefert ist, dem sogenannten Mirafloresaltar des Berliner Museums. Von den ori-
ginalen Tafeln befinden sich zwei, die Anbetung des Kindes und die Beweinung von Christi Leichnam,
leider beschnitten, im Museum zu Granada (früher Capilla Real) (Abb. 31/32), während die dritte Tafel
41