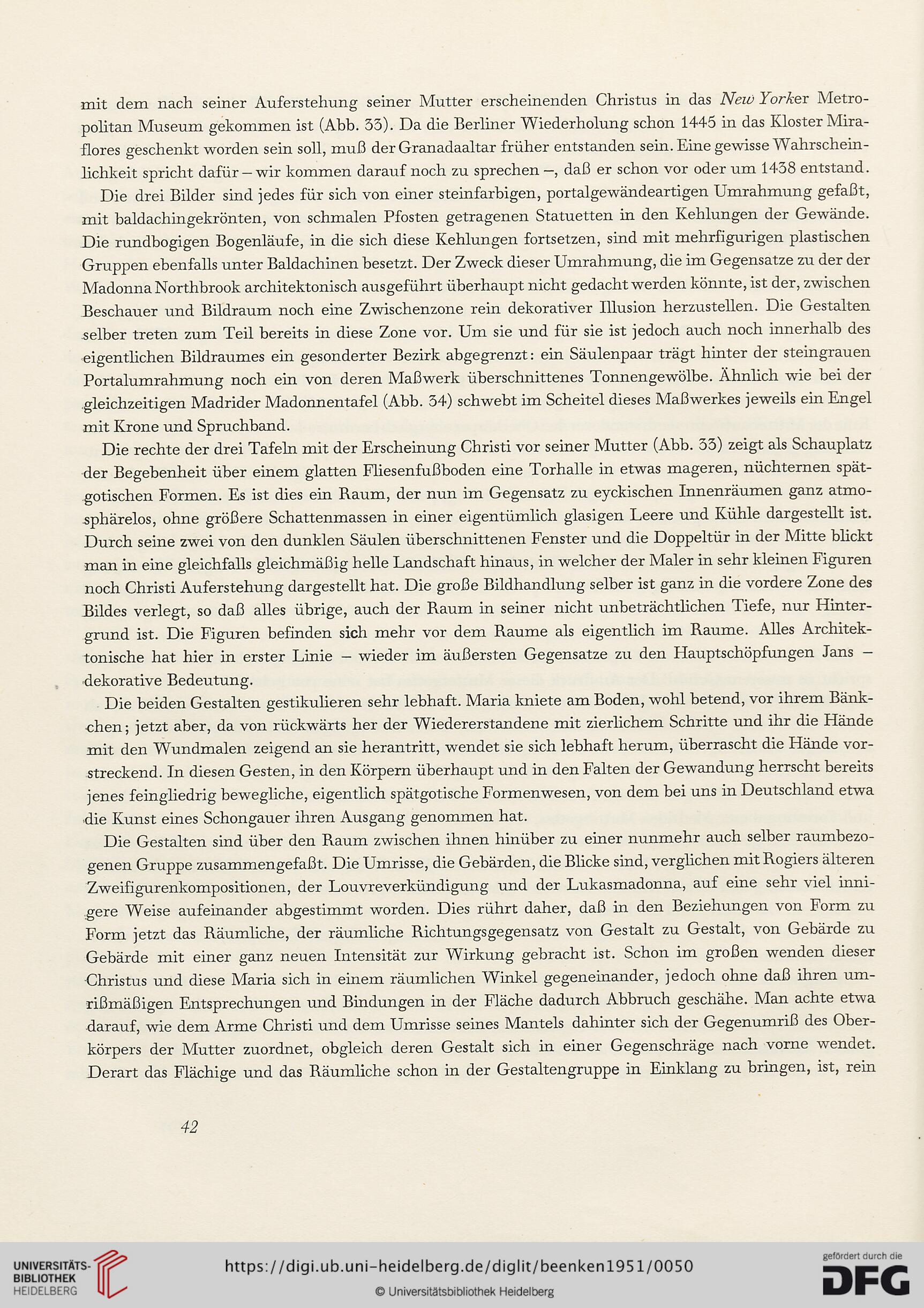mit dem nach seiner Auferstehung seiner Mutter erscheinenden Christus in das New Yorker Metro-
politan Museum gekommen ist (Abb. 33). Da die Berliner Wiederholung schon 1445 in das Kloster Mira-
flores geschenkt worden sein soll, muß der Granadaaltar früher entstanden sein. Eine gewisse Wahrschein-
lichkeit spricht dafür —wir kommen darauf noch zu sprechen —, daß er schon vor oder um 1438 entstand.
Die drei Bilder sind jedes für sich von einer steinfarbigen, portalgewändeartigen Umrahmung gefaßt,
mit baldachingekrönten, von schmalen Pfosten getragenen Statuetten in den Kehlungen der Gewände.
Die rundbogigen Bogenläufe, in die sich diese Kehlungen fortsetzen, sind mit mehrfigurigen plastischen
Gruppen ebenfalls unter Baldachinen besetzt. Der Zweck dieser Umrahmung, die im Gegensätze zu der der
Madonna Northbrook architektonisch ausgeführt überhaupt nicht gedacht werden könnte, ist der, zwischen
Beschauer und Bildraum noch eine Zwischenzone rein dekorativer Illusion herzustellen. Die Gestalten
selber treten zum Teil bereits in diese Zone vor. Um sie und für sie ist jedoch auch noch innerhalb des
eigentlichen Bildraumes ein gesonderter Bezirk abgegrenzt: ein Säulenpaar trägt hinter der steingrauen
Portalumrahmung noch ein von deren Maßwerk überschnittenes Tonnengewölbe. Ähnlich wie bei der
gleichzeitigen Madrider Madonnentafel (Abb. 34) schwebt im Scheitel dieses Maßwerkes jeweils ein Engel
mit Krone und Spruchband.
Die rechte der drei Tafeln mit der Erscheinung Christi vor seiner Mutter (Abb. 33) zeigt als Schauplatz
der Begebenheit über einem glatten Fliesenfußboden eine Torhalle in etwas mageren, nüchternen spät-
gotischen Formen. Es ist dies ein Raum, der nun im Gegensatz zu eyckischen Innenräumen ganz atmo-
sphärelos, ohne größere Schattenmassen in einer eigentümlich glasigen Leere und Kühle dargestellt ist.
Durch seine zwei von den dunklen Säulen überschnittenen Fenster und die Doppeltür in der Mitte blickt
man in eine gleichfalls gleichmäßig helle Landschaft hinaus, in welcher der Maler in sehr kleinen Figuren
noch Christi Auferstehung dargestellt hat. Die große Bildhandlung selber ist ganz in die vordere Zone des
Bildes verlegt, so daß alles übrige, auch der Raum in seiner nicht unbeträchtlichen Tiefe, nur Hinter-
grund ist. Die Figuren befinden sich mehr vor dem Raume als eigentlich im Raume. Alles Architek-
tonische hat hier in erster Linie — wieder im äußersten Gegensätze zu den Hauptschöpfungen Jans —
dekorative Bedeutung.
Die beiden Gestalten gestikulieren sehr lebhaft. Maria kniete am Boden, wohl betend, vor ihrem Bänk-
chen; jetzt aber, da von rückwärts her der Wiedererstandene mit zierlichem Schritte und ihr die Hände
mit den Wundmalen zeigend an sie herantritt, wendet sie sich lebhaft herum, überrascht die Hände vor-
streckend. In diesen Gesten, in den Körpern überhaupt und in den Falten der Gewandung herrscht bereits
jenes feingliedrig bewegliche, eigentlich spätgotische Formenwesen, von dem bei uns in Deutschland etwa
die Kunst eines Schongauer ihren Ausgang genommen hat.
Die Gestalten sind über den Raum zwischen ihnen hinüber zu einer nunmehr auch selber raumbezo-
genen Gruppe zusammengefaßt. Die Umrisse, die Gebärden, die Blicke sind, verglichen mit Rogiers älteren
Zweifigurenkompositionen, der Louvreverkündigung und der Lukasmadonna, auf eine sehr viel inni-
gere Weise aufeinander abgestimmt worden. Dies rührt daher, daß in den Beziehungen von Form zu
Form jetzt das Räumliche, der räumliche Richtungsgegensatz von Gestalt zu Gestalt, von Gebärde zu
Gebärde mit einer ganz neuen Intensität zur Wirkung gebracht ist. Schon im großen wenden dieser
Christus und diese Maria sich in einem räumlichen Winkel gegeneinander, jedoch ohne daß ihren um-
rißmäßigen Entsprechungen und Bindungen in der Fläche dadurch Abbruch geschähe. Man achte etwa
darauf, wie dem Arme Christi und dem Umrisse seines Mantels dahinter sich der Gegenumriß des Ober-
körpers der Mutter zuordnet, obgleich deren Gestalt sich in einer Gegenschräge nach vorne wendet.
Derart das Flächige und das Räumliche schon in der Gestaltengruppe in Einklang zu bringen, ist, rein
42
politan Museum gekommen ist (Abb. 33). Da die Berliner Wiederholung schon 1445 in das Kloster Mira-
flores geschenkt worden sein soll, muß der Granadaaltar früher entstanden sein. Eine gewisse Wahrschein-
lichkeit spricht dafür —wir kommen darauf noch zu sprechen —, daß er schon vor oder um 1438 entstand.
Die drei Bilder sind jedes für sich von einer steinfarbigen, portalgewändeartigen Umrahmung gefaßt,
mit baldachingekrönten, von schmalen Pfosten getragenen Statuetten in den Kehlungen der Gewände.
Die rundbogigen Bogenläufe, in die sich diese Kehlungen fortsetzen, sind mit mehrfigurigen plastischen
Gruppen ebenfalls unter Baldachinen besetzt. Der Zweck dieser Umrahmung, die im Gegensätze zu der der
Madonna Northbrook architektonisch ausgeführt überhaupt nicht gedacht werden könnte, ist der, zwischen
Beschauer und Bildraum noch eine Zwischenzone rein dekorativer Illusion herzustellen. Die Gestalten
selber treten zum Teil bereits in diese Zone vor. Um sie und für sie ist jedoch auch noch innerhalb des
eigentlichen Bildraumes ein gesonderter Bezirk abgegrenzt: ein Säulenpaar trägt hinter der steingrauen
Portalumrahmung noch ein von deren Maßwerk überschnittenes Tonnengewölbe. Ähnlich wie bei der
gleichzeitigen Madrider Madonnentafel (Abb. 34) schwebt im Scheitel dieses Maßwerkes jeweils ein Engel
mit Krone und Spruchband.
Die rechte der drei Tafeln mit der Erscheinung Christi vor seiner Mutter (Abb. 33) zeigt als Schauplatz
der Begebenheit über einem glatten Fliesenfußboden eine Torhalle in etwas mageren, nüchternen spät-
gotischen Formen. Es ist dies ein Raum, der nun im Gegensatz zu eyckischen Innenräumen ganz atmo-
sphärelos, ohne größere Schattenmassen in einer eigentümlich glasigen Leere und Kühle dargestellt ist.
Durch seine zwei von den dunklen Säulen überschnittenen Fenster und die Doppeltür in der Mitte blickt
man in eine gleichfalls gleichmäßig helle Landschaft hinaus, in welcher der Maler in sehr kleinen Figuren
noch Christi Auferstehung dargestellt hat. Die große Bildhandlung selber ist ganz in die vordere Zone des
Bildes verlegt, so daß alles übrige, auch der Raum in seiner nicht unbeträchtlichen Tiefe, nur Hinter-
grund ist. Die Figuren befinden sich mehr vor dem Raume als eigentlich im Raume. Alles Architek-
tonische hat hier in erster Linie — wieder im äußersten Gegensätze zu den Hauptschöpfungen Jans —
dekorative Bedeutung.
Die beiden Gestalten gestikulieren sehr lebhaft. Maria kniete am Boden, wohl betend, vor ihrem Bänk-
chen; jetzt aber, da von rückwärts her der Wiedererstandene mit zierlichem Schritte und ihr die Hände
mit den Wundmalen zeigend an sie herantritt, wendet sie sich lebhaft herum, überrascht die Hände vor-
streckend. In diesen Gesten, in den Körpern überhaupt und in den Falten der Gewandung herrscht bereits
jenes feingliedrig bewegliche, eigentlich spätgotische Formenwesen, von dem bei uns in Deutschland etwa
die Kunst eines Schongauer ihren Ausgang genommen hat.
Die Gestalten sind über den Raum zwischen ihnen hinüber zu einer nunmehr auch selber raumbezo-
genen Gruppe zusammengefaßt. Die Umrisse, die Gebärden, die Blicke sind, verglichen mit Rogiers älteren
Zweifigurenkompositionen, der Louvreverkündigung und der Lukasmadonna, auf eine sehr viel inni-
gere Weise aufeinander abgestimmt worden. Dies rührt daher, daß in den Beziehungen von Form zu
Form jetzt das Räumliche, der räumliche Richtungsgegensatz von Gestalt zu Gestalt, von Gebärde zu
Gebärde mit einer ganz neuen Intensität zur Wirkung gebracht ist. Schon im großen wenden dieser
Christus und diese Maria sich in einem räumlichen Winkel gegeneinander, jedoch ohne daß ihren um-
rißmäßigen Entsprechungen und Bindungen in der Fläche dadurch Abbruch geschähe. Man achte etwa
darauf, wie dem Arme Christi und dem Umrisse seines Mantels dahinter sich der Gegenumriß des Ober-
körpers der Mutter zuordnet, obgleich deren Gestalt sich in einer Gegenschräge nach vorne wendet.
Derart das Flächige und das Räumliche schon in der Gestaltengruppe in Einklang zu bringen, ist, rein
42