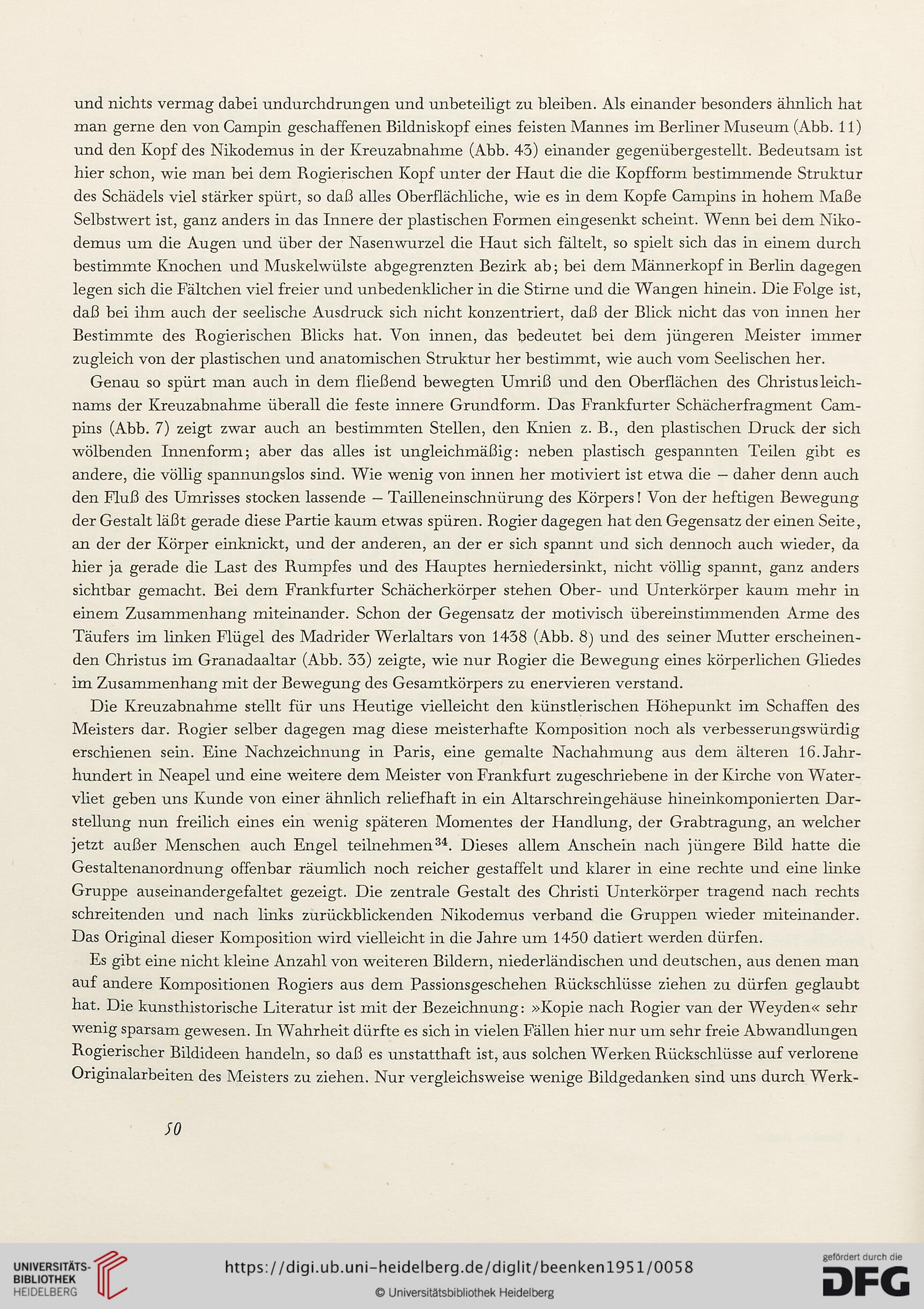und nichts vermag dabei undurchdrungen und unbeteiligt zu bleiben. Als einander besonders ähnlich hat
man gerne den von Campin geschaffenen Bildniskopf eines feisten Mannes im Berliner Museum (Abb. 11)
und den Kopf des Nikodemus in der Kreuzabnahme (Abb. 43) einander gegenübergestellt. Bedeutsam ist
hier schon, wie man bei dem Rogierischen Kopf unter der Haut die die Kopfform bestimmende Struktur
des Schädels viel stärker spürt, so daß alles Oberflächliche, wie es in dem Kopfe Campins in hohem Maße
Selbstwert ist, ganz anders in das Innere der plastischen Formen eingesenkt scheint. Wenn bei dem Niko-
demus um die Augen und über der Nasenwurzel die Haut sich fältelt, so spielt sich das in einem durch
bestimmte Knochen und Muskelwülste abgegrenzten Bezirk ab; bei dem Männerkopf in Berlin dagegen
legen sich die Fältchen viel freier und unbedenklicher in die Stirne und die Wangen hinein. Die Folge ist,
daß bei ihm auch der seelische Ausdruck sich nicht konzentriert, daß der Blick nicht das von innen her
Bestimmte des Rogierischen Blicks hat. Von innen, das bedeutet bei dem jüngeren Meister immer
zugleich von der plastischen und anatomischen Struktur her bestimmt, wie auch vom Seelischen her.
Genau so spürt man auch in dem fließend bewegten Umriß und den Oberflächen des Christus leich-
nams der Kreuzabnahme überall die feste innere Grundform. Das Frankfurter Schächerfragment Cam-
pins (Abb. 7) zeigt zwar auch an bestimmten Stellen, den Knien z. B., den plastischen Druck der sich
wölbenden Innenform; aber das alles ist ungleichmäßig: neben plastisch gespannten Teilen gibt es
andere, die völlig spannungslos sind. Wie wenig von innen her motiviert ist etwa die — daher denn auch
den Fluß des Umrisses stocken lassende — Tailleneinschnürung des Körpers! Von der heftigen Bewegung
der Gestalt läßt gerade diese Partie kaum etwas spüren. Rogier dagegen hat den Gegensatz der einen Seite,
an der der Körper einknickt, und der anderen, an der er sich spannt und sich dennoch auch wieder, da
hier ja gerade die Last des Rumpfes und des Hauptes herniedersinkt, nicht völlig spannt, ganz anders
sichtbar gemacht. Bei dem Frankfurter Schächerkörper stehen Ober- und Unterkörper kaum mehr in
einem Zusammenhang miteinander. Schon der Gegensatz der motivisch übereinstimmenden Arme des
Täufers im linken Flügel des Madrider Werlaltars von 1438 (Abb. 8) und des seiner Mutter erscheinen-
den Christus im Granadaaltar (Abb. 33) zeigte, wie nur Rogier die Bewegung eines körperlichen Gliedes
im Zusammenhang mit der Bewegung des Gesamtkörpers zu enervieren verstand.
Die Kreuzabnahme stellt für uns Heutige vielleicht den künstlerischen Höhepunkt im Schaffen des
Meisters dar. Rogier selber dagegen mag diese meisterhafte Komposition noch als verbesserungswürdig
erschienen sein. Eine Nachzeichnung in Paris, eine gemalte Nachahmung aus dem älteren 16. Jahr-
hundert in Neapel und eine weitere dem Meister von Frankfurt zugeschriebene in der Kirche von Water-
vliet geben uns Kunde von einer ähnlich reliefhaft in ein Altarschreingehäuse hineinkomponierten Dar-
stellung nun freilich eines ein wenig späteren Momentes der Handlung, der Grabtragung, an welcher
jetzt außer Menschen auch Engel teilnehmen34. Dieses allem Anschein nach jüngere Bild hatte die
Gestaltenanordnung offenbar räumlich noch reicher gestaffelt und klarer in eine rechte und eine linke
Gruppe auseinandergefaltet gezeigt. Die zentrale Gestalt des Christi Unterkörper tragend nach rechts
schreitenden und nach links zurückblickenden Nikodemus verband die Gruppen wieder miteinander.
Das Original dieser Komposition wird vielleicht in die Jahre um 1450 datiert werden dürfen.
Es gibt eine nicht kleine Anzahl von weiteren Bildern, niederländischen und deutschen, aus denen man
auf andere Kompositionen Rogiers aus dem Passionsgeschehen Rückschlüsse ziehen zu dürfen geglaubt
hat. Die kunsthistorische Literatur ist mit der Bezeichnung: »Kopie nach Rogier van der Weyden« sehr
wenig sparsam gewesen. In Wahrheit dürfte es sich in vielen Fällen hier nur um sehr freie Abwandlungen
Rogierischer Bildideen handeln, so daß es unstatthaft ist, aus solchen Werken Rückschlüsse auf verlorene
Originalarbeiten des Meisters zu ziehen. Nur vergleichsweise wenige Bildgedanken sind uns durch Werk-
J0
man gerne den von Campin geschaffenen Bildniskopf eines feisten Mannes im Berliner Museum (Abb. 11)
und den Kopf des Nikodemus in der Kreuzabnahme (Abb. 43) einander gegenübergestellt. Bedeutsam ist
hier schon, wie man bei dem Rogierischen Kopf unter der Haut die die Kopfform bestimmende Struktur
des Schädels viel stärker spürt, so daß alles Oberflächliche, wie es in dem Kopfe Campins in hohem Maße
Selbstwert ist, ganz anders in das Innere der plastischen Formen eingesenkt scheint. Wenn bei dem Niko-
demus um die Augen und über der Nasenwurzel die Haut sich fältelt, so spielt sich das in einem durch
bestimmte Knochen und Muskelwülste abgegrenzten Bezirk ab; bei dem Männerkopf in Berlin dagegen
legen sich die Fältchen viel freier und unbedenklicher in die Stirne und die Wangen hinein. Die Folge ist,
daß bei ihm auch der seelische Ausdruck sich nicht konzentriert, daß der Blick nicht das von innen her
Bestimmte des Rogierischen Blicks hat. Von innen, das bedeutet bei dem jüngeren Meister immer
zugleich von der plastischen und anatomischen Struktur her bestimmt, wie auch vom Seelischen her.
Genau so spürt man auch in dem fließend bewegten Umriß und den Oberflächen des Christus leich-
nams der Kreuzabnahme überall die feste innere Grundform. Das Frankfurter Schächerfragment Cam-
pins (Abb. 7) zeigt zwar auch an bestimmten Stellen, den Knien z. B., den plastischen Druck der sich
wölbenden Innenform; aber das alles ist ungleichmäßig: neben plastisch gespannten Teilen gibt es
andere, die völlig spannungslos sind. Wie wenig von innen her motiviert ist etwa die — daher denn auch
den Fluß des Umrisses stocken lassende — Tailleneinschnürung des Körpers! Von der heftigen Bewegung
der Gestalt läßt gerade diese Partie kaum etwas spüren. Rogier dagegen hat den Gegensatz der einen Seite,
an der der Körper einknickt, und der anderen, an der er sich spannt und sich dennoch auch wieder, da
hier ja gerade die Last des Rumpfes und des Hauptes herniedersinkt, nicht völlig spannt, ganz anders
sichtbar gemacht. Bei dem Frankfurter Schächerkörper stehen Ober- und Unterkörper kaum mehr in
einem Zusammenhang miteinander. Schon der Gegensatz der motivisch übereinstimmenden Arme des
Täufers im linken Flügel des Madrider Werlaltars von 1438 (Abb. 8) und des seiner Mutter erscheinen-
den Christus im Granadaaltar (Abb. 33) zeigte, wie nur Rogier die Bewegung eines körperlichen Gliedes
im Zusammenhang mit der Bewegung des Gesamtkörpers zu enervieren verstand.
Die Kreuzabnahme stellt für uns Heutige vielleicht den künstlerischen Höhepunkt im Schaffen des
Meisters dar. Rogier selber dagegen mag diese meisterhafte Komposition noch als verbesserungswürdig
erschienen sein. Eine Nachzeichnung in Paris, eine gemalte Nachahmung aus dem älteren 16. Jahr-
hundert in Neapel und eine weitere dem Meister von Frankfurt zugeschriebene in der Kirche von Water-
vliet geben uns Kunde von einer ähnlich reliefhaft in ein Altarschreingehäuse hineinkomponierten Dar-
stellung nun freilich eines ein wenig späteren Momentes der Handlung, der Grabtragung, an welcher
jetzt außer Menschen auch Engel teilnehmen34. Dieses allem Anschein nach jüngere Bild hatte die
Gestaltenanordnung offenbar räumlich noch reicher gestaffelt und klarer in eine rechte und eine linke
Gruppe auseinandergefaltet gezeigt. Die zentrale Gestalt des Christi Unterkörper tragend nach rechts
schreitenden und nach links zurückblickenden Nikodemus verband die Gruppen wieder miteinander.
Das Original dieser Komposition wird vielleicht in die Jahre um 1450 datiert werden dürfen.
Es gibt eine nicht kleine Anzahl von weiteren Bildern, niederländischen und deutschen, aus denen man
auf andere Kompositionen Rogiers aus dem Passionsgeschehen Rückschlüsse ziehen zu dürfen geglaubt
hat. Die kunsthistorische Literatur ist mit der Bezeichnung: »Kopie nach Rogier van der Weyden« sehr
wenig sparsam gewesen. In Wahrheit dürfte es sich in vielen Fällen hier nur um sehr freie Abwandlungen
Rogierischer Bildideen handeln, so daß es unstatthaft ist, aus solchen Werken Rückschlüsse auf verlorene
Originalarbeiten des Meisters zu ziehen. Nur vergleichsweise wenige Bildgedanken sind uns durch Werk-
J0