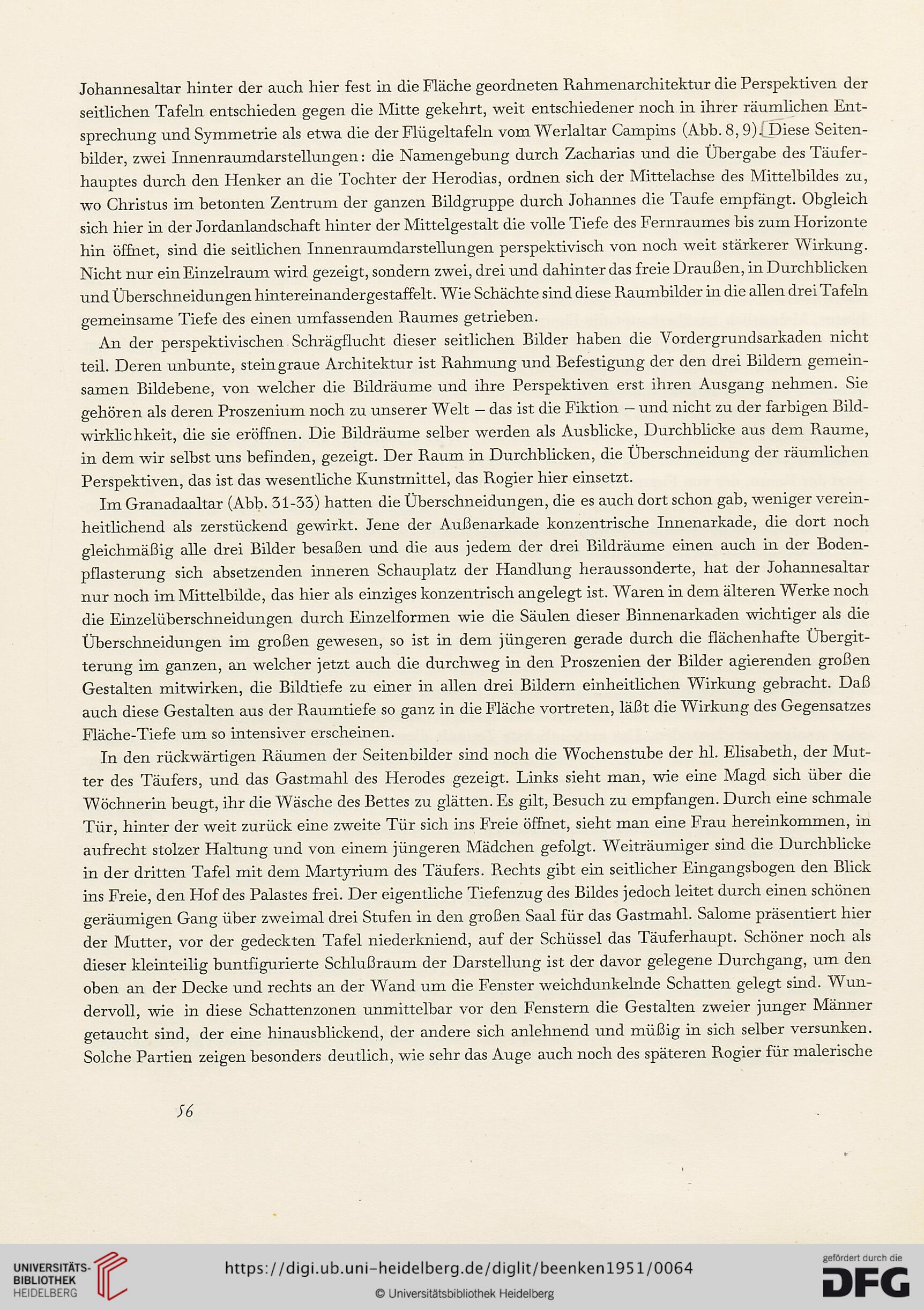Johannesaltar hinter der auch hier fest in die Fläche geordneten Rahmenarchitektur die Perspektiven der
seitlichen Tafeln entschieden gegen die Mitte gekehrt, weit entschiedener noch in ihrer räumlichen Ent-
sprechung und Symmetrie als etwa die der Flügeltafeln vom Werlaltar Campins (Abb. 8, 9) {Diese Seiten-
bilder, zwei Innenraumdarstellungen: die Namengebung durch Zacharias und die Übergabe des Täufer-
hauptes durch den Henker an die Tochter der Herodias, ordnen sich der Mittelachse des Mittelbildes zu,
wo Christus im betonten Zentrum der ganzen Bildgruppe durch Johannes die Taufe empfängt. Obgleich
sich hier in der Jordanlandschaft hinter der Mittelgestalt die volle Tiefe des Fernraumes bis zum Horizonte
hin öffnet, sind die seitlichen Innenraumdarstellungen perspektivisch von noch weit stärkerer Wirkung.
Nicht nur ein Einzelraum wird gezeigt, sondern zwei, drei und dahinter das freie Draußen, in Durchblicken
und Überschneidungen hintereinandergestaffelt. Wie Schächte sind diese Raumbilder in die allen drei Tafeln
gemeinsame Tiefe des einen umfassenden Raumes getrieben.
An der perspektivischen Schrägflucht dieser seitlichen Bilder haben die Vordergrundsarkaden nicht
teil. Deren unbunte, stein graue Architektur ist Rahmung und Befestigung der den drei Bildern gemein-
samen Bildebene, von welcher die Bildräume und ihre Perspektiven erst ihren Ausgang nehmen. Sie
gehören als deren Proszenium noch zu unserer Welt — das ist die Fiktion — und nicht zu der farbigen Bild-
wirklichkeit, die sie eröffnen. Die Bildräume selber werden als Ausblicke, Durchblicke aus dem Raume,
in dem wir selbst uns befinden, gezeigt. Der Raum in Durchblicken, die Überschneidung der räumlichen
Perspektiven, das ist das wesentliche Kunstmittel, das Rogier hier einsetzt.
Im Granadaaltar (Abb. 31-33) hatten die Überschneidungen, die es auch dort schon gab, weniger verein-
heitlichend als zerstückend gewirkt. Jene der Außenarkade konzentrische Innenarkade, die dort noch
gleichmäßig alle drei Bilder besaßen und die aus jedem der drei Bildräume einen auch in der Boden-
pflasterung sich absetzenden inneren Schauplatz der Handlung heraussonderte, hat der Johannesaltar
nur noch im Mittelbilde, das hier als einziges konzentrisch angelegt ist. Waren in dem älteren Werke noch
die Einzelüberschneidungen durch Einzelformen wie die Säulen dieser Binnenarkaden wichtiger als die
Überschneidungen im großen gewesen, so ist in dem jüngeren gerade durch die flächenhafte Übergit-
terung im ganzen, an welcher jetzt auch die durchweg in den Proszenien der Bilder agierenden großen
Gestalten mitwirken, die Bildtiefe zu einer in allen drei Bildern einheitlichen Wirkung gebracht. Daß
auch diese Gestalten aus der Raumtiefe so ganz in die Fläche vortreten, läßt die Wirkung des Gegensatzes
Fläche-Tiefe um so intensiver erscheinen.
In den rückwärtigen Räumen der Seitenbilder sind noch die Wochenstube der hl. Elisabeth, der Mut-
ter des Täufers, und das Gastmahl des Herodes gezeigt. Links sieht man, wie eine Magd sich über die
Wöchnerin beugt, ihr die Wäsche des Bettes zu glätten. Es gilt, Besuch zu empfangen. Durch eine schmale
Tür, hinter der weit zurück eine zweite Tür sich ins Freie öffnet, sieht man eine Frau hereinkommen, in
aufrecht stolzer Haltung und von einem jüngeren Mädchen gefolgt. Weiträumiger sind die Durchblicke
in der dritten Tafel mit dem Martyrium des Täufers. Rechts gibt ein seitlicher Eingangsbogen den Bück
ins Freie, den Hof des Palastes frei. Der eigentliche Tiefenzug des Bildes jedoch leitet durch einen schönen
geräumigen Gang über zweimal drei Stufen in den großen Saal für das Gastmahl. Salome präsentiert hier
der Mutter, vor der gedeckten Tafel niederkniend, auf der Schüssel das Täuferhaupt. Schöner noch als
dieser kleinteilig buntfigurierte Schlußraum der Darstellung ist der davor gelegene Durchgang, um den
oben an der Decke und rechts an der Wand um die Fenster weichdunkelnde Schatten gelegt sind. Wun-
dervoll, wie in diese Schattenzonen unmittelbar vor den Fenstern die Gestalten zweier junger Männer
getaucht sind, der eine hinausblickend, der andere sich anlehnend und müßig in sich selber versunken.
Solche Partien zeigen besonders deutlich, wie sehr das Auge auch noch des späteren Rogier für malerische
Id
seitlichen Tafeln entschieden gegen die Mitte gekehrt, weit entschiedener noch in ihrer räumlichen Ent-
sprechung und Symmetrie als etwa die der Flügeltafeln vom Werlaltar Campins (Abb. 8, 9) {Diese Seiten-
bilder, zwei Innenraumdarstellungen: die Namengebung durch Zacharias und die Übergabe des Täufer-
hauptes durch den Henker an die Tochter der Herodias, ordnen sich der Mittelachse des Mittelbildes zu,
wo Christus im betonten Zentrum der ganzen Bildgruppe durch Johannes die Taufe empfängt. Obgleich
sich hier in der Jordanlandschaft hinter der Mittelgestalt die volle Tiefe des Fernraumes bis zum Horizonte
hin öffnet, sind die seitlichen Innenraumdarstellungen perspektivisch von noch weit stärkerer Wirkung.
Nicht nur ein Einzelraum wird gezeigt, sondern zwei, drei und dahinter das freie Draußen, in Durchblicken
und Überschneidungen hintereinandergestaffelt. Wie Schächte sind diese Raumbilder in die allen drei Tafeln
gemeinsame Tiefe des einen umfassenden Raumes getrieben.
An der perspektivischen Schrägflucht dieser seitlichen Bilder haben die Vordergrundsarkaden nicht
teil. Deren unbunte, stein graue Architektur ist Rahmung und Befestigung der den drei Bildern gemein-
samen Bildebene, von welcher die Bildräume und ihre Perspektiven erst ihren Ausgang nehmen. Sie
gehören als deren Proszenium noch zu unserer Welt — das ist die Fiktion — und nicht zu der farbigen Bild-
wirklichkeit, die sie eröffnen. Die Bildräume selber werden als Ausblicke, Durchblicke aus dem Raume,
in dem wir selbst uns befinden, gezeigt. Der Raum in Durchblicken, die Überschneidung der räumlichen
Perspektiven, das ist das wesentliche Kunstmittel, das Rogier hier einsetzt.
Im Granadaaltar (Abb. 31-33) hatten die Überschneidungen, die es auch dort schon gab, weniger verein-
heitlichend als zerstückend gewirkt. Jene der Außenarkade konzentrische Innenarkade, die dort noch
gleichmäßig alle drei Bilder besaßen und die aus jedem der drei Bildräume einen auch in der Boden-
pflasterung sich absetzenden inneren Schauplatz der Handlung heraussonderte, hat der Johannesaltar
nur noch im Mittelbilde, das hier als einziges konzentrisch angelegt ist. Waren in dem älteren Werke noch
die Einzelüberschneidungen durch Einzelformen wie die Säulen dieser Binnenarkaden wichtiger als die
Überschneidungen im großen gewesen, so ist in dem jüngeren gerade durch die flächenhafte Übergit-
terung im ganzen, an welcher jetzt auch die durchweg in den Proszenien der Bilder agierenden großen
Gestalten mitwirken, die Bildtiefe zu einer in allen drei Bildern einheitlichen Wirkung gebracht. Daß
auch diese Gestalten aus der Raumtiefe so ganz in die Fläche vortreten, läßt die Wirkung des Gegensatzes
Fläche-Tiefe um so intensiver erscheinen.
In den rückwärtigen Räumen der Seitenbilder sind noch die Wochenstube der hl. Elisabeth, der Mut-
ter des Täufers, und das Gastmahl des Herodes gezeigt. Links sieht man, wie eine Magd sich über die
Wöchnerin beugt, ihr die Wäsche des Bettes zu glätten. Es gilt, Besuch zu empfangen. Durch eine schmale
Tür, hinter der weit zurück eine zweite Tür sich ins Freie öffnet, sieht man eine Frau hereinkommen, in
aufrecht stolzer Haltung und von einem jüngeren Mädchen gefolgt. Weiträumiger sind die Durchblicke
in der dritten Tafel mit dem Martyrium des Täufers. Rechts gibt ein seitlicher Eingangsbogen den Bück
ins Freie, den Hof des Palastes frei. Der eigentliche Tiefenzug des Bildes jedoch leitet durch einen schönen
geräumigen Gang über zweimal drei Stufen in den großen Saal für das Gastmahl. Salome präsentiert hier
der Mutter, vor der gedeckten Tafel niederkniend, auf der Schüssel das Täuferhaupt. Schöner noch als
dieser kleinteilig buntfigurierte Schlußraum der Darstellung ist der davor gelegene Durchgang, um den
oben an der Decke und rechts an der Wand um die Fenster weichdunkelnde Schatten gelegt sind. Wun-
dervoll, wie in diese Schattenzonen unmittelbar vor den Fenstern die Gestalten zweier junger Männer
getaucht sind, der eine hinausblickend, der andere sich anlehnend und müßig in sich selber versunken.
Solche Partien zeigen besonders deutlich, wie sehr das Auge auch noch des späteren Rogier für malerische
Id