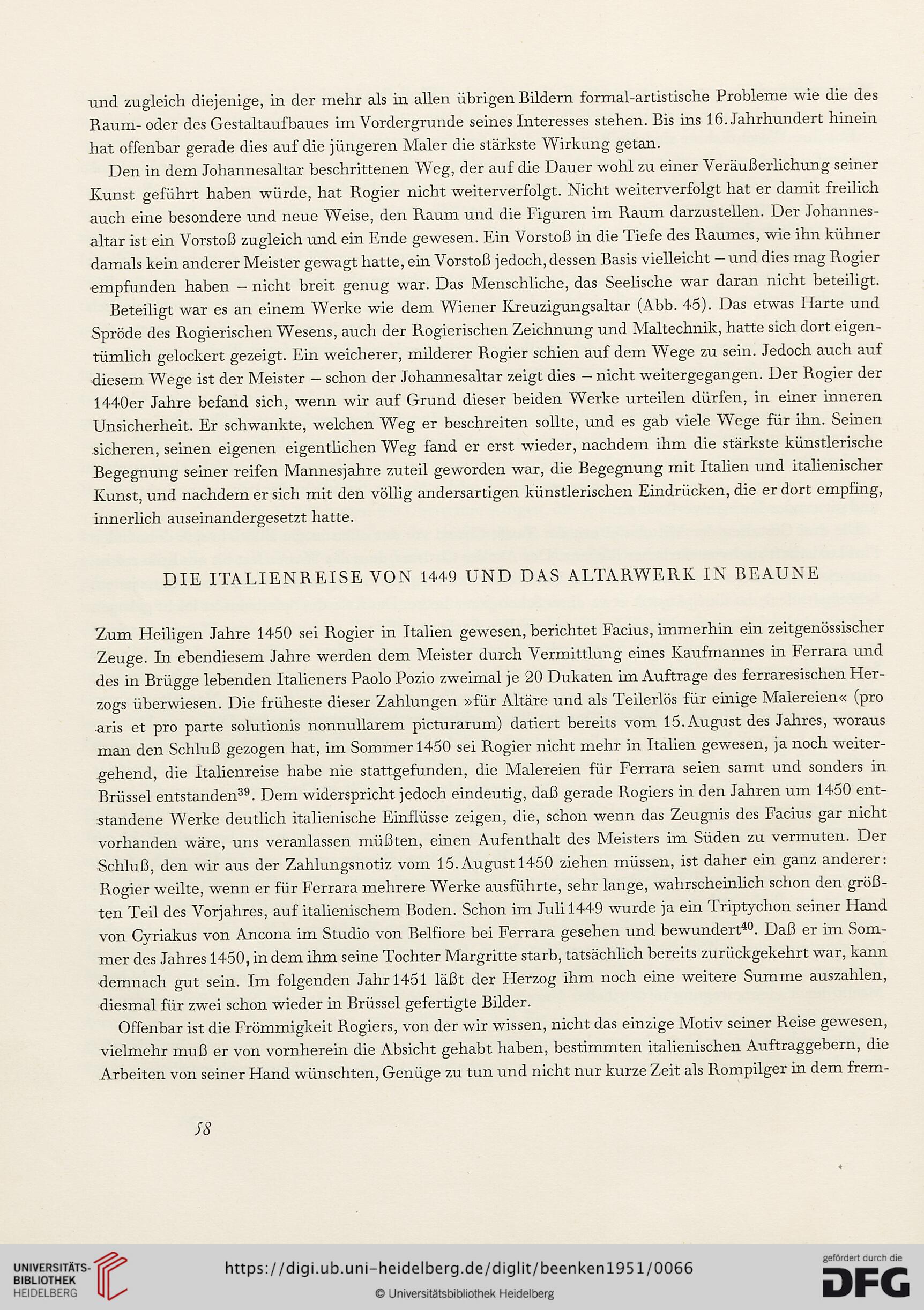und zugleich diejenige, in der mehr als in allen übrigen Bildern formal-artistische Probleme wie die des
Raum- oder des Gestaltaufbaues im Vordergründe seines Interesses stehen. Bis ins 16. Jahrhundert hinein
hat offenbar gerade dies auf die jüngeren Maler die stärkste Wirkung getan.
Den in dem Johannesaltar beschrittenen Weg, der auf die Dauer wohl zu einer Veräußerlichung seiner
Kunst geführt haben würde, hat Rogier nicht weiterverfolgt. Nicht weiterverfolgt hat er damit freilich
auch eine besondere und neue Weise, den Raum und die Figuren im Raum darzustellen. Der Johannes-
altar ist ein Vorstoß zugleich und ein Ende gewesen. Ein Vorstoß in die Tiefe des Raumes, wie ihn kühner
damals kein anderer Meister gewagt hatte, ein Vorstoß jedoch, dessen Basis vielleicht — und dies mag Rogier
empfunden haben — nicht breit genug war. Das Menschliche, das Seelische war daran nicht beteiligt.
Beteiligt war es an einem Werke wie dem Wiener Kreuzigungsaltar (Abb. 45). Das etwas Harte und
Spröde des Rogierischen Wesens, auch der Rogierischen Zeichnung und Maltechnik, hatte sich dort eigen-
tümlich gelockert gezeigt. Ein weicherer, milderer Rogier schien auf dem Wege zu sein. Jedoch auch auf
diesem Wege ist der Meister — schon der Johannesaltar zeigt dies — nicht weitergegangen. Der Rogier der
1440er Jahre befand sich, wenn wir auf Grund dieser beiden Werke urteilen dürfen, in einer inneren
Unsicherheit. Er schwankte, welchen Weg er beschreiten sollte, und es gab viele Wege für ihn. Seinen
sicheren, seinen eigenen eigentlichen Weg fand er erst wieder, nachdem ihm die stärkste künstlerische
Begegnung seiner reifen Mannesjahre zuteil geworden war, die Begegnung mit Italien und italienischer
Kunst, und nachdem er sich mit den völlig andersartigen künstlerischen Eindrücken, die er dort empfing,
innerlich auseinandergesetzt hatte.
DIE ITALIENREISE VON 1449 UND DAS ALTARWERK IN BEAUNE
Zum Heiligen Jahre 1450 sei Rogier in Italien gewesen, berichtet Facius, immerhin ein zeitgenössischer
Zeuge. In ebendiesem Jahre werden dem Meister durch Vermittlung eines Kaufmannes in Ferrara und
des in Brügge lebenden Italieners Paolo Pozio zweimal je 20 Dukaten im Auftrage des ferraresischen Her-
zogs überwiesen. Die früheste dieser Zahlungen »für Altäre und als Teilerlös für einige Malereien« (pro
aris et pro parte solutionis nonnullarem picturarum) datiert bereits vom 15. August des Jahres, woraus
man den Schluß gezogen hat, im Sommer 1450 sei Rogier nicht mehr in Italien gewesen, ja noch weiter-
gehend, die Italienreise habe nie stattgefunden, die Malereien für Ferrara seien samt und sonders in
Brüssel entstanden39. Dem widerspricht jedoch eindeutig, daß gerade Rogiers in den Jahren um 1450 ent-
standene Werke deutlich italienische Einflüsse zeigen, die, schon wenn das Zeugnis des Facius gar nicht
vorhanden wäre, uns veranlassen müßten, einen Aufenthalt des Meisters im Süden zu vermuten. Der
Schluß, den wir aus der Zahlungsnotiz vom 15.Augustl450 ziehen müssen, ist daher ein ganz anderer:
Rogier weilte, wenn er für Ferrara mehrere Werke ausführte, sehr lange, wahrscheinlich schon den größ-
ten Teil des Vorjahres, auf italienischem Boden. Schon im Juli 1449 wurde ja ein Triptychon seiner Hand
von Cyriakus von Ancona im Studio von Belfiore bei Ferrara gesehen und bewundert40. Daß er im Som-
mer des Jahres 1450, in dem ihm seine Tochter Margritte starb, tatsächlich bereits zurückgekehrt war, kann
demnach gut sein. Im folgenden Jahr 1451 läßt der Herzog ihm noch eine weitere Summe auszahlen,
diesmal für zwei schon wieder in Brüssel gefertigte Bilder.
Offenbar ist die Frömmigkeit Rogiers, von der wir wissen, nicht das einzige Motiv seiner Reise gewesen,
vielmehr muß er von vornherein die Absicht gehabt haben, bestimmten italienischen Auftraggebern, die
Arbeiten von seiner Hand wünschten, Genüge zu tun und nicht nur kurze Zeit als Rompilger in dem frem-
S8
Raum- oder des Gestaltaufbaues im Vordergründe seines Interesses stehen. Bis ins 16. Jahrhundert hinein
hat offenbar gerade dies auf die jüngeren Maler die stärkste Wirkung getan.
Den in dem Johannesaltar beschrittenen Weg, der auf die Dauer wohl zu einer Veräußerlichung seiner
Kunst geführt haben würde, hat Rogier nicht weiterverfolgt. Nicht weiterverfolgt hat er damit freilich
auch eine besondere und neue Weise, den Raum und die Figuren im Raum darzustellen. Der Johannes-
altar ist ein Vorstoß zugleich und ein Ende gewesen. Ein Vorstoß in die Tiefe des Raumes, wie ihn kühner
damals kein anderer Meister gewagt hatte, ein Vorstoß jedoch, dessen Basis vielleicht — und dies mag Rogier
empfunden haben — nicht breit genug war. Das Menschliche, das Seelische war daran nicht beteiligt.
Beteiligt war es an einem Werke wie dem Wiener Kreuzigungsaltar (Abb. 45). Das etwas Harte und
Spröde des Rogierischen Wesens, auch der Rogierischen Zeichnung und Maltechnik, hatte sich dort eigen-
tümlich gelockert gezeigt. Ein weicherer, milderer Rogier schien auf dem Wege zu sein. Jedoch auch auf
diesem Wege ist der Meister — schon der Johannesaltar zeigt dies — nicht weitergegangen. Der Rogier der
1440er Jahre befand sich, wenn wir auf Grund dieser beiden Werke urteilen dürfen, in einer inneren
Unsicherheit. Er schwankte, welchen Weg er beschreiten sollte, und es gab viele Wege für ihn. Seinen
sicheren, seinen eigenen eigentlichen Weg fand er erst wieder, nachdem ihm die stärkste künstlerische
Begegnung seiner reifen Mannesjahre zuteil geworden war, die Begegnung mit Italien und italienischer
Kunst, und nachdem er sich mit den völlig andersartigen künstlerischen Eindrücken, die er dort empfing,
innerlich auseinandergesetzt hatte.
DIE ITALIENREISE VON 1449 UND DAS ALTARWERK IN BEAUNE
Zum Heiligen Jahre 1450 sei Rogier in Italien gewesen, berichtet Facius, immerhin ein zeitgenössischer
Zeuge. In ebendiesem Jahre werden dem Meister durch Vermittlung eines Kaufmannes in Ferrara und
des in Brügge lebenden Italieners Paolo Pozio zweimal je 20 Dukaten im Auftrage des ferraresischen Her-
zogs überwiesen. Die früheste dieser Zahlungen »für Altäre und als Teilerlös für einige Malereien« (pro
aris et pro parte solutionis nonnullarem picturarum) datiert bereits vom 15. August des Jahres, woraus
man den Schluß gezogen hat, im Sommer 1450 sei Rogier nicht mehr in Italien gewesen, ja noch weiter-
gehend, die Italienreise habe nie stattgefunden, die Malereien für Ferrara seien samt und sonders in
Brüssel entstanden39. Dem widerspricht jedoch eindeutig, daß gerade Rogiers in den Jahren um 1450 ent-
standene Werke deutlich italienische Einflüsse zeigen, die, schon wenn das Zeugnis des Facius gar nicht
vorhanden wäre, uns veranlassen müßten, einen Aufenthalt des Meisters im Süden zu vermuten. Der
Schluß, den wir aus der Zahlungsnotiz vom 15.Augustl450 ziehen müssen, ist daher ein ganz anderer:
Rogier weilte, wenn er für Ferrara mehrere Werke ausführte, sehr lange, wahrscheinlich schon den größ-
ten Teil des Vorjahres, auf italienischem Boden. Schon im Juli 1449 wurde ja ein Triptychon seiner Hand
von Cyriakus von Ancona im Studio von Belfiore bei Ferrara gesehen und bewundert40. Daß er im Som-
mer des Jahres 1450, in dem ihm seine Tochter Margritte starb, tatsächlich bereits zurückgekehrt war, kann
demnach gut sein. Im folgenden Jahr 1451 läßt der Herzog ihm noch eine weitere Summe auszahlen,
diesmal für zwei schon wieder in Brüssel gefertigte Bilder.
Offenbar ist die Frömmigkeit Rogiers, von der wir wissen, nicht das einzige Motiv seiner Reise gewesen,
vielmehr muß er von vornherein die Absicht gehabt haben, bestimmten italienischen Auftraggebern, die
Arbeiten von seiner Hand wünschten, Genüge zu tun und nicht nur kurze Zeit als Rompilger in dem frem-
S8