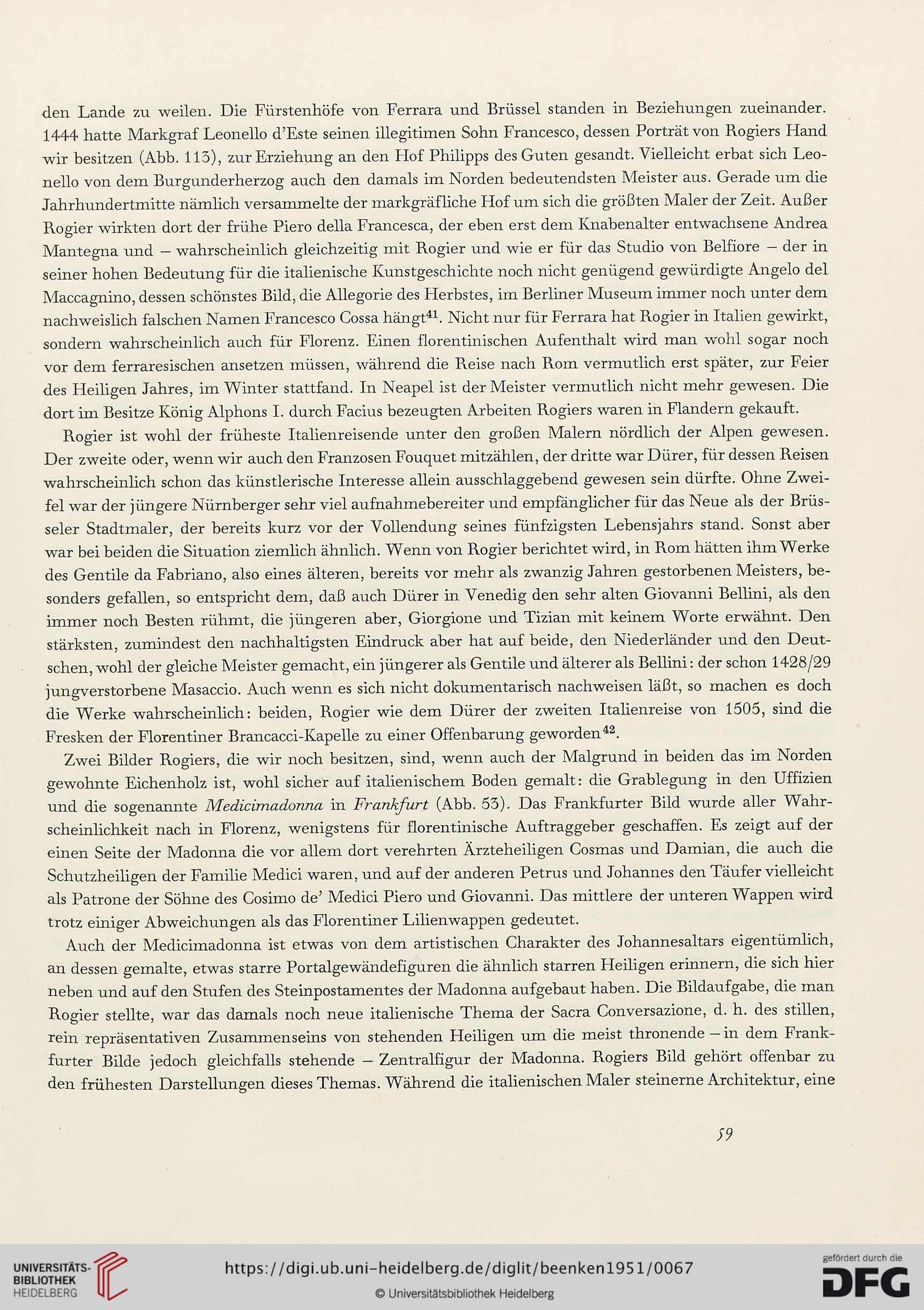den Lande zu weilen. Die Fürstenhöfe von Ferrara und Brüssel standen in Beziehungen zueinander.
1444 hatte Markgraf Leonello d’Este seinen illegitimen Sohn Francesco, dessen Porträt von Rogiers Hand
wir besitzen (Abb. 113), zur Erziehung an den Elof Philipps des Guten gesandt. Vielleicht erbat sich Leo-
nello von dem Burgunderherzog auch den damals im Norden bedeutendsten Meister aus. Gerade um die
Jahrhundertmitte nämlich versammelte der markgräfliche Hof um sich die größten Maler der Zeit. Außer
Rogier wirkten dort der frühe Piero della Francesca, der eben erst dem Knabenalter entwachsene Andrea
Mantegna und — wahrscheinlich gleichzeitig mit Rogier und wie er für das Studio von Belfiore — der in
seiner hohen Bedeutung für die italienische Kunstgeschichte noch nicht genügend gewürdigte Angelo del
Maccagnino, dessen schönstes Bild, die Allegorie des Herbstes, im Berliner Museum immer noch unter dem
nachweislich falschen Namen Francesco Cossa hängt41. Nicht nur für Ferrara hat Rogier in Italien gewirkt,
sondern wahrscheinlich auch für Florenz. Einen florentinischen Aufenthalt wird man wohl sogar noch
vor dem ferraresischen ansetzen müssen, während die Reise nach Rom vermutlich erst später, zur Feier
des Heiligen Jahres, im Winter stattfand. In Neapel ist der Meister vermutlich nicht mehr gewesen. Die
dort im Besitze König Alphons I. durch Facius bezeugten Arbeiten Rogiers waren in Flandern gekauft.
Rogier ist wohl der früheste Italienreisende unter den großen Malern nördlich der Alpen gewesen.
Der zweite oder, wenn wir auch den Franzosen Fouquet mitzählen, der dritte war Dürer, für dessen Reisen
wahrscheinlich schon das künstlerische Interesse allein ausschlaggebend gewesen sein dürfte. Ohne Zwei-
fel war der jüngere Nürnberger sehr viel aufnahmebereiter und empfänglicher für das Neue als der Brüs-
seler Stadtmaler, der bereits kurz vor der Vollendung seines fünfzigsten Lebensjahrs stand. Sonst aber
war bei beiden die Situation ziemlich ähnlich. Wenn von Rogier berichtet wird, in Rom hätten ihm Werke
des Gentile da Fabriano, also eines älteren, bereits vor mehr als zwanzig Jahren gestorbenen Meisters, be-
sonders gefallen, so entspricht dem, daß auch Dürer in Venedig den sehr alten Giovanni Bellini, als den
immer noch Besten rühmt, die jüngeren aber, Giorgione und Tizian mit keinem Worte erwähnt. Den
stärksten, zumindest den nachhaltigsten Eindruck aber hat auf beide, den Niederländer und den Deut-
schen, wohl der gleiche Meister gemacht, ein jüngerer als Gentile und älterer als Bellini: der schon 1428/29
jungverstorbene Masaccio. Auch wenn es sich nicht dokumentarisch nachweisen läßt, so machen es doch
die Werke wahrscheinlich: beiden, Rogier wie dem Dürer der zweiten Italienreise von 1505, sind die
Fresken der Florentiner Brancacci-Kapelle zu einer Offenbarung geworden42.
Zwei Bilder Rogiers, die wir noch besitzen, sind, wenn auch der Malgrund in beiden das im Norden
gewohnte Eichenholz ist, wohl sicher auf italienischem Boden gemalt: die Grablegung in den Uffizien
und die sogenannte Medicimadonna in Frankfurt (Abb. 53). Das Frankfurter Bild wurde aller Wahr-
scheinlichkeit nach in Florenz, wenigstens für florentinische Auftraggeber geschaffen. Es zeigt auf der
einen Seite der Madonna die vor allem dort verehrten Ärzteheiligen Cosmas und Damian, die auch die
Schutzheiligen der Familie Medici waren, und auf der anderen Petrus und Johannes den Täufer vielleicht
als Patrone der Söhne des Cosimo de’ Medici Piero und Giovanni. Das mittlere der unteren Wappen wird
trotz einiger Abweichungen als das Florentiner Lilienwappen gedeutet.
Auch der Medicimadonna ist etwas von dem artistischen Charakter des Johannesaltars eigentümlich,
an dessen gemalte, etwas starre Portalgewändefiguren die ähnlich starren Fleiligen erinnern, die sich hier
neben und auf den Stufen des Steinpostamentes der Madonna aufgebaut haben. Die Bildaufgabe, die man
Rogier stellte, war das damals noch neue italienische Thema der Sacra Conversazione, d. h. des stillen,
rein repräsentativen Zusammenseins von stehenden Heiligen um die meist thronende — in dem Frank-
furter Bilde jedoch gleichfalls stehende — Zentralfigur der Madonna. Rogiers Bild gehört offenbar zu
den frühesten Darstellungen dieses Themas. Während die italienischen Maler steinerne Architektur, eine
1444 hatte Markgraf Leonello d’Este seinen illegitimen Sohn Francesco, dessen Porträt von Rogiers Hand
wir besitzen (Abb. 113), zur Erziehung an den Elof Philipps des Guten gesandt. Vielleicht erbat sich Leo-
nello von dem Burgunderherzog auch den damals im Norden bedeutendsten Meister aus. Gerade um die
Jahrhundertmitte nämlich versammelte der markgräfliche Hof um sich die größten Maler der Zeit. Außer
Rogier wirkten dort der frühe Piero della Francesca, der eben erst dem Knabenalter entwachsene Andrea
Mantegna und — wahrscheinlich gleichzeitig mit Rogier und wie er für das Studio von Belfiore — der in
seiner hohen Bedeutung für die italienische Kunstgeschichte noch nicht genügend gewürdigte Angelo del
Maccagnino, dessen schönstes Bild, die Allegorie des Herbstes, im Berliner Museum immer noch unter dem
nachweislich falschen Namen Francesco Cossa hängt41. Nicht nur für Ferrara hat Rogier in Italien gewirkt,
sondern wahrscheinlich auch für Florenz. Einen florentinischen Aufenthalt wird man wohl sogar noch
vor dem ferraresischen ansetzen müssen, während die Reise nach Rom vermutlich erst später, zur Feier
des Heiligen Jahres, im Winter stattfand. In Neapel ist der Meister vermutlich nicht mehr gewesen. Die
dort im Besitze König Alphons I. durch Facius bezeugten Arbeiten Rogiers waren in Flandern gekauft.
Rogier ist wohl der früheste Italienreisende unter den großen Malern nördlich der Alpen gewesen.
Der zweite oder, wenn wir auch den Franzosen Fouquet mitzählen, der dritte war Dürer, für dessen Reisen
wahrscheinlich schon das künstlerische Interesse allein ausschlaggebend gewesen sein dürfte. Ohne Zwei-
fel war der jüngere Nürnberger sehr viel aufnahmebereiter und empfänglicher für das Neue als der Brüs-
seler Stadtmaler, der bereits kurz vor der Vollendung seines fünfzigsten Lebensjahrs stand. Sonst aber
war bei beiden die Situation ziemlich ähnlich. Wenn von Rogier berichtet wird, in Rom hätten ihm Werke
des Gentile da Fabriano, also eines älteren, bereits vor mehr als zwanzig Jahren gestorbenen Meisters, be-
sonders gefallen, so entspricht dem, daß auch Dürer in Venedig den sehr alten Giovanni Bellini, als den
immer noch Besten rühmt, die jüngeren aber, Giorgione und Tizian mit keinem Worte erwähnt. Den
stärksten, zumindest den nachhaltigsten Eindruck aber hat auf beide, den Niederländer und den Deut-
schen, wohl der gleiche Meister gemacht, ein jüngerer als Gentile und älterer als Bellini: der schon 1428/29
jungverstorbene Masaccio. Auch wenn es sich nicht dokumentarisch nachweisen läßt, so machen es doch
die Werke wahrscheinlich: beiden, Rogier wie dem Dürer der zweiten Italienreise von 1505, sind die
Fresken der Florentiner Brancacci-Kapelle zu einer Offenbarung geworden42.
Zwei Bilder Rogiers, die wir noch besitzen, sind, wenn auch der Malgrund in beiden das im Norden
gewohnte Eichenholz ist, wohl sicher auf italienischem Boden gemalt: die Grablegung in den Uffizien
und die sogenannte Medicimadonna in Frankfurt (Abb. 53). Das Frankfurter Bild wurde aller Wahr-
scheinlichkeit nach in Florenz, wenigstens für florentinische Auftraggeber geschaffen. Es zeigt auf der
einen Seite der Madonna die vor allem dort verehrten Ärzteheiligen Cosmas und Damian, die auch die
Schutzheiligen der Familie Medici waren, und auf der anderen Petrus und Johannes den Täufer vielleicht
als Patrone der Söhne des Cosimo de’ Medici Piero und Giovanni. Das mittlere der unteren Wappen wird
trotz einiger Abweichungen als das Florentiner Lilienwappen gedeutet.
Auch der Medicimadonna ist etwas von dem artistischen Charakter des Johannesaltars eigentümlich,
an dessen gemalte, etwas starre Portalgewändefiguren die ähnlich starren Fleiligen erinnern, die sich hier
neben und auf den Stufen des Steinpostamentes der Madonna aufgebaut haben. Die Bildaufgabe, die man
Rogier stellte, war das damals noch neue italienische Thema der Sacra Conversazione, d. h. des stillen,
rein repräsentativen Zusammenseins von stehenden Heiligen um die meist thronende — in dem Frank-
furter Bilde jedoch gleichfalls stehende — Zentralfigur der Madonna. Rogiers Bild gehört offenbar zu
den frühesten Darstellungen dieses Themas. Während die italienischen Maler steinerne Architektur, eine