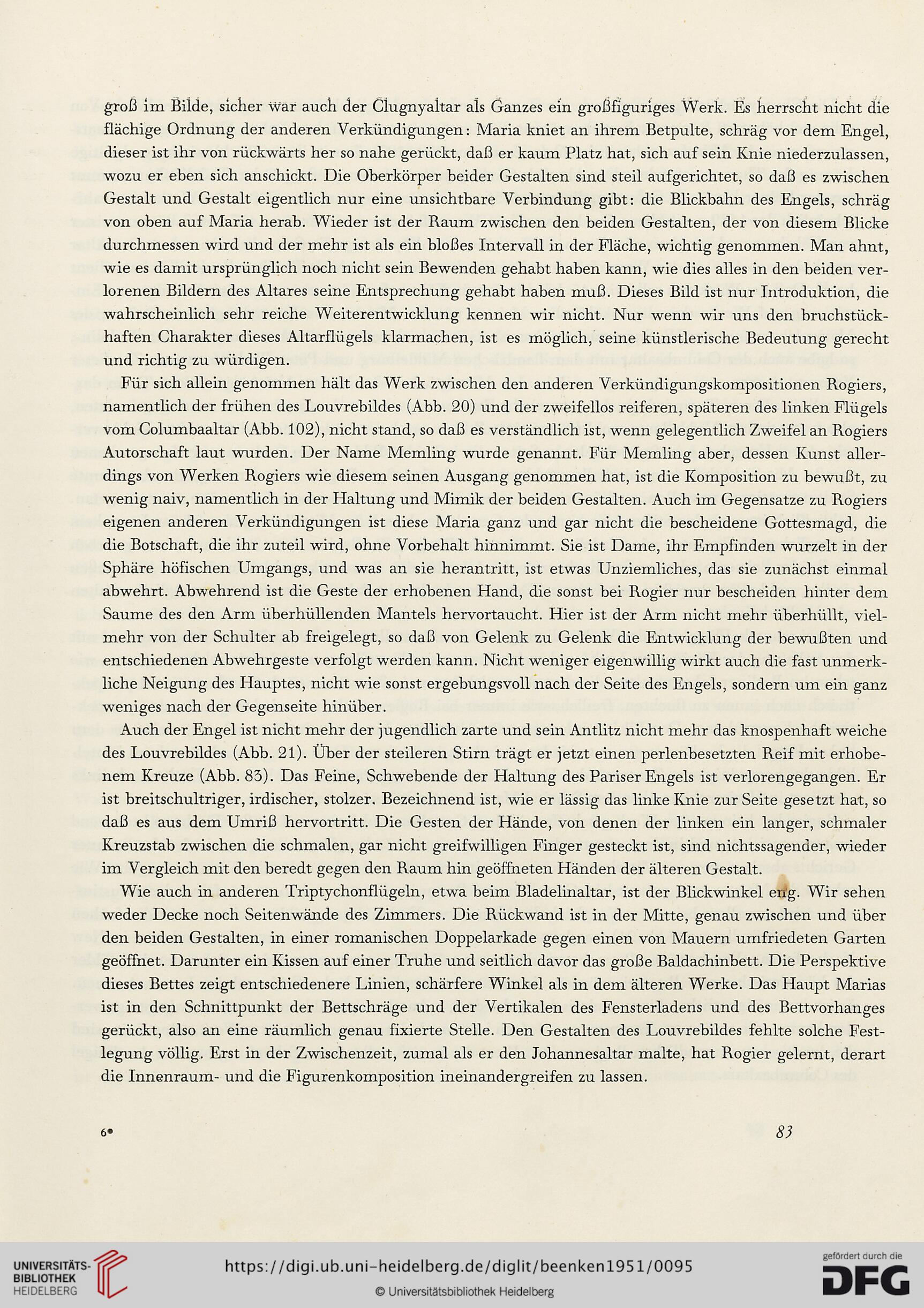groß im Bilde, sicher war auch der Clugnyaltar als Ganzes ein großfiguriges Werk. Es herrscht nicht die
flächige Ordnung der anderen Verkündigungen: Maria kniet an ihrem Betpulte, schräg vor dem Engel,
dieser ist ihr von rückwärts her so nahe gerückt, daß er kaum Platz hat, sich auf sein Knie niederzulassen,
wozu er eben sich anschickt. Die Oberkörper beider Gestalten sind steil aufgerichtet, so daß es zwischen
Gestalt und Gestalt eigentlich nur eine unsichtbare Verbindung gibt: die Blickbahn des Engels, schräg
von oben auf Maria herab. Wieder ist der Raum zwischen den beiden Gestalten, der von diesem Blicke
durchmessen wird und der mehr ist als ein bloßes Intervall in der Fläche, wichtig genommen. Man ahnt,
wie es damit ursprünglich noch nicht sein Bewenden gehabt haben kann, wie dies alles in den beiden ver-
lorenen Bildern des Altares seine Entsprechung gehabt haben muß. Dieses Bild ist nur Introduktion, die
wahrscheinlich sehr reiche Weiterentwicklung kennen wir nicht. Nur wenn wir uns den bruchstück-
haften Charakter dieses Altarflügels klarmachen, ist es möglich, seine künstlerische Bedeutung gerecht
und richtig zu würdigen.
Für sich allein genommen hält das Werk zwischen den anderen Verkündigungskompositionen Rogiers,
namentlich der frühen des Louvrebildes (Abb. 20) und der zweifellos reiferen, späteren des linken Flügels
vom Columbaaltar (Abb. 102), nicht stand, so daß es verständlich ist, wenn gelegentlich Zweifel an Rogiers
Autorschaft laut wurden. Der Name Memling wurde genannt. Für Memling aber, dessen Kunst aller-
dings von Werken Rogiers wie diesem seinen Ausgang genommen hat, ist die Komposition zu bewußt, zu
wenig naiv, namentlich in der Haltung und Mimik der beiden Gestalten. Auch im Gegensätze zu Rogiers
eigenen anderen Verkündigungen ist diese Maria ganz und gar nicht die bescheidene Gottesmagd, die
die Botschaft, die ihr zuteil wird, ohne Vorbehalt hinnimmt. Sie ist Dame, ihr Empfinden wurzelt in der
Sphäre höfischen Umgangs, und was an sie herantritt, ist etwas Unziemliches, das sie zunächst einmal
abwehrt. Abwehrend ist die Geste der erhobenen Hand, die sonst bei Rogier nur bescheiden hinter dem
Saume des den Arm überhüllenden Mantels hervortaucht. Hier ist der Arm nicht mehr überhüllt, viel-
mehr von der Schulter ab freigelegt, so daß von Gelenk zu Gelenk die Entwicklung der bewußten und
entschiedenen Abwehrgeste verfolgt werden kann. Nicht weniger eigenwillig wirkt auch die fast unmerk-
liche Neigung des Hauptes, nicht wie sonst ergebungsvoll nach der Seite des Engels, sondern um ein ganz
weniges nach der Gegenseite hinüber.
Auch der Engel ist nicht mehr der jugendlich zarte und sein Antlitz nicht mehr das knospenhaft weiche
des Louvrebildes (Abb. 21). Über der steileren Stirn trägt er jetzt einen perlenbesetzten Reif mit erhobe-
nem Kreuze (Abb. 83). Das Feine, Schwebende der Haltung des Pariser Engels ist verlorengegangen. Er
ist breitschultriger, irdischer, stolzer. Bezeichnend ist, wie er lässig das linke Knie zur Seite gesetzt hat, so
daß es aus dem Umriß hervortritt. Die Gesten der Hände, von denen der linken ein langer, schmaler
Kreuzstab zwischen die schmalen, gar nicht greifwilligen Finger gesteckt ist, sind nichtssagender, wieder
im Vergleich mit den beredt gegen den Raum hin geöffneten Händen der älteren Gestalt.
Wie auch in anderen Triptychonflügeln, etwa beim Bladelinaltar, ist der Blickwinkel eng. Wir sehen
weder Decke noch Seitenwände des Zimmers. Die Rückwand ist in der Mitte, genau zwischen und über
den beiden Gestalten, in einer romanischen Doppelarkade gegen einen von Mauern umfriedeten Garten
geöffnet. Darunter ein Kissen auf einer Truhe und seitlich davor das große Baldachinbett. Die Perspektive
dieses Bettes zeigt entschiedenere Linien, schärfere Winkel als in dem älteren Werke. Das Haupt Marias
ist in den Schnittpunkt der Bettschräge und der Vertikalen des Fensterladens und des Bettvorhanges
gerückt, also an eine räumlich genau fixierte Stelle. Den Gestalten des Louvrebildes fehlte solche Fest-
legung völlig. Erst in der Zwischenzeit, zumal als er den Johannesaltar malte, hat Rogier gelernt, derart
die Innenraum- und die Figurenkomposition ineinandergreifen zu lassen.
6*
83
flächige Ordnung der anderen Verkündigungen: Maria kniet an ihrem Betpulte, schräg vor dem Engel,
dieser ist ihr von rückwärts her so nahe gerückt, daß er kaum Platz hat, sich auf sein Knie niederzulassen,
wozu er eben sich anschickt. Die Oberkörper beider Gestalten sind steil aufgerichtet, so daß es zwischen
Gestalt und Gestalt eigentlich nur eine unsichtbare Verbindung gibt: die Blickbahn des Engels, schräg
von oben auf Maria herab. Wieder ist der Raum zwischen den beiden Gestalten, der von diesem Blicke
durchmessen wird und der mehr ist als ein bloßes Intervall in der Fläche, wichtig genommen. Man ahnt,
wie es damit ursprünglich noch nicht sein Bewenden gehabt haben kann, wie dies alles in den beiden ver-
lorenen Bildern des Altares seine Entsprechung gehabt haben muß. Dieses Bild ist nur Introduktion, die
wahrscheinlich sehr reiche Weiterentwicklung kennen wir nicht. Nur wenn wir uns den bruchstück-
haften Charakter dieses Altarflügels klarmachen, ist es möglich, seine künstlerische Bedeutung gerecht
und richtig zu würdigen.
Für sich allein genommen hält das Werk zwischen den anderen Verkündigungskompositionen Rogiers,
namentlich der frühen des Louvrebildes (Abb. 20) und der zweifellos reiferen, späteren des linken Flügels
vom Columbaaltar (Abb. 102), nicht stand, so daß es verständlich ist, wenn gelegentlich Zweifel an Rogiers
Autorschaft laut wurden. Der Name Memling wurde genannt. Für Memling aber, dessen Kunst aller-
dings von Werken Rogiers wie diesem seinen Ausgang genommen hat, ist die Komposition zu bewußt, zu
wenig naiv, namentlich in der Haltung und Mimik der beiden Gestalten. Auch im Gegensätze zu Rogiers
eigenen anderen Verkündigungen ist diese Maria ganz und gar nicht die bescheidene Gottesmagd, die
die Botschaft, die ihr zuteil wird, ohne Vorbehalt hinnimmt. Sie ist Dame, ihr Empfinden wurzelt in der
Sphäre höfischen Umgangs, und was an sie herantritt, ist etwas Unziemliches, das sie zunächst einmal
abwehrt. Abwehrend ist die Geste der erhobenen Hand, die sonst bei Rogier nur bescheiden hinter dem
Saume des den Arm überhüllenden Mantels hervortaucht. Hier ist der Arm nicht mehr überhüllt, viel-
mehr von der Schulter ab freigelegt, so daß von Gelenk zu Gelenk die Entwicklung der bewußten und
entschiedenen Abwehrgeste verfolgt werden kann. Nicht weniger eigenwillig wirkt auch die fast unmerk-
liche Neigung des Hauptes, nicht wie sonst ergebungsvoll nach der Seite des Engels, sondern um ein ganz
weniges nach der Gegenseite hinüber.
Auch der Engel ist nicht mehr der jugendlich zarte und sein Antlitz nicht mehr das knospenhaft weiche
des Louvrebildes (Abb. 21). Über der steileren Stirn trägt er jetzt einen perlenbesetzten Reif mit erhobe-
nem Kreuze (Abb. 83). Das Feine, Schwebende der Haltung des Pariser Engels ist verlorengegangen. Er
ist breitschultriger, irdischer, stolzer. Bezeichnend ist, wie er lässig das linke Knie zur Seite gesetzt hat, so
daß es aus dem Umriß hervortritt. Die Gesten der Hände, von denen der linken ein langer, schmaler
Kreuzstab zwischen die schmalen, gar nicht greifwilligen Finger gesteckt ist, sind nichtssagender, wieder
im Vergleich mit den beredt gegen den Raum hin geöffneten Händen der älteren Gestalt.
Wie auch in anderen Triptychonflügeln, etwa beim Bladelinaltar, ist der Blickwinkel eng. Wir sehen
weder Decke noch Seitenwände des Zimmers. Die Rückwand ist in der Mitte, genau zwischen und über
den beiden Gestalten, in einer romanischen Doppelarkade gegen einen von Mauern umfriedeten Garten
geöffnet. Darunter ein Kissen auf einer Truhe und seitlich davor das große Baldachinbett. Die Perspektive
dieses Bettes zeigt entschiedenere Linien, schärfere Winkel als in dem älteren Werke. Das Haupt Marias
ist in den Schnittpunkt der Bettschräge und der Vertikalen des Fensterladens und des Bettvorhanges
gerückt, also an eine räumlich genau fixierte Stelle. Den Gestalten des Louvrebildes fehlte solche Fest-
legung völlig. Erst in der Zwischenzeit, zumal als er den Johannesaltar malte, hat Rogier gelernt, derart
die Innenraum- und die Figurenkomposition ineinandergreifen zu lassen.
6*
83