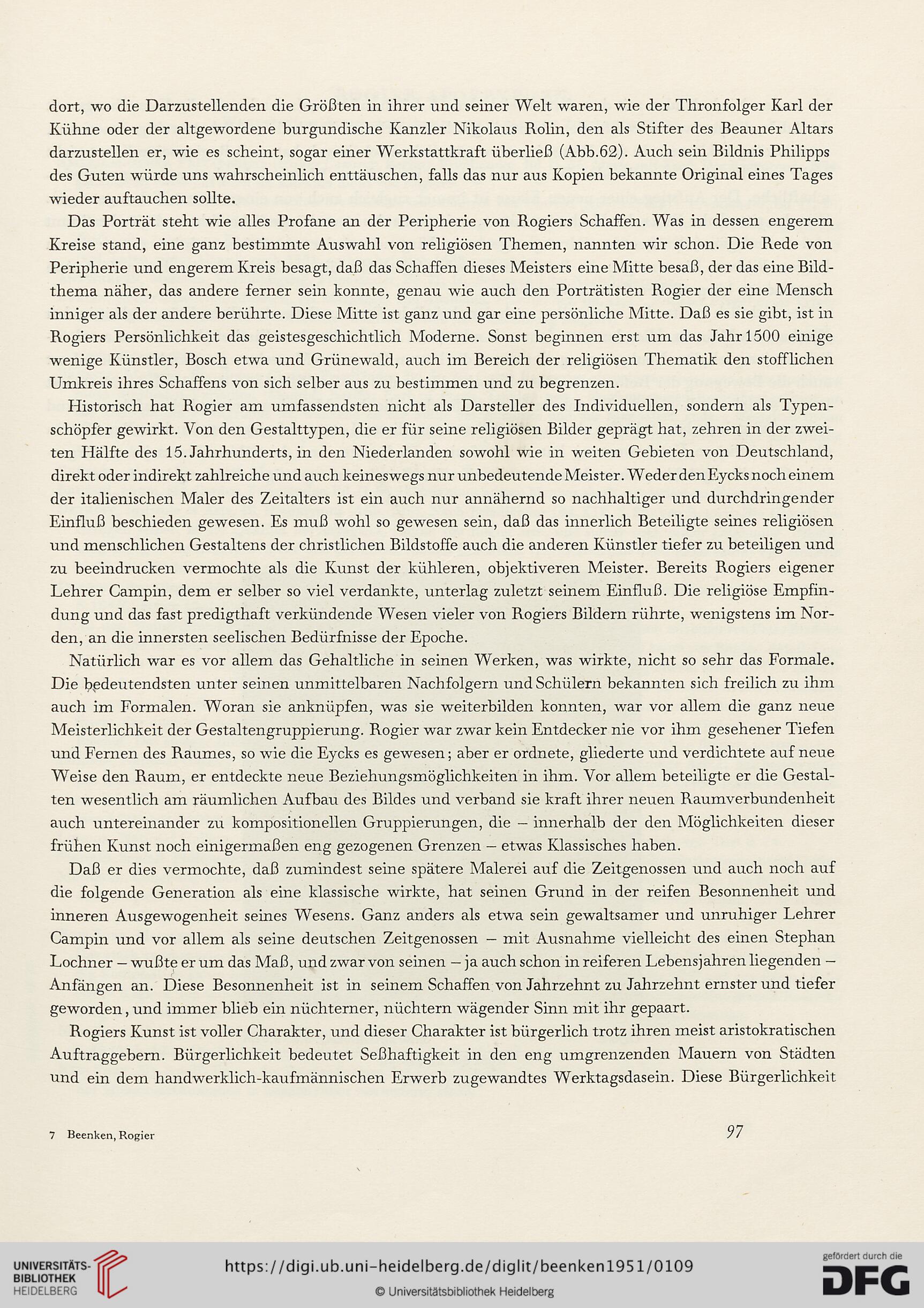dort, wo die Darzustellenden die Größten in ihrer und seiner Welt waren, wie der Thronfolger Karl der
Kühne oder der altgewordene burgundische Kanzler Nikolaus Rolin, den als Stifter des Beauner Altars
darzustellen er, wie es scheint, sogar einer Werkstattkraft überließ (Abb.62). Auch sein Bildnis Philipps
des Guten würde uns wahrscheinlich enttäuschen, falls das nur aus Kopien bekannte Original eines Tages
wieder auftauchen sollte.
Das Porträt steht wie alles Profane an der Peripherie von Rogiers Schaffen. Was in dessen engerem
Kreise stand, eine ganz bestimmte Auswahl von religiösen Themen, nannten wir schon. Die Rede von
Peripherie und engerem Kreis besagt, daß das Schaffen dieses Meisters eine Mitte besaß, der das eine Bild-
thema näher, das andere ferner sein konnte, genau wie auch den Porträtisten Rogier der eine Mensch
inniger als der andere berührte. Diese Mitte ist ganz und gar eine persönliche Mitte. Daß es sie gibt, ist in
Rogiers Persönlichkeit das geistesgeschichtlich Moderne. Sonst beginnen erst um das Jahr 1500 einige
wenige Künstler, Bosch etwa und Grünewald, auch im Bereich der religiösen Thematik den stofflichen
Umkreis ihres Schaffens von sich selber aus zu bestimmen und zu begrenzen.
Historisch hat Rogier am umfassendsten nicht als Darsteller des Individuellen, sondern als Typen-
schöpfer gewirkt. Von den Gestalttypen, die er für seine religiösen Bilder geprägt hat, zehren in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in den Niederlanden sowohl wie in weiten Gebieten von Deutschland,
direkt oder indirekt zahlreiche und auch keineswegs nur unbedeutende Meister. W eder den Eycks noch einem
der italienischen Maler des Zeitalters ist ein auch nur annähernd so nachhaltiger und durchdringender
Einfluß beschießen gewesen. Es muß wohl so gewesen sein, daß das innerlich Beteiligte seines religiösen
und menschlichen Gestaltens der christlichen Bildstoffe auch die anderen Künstler tiefer zu beteiligen und
zu beeindrucken vermochte als die Kunst der kühleren, objektiveren Meister. Bereits Rogiers eigener
Lehrer Campin, dem er selber so viel verdankte, unterlag zuletzt seinem Einfluß. Die religiöse Empfin-
dung und das fast predigthaft verkündende Wesen vieler von Rogiers Bildern rührte, wenigstens im Nor-
den, an die innersten seelischen Bedürfnisse der Epoche.
Natürlich war es vor allem das Gehaltliche in seinen Werken, was wirkte, nicht so sehr das Formale.
Die bedeutendsten unter seinen unmittelbaren Nachfolgern und Schülern bekannten sich freilich zu ihm
auch im Formalen. Woran sie anknüpfen, was sie weiterbilden konnten, war vor allem die ganz neue
Meisterlichkeit der Gestaltengruppierung. Rogier war zwar kein Entdecker nie vor ihm gesehener Tiefen
und Fernen des Raumes, so wie die Eycks es gewesen; aber er ordnete, gliederte und verdichtete auf neue
Weise den Raum, er entdeckte neue Beziehungsmöglichkeiten in ihm. Vor allem beteiligte er die Gestal-
ten wesentlich am räumlichen Aufbau des Bildes und verband sie kraft ihrer neuen Raumverbundenheit
auch untereinander zu kompositionellen Gruppierungen, die — innerhalb der den Möglichkeiten dieser
frühen Kunst noch einigermaßen eng gezogenen Grenzen — etwas Klassisches haben.
Daß er dies vermochte, daß zumindest seine spätere Malerei auf die Zeitgenossen und auch noch auf
die folgende Generation als eine klassische wirkte, hat seinen Grund in der reifen Besonnenheit und
inneren Ausgewogenheit seines Wesens. Ganz anders als etwa sein gewaltsamer und unruhiger Lehrer
Campin und vor allem als seine deutschen Zeitgenossen — mit Ausnahme vielleicht des einen Stephan
Lochner — wußte er um das Maß, und zwar von seinen — ja auch schon in reiferen Lebensjahren liegenden —
Anfängen an. Diese Besonnenheit ist in seinem Schaffen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ernster und tiefer
geworden, und immer blieb ein nüchterner, nüchtern wägender Sinn mit ihr gepaart.
Rogiers Kunst ist voller Charakter, und dieser Charakter ist bürgerlich trotz ihren meist aristokratischen
Auftraggebern. Bürgerlichkeit bedeutet Seßhaftigkeit in den eng umgrenzenden Mauern von Städten
und ein dem handwerklich-kaufmännischen Erwerb zugewandtes Werktagsdasein. Diese Bürgerlichkeit
7 Beenken, Rogier
97
Kühne oder der altgewordene burgundische Kanzler Nikolaus Rolin, den als Stifter des Beauner Altars
darzustellen er, wie es scheint, sogar einer Werkstattkraft überließ (Abb.62). Auch sein Bildnis Philipps
des Guten würde uns wahrscheinlich enttäuschen, falls das nur aus Kopien bekannte Original eines Tages
wieder auftauchen sollte.
Das Porträt steht wie alles Profane an der Peripherie von Rogiers Schaffen. Was in dessen engerem
Kreise stand, eine ganz bestimmte Auswahl von religiösen Themen, nannten wir schon. Die Rede von
Peripherie und engerem Kreis besagt, daß das Schaffen dieses Meisters eine Mitte besaß, der das eine Bild-
thema näher, das andere ferner sein konnte, genau wie auch den Porträtisten Rogier der eine Mensch
inniger als der andere berührte. Diese Mitte ist ganz und gar eine persönliche Mitte. Daß es sie gibt, ist in
Rogiers Persönlichkeit das geistesgeschichtlich Moderne. Sonst beginnen erst um das Jahr 1500 einige
wenige Künstler, Bosch etwa und Grünewald, auch im Bereich der religiösen Thematik den stofflichen
Umkreis ihres Schaffens von sich selber aus zu bestimmen und zu begrenzen.
Historisch hat Rogier am umfassendsten nicht als Darsteller des Individuellen, sondern als Typen-
schöpfer gewirkt. Von den Gestalttypen, die er für seine religiösen Bilder geprägt hat, zehren in der zwei-
ten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in den Niederlanden sowohl wie in weiten Gebieten von Deutschland,
direkt oder indirekt zahlreiche und auch keineswegs nur unbedeutende Meister. W eder den Eycks noch einem
der italienischen Maler des Zeitalters ist ein auch nur annähernd so nachhaltiger und durchdringender
Einfluß beschießen gewesen. Es muß wohl so gewesen sein, daß das innerlich Beteiligte seines religiösen
und menschlichen Gestaltens der christlichen Bildstoffe auch die anderen Künstler tiefer zu beteiligen und
zu beeindrucken vermochte als die Kunst der kühleren, objektiveren Meister. Bereits Rogiers eigener
Lehrer Campin, dem er selber so viel verdankte, unterlag zuletzt seinem Einfluß. Die religiöse Empfin-
dung und das fast predigthaft verkündende Wesen vieler von Rogiers Bildern rührte, wenigstens im Nor-
den, an die innersten seelischen Bedürfnisse der Epoche.
Natürlich war es vor allem das Gehaltliche in seinen Werken, was wirkte, nicht so sehr das Formale.
Die bedeutendsten unter seinen unmittelbaren Nachfolgern und Schülern bekannten sich freilich zu ihm
auch im Formalen. Woran sie anknüpfen, was sie weiterbilden konnten, war vor allem die ganz neue
Meisterlichkeit der Gestaltengruppierung. Rogier war zwar kein Entdecker nie vor ihm gesehener Tiefen
und Fernen des Raumes, so wie die Eycks es gewesen; aber er ordnete, gliederte und verdichtete auf neue
Weise den Raum, er entdeckte neue Beziehungsmöglichkeiten in ihm. Vor allem beteiligte er die Gestal-
ten wesentlich am räumlichen Aufbau des Bildes und verband sie kraft ihrer neuen Raumverbundenheit
auch untereinander zu kompositionellen Gruppierungen, die — innerhalb der den Möglichkeiten dieser
frühen Kunst noch einigermaßen eng gezogenen Grenzen — etwas Klassisches haben.
Daß er dies vermochte, daß zumindest seine spätere Malerei auf die Zeitgenossen und auch noch auf
die folgende Generation als eine klassische wirkte, hat seinen Grund in der reifen Besonnenheit und
inneren Ausgewogenheit seines Wesens. Ganz anders als etwa sein gewaltsamer und unruhiger Lehrer
Campin und vor allem als seine deutschen Zeitgenossen — mit Ausnahme vielleicht des einen Stephan
Lochner — wußte er um das Maß, und zwar von seinen — ja auch schon in reiferen Lebensjahren liegenden —
Anfängen an. Diese Besonnenheit ist in seinem Schaffen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ernster und tiefer
geworden, und immer blieb ein nüchterner, nüchtern wägender Sinn mit ihr gepaart.
Rogiers Kunst ist voller Charakter, und dieser Charakter ist bürgerlich trotz ihren meist aristokratischen
Auftraggebern. Bürgerlichkeit bedeutet Seßhaftigkeit in den eng umgrenzenden Mauern von Städten
und ein dem handwerklich-kaufmännischen Erwerb zugewandtes Werktagsdasein. Diese Bürgerlichkeit
7 Beenken, Rogier
97