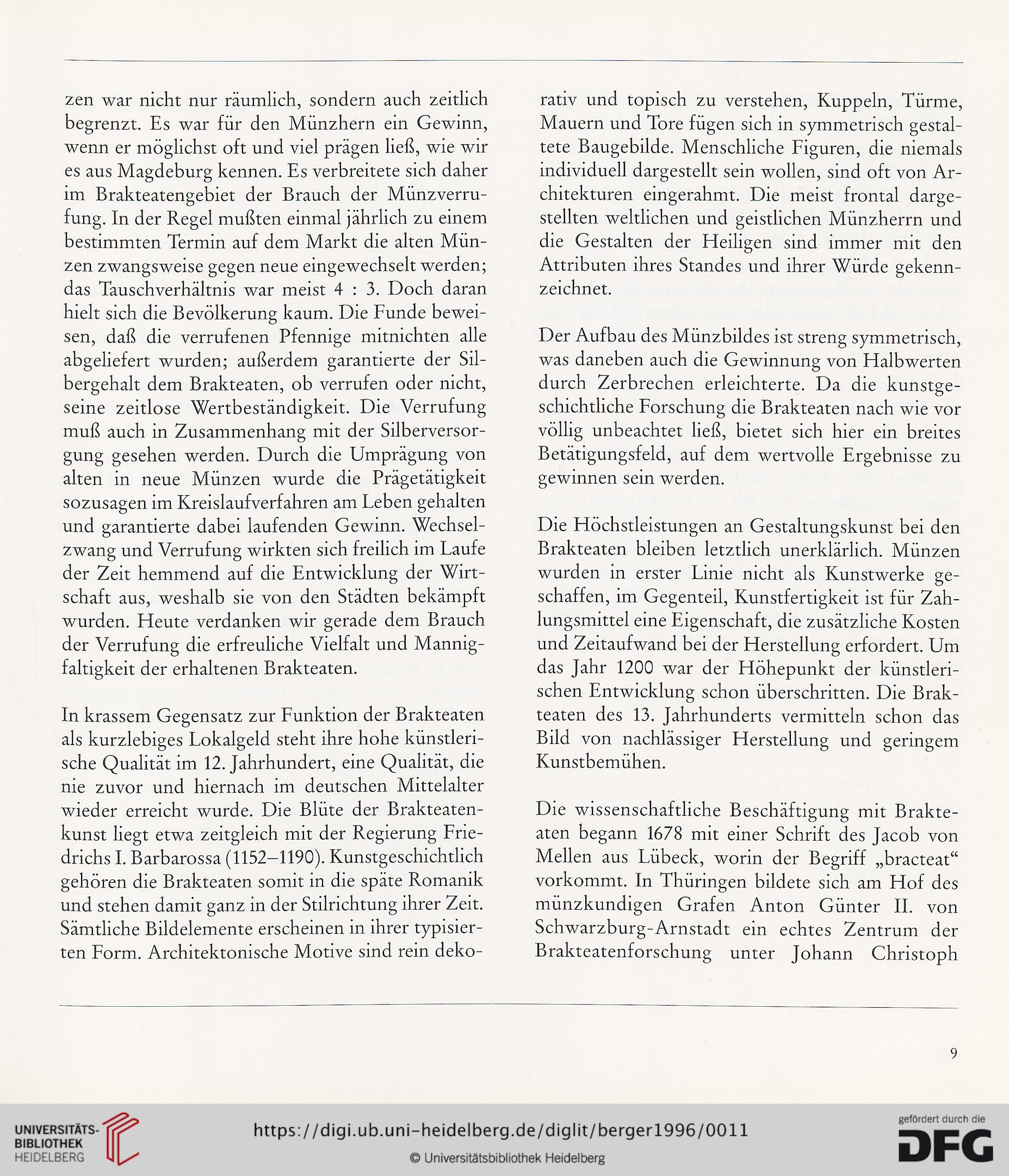zen war nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich
begrenzt. Es war für den Münzhern ein Gewinn,
wenn er möglichst oft und viel prägen ließ, wie wir
es aus Magdeburg kennen. Es verbreitete sich daher
im Brakteatengebiet der Brauch der Münzverru-
fung. In der Regel mußten einmal jährlich zu einem
bestimmten Termin auf dem Markt die alten Mün-
zen zwangsweise gegen neue eingewechselt werden;
das Tausch Verhältnis war meist 4 : 3. Doch daran
hielt sich die Bevölkerung kaum. Die Funde bewei-
sen, daß die verrufenen Pfennige mitnichten alle
abgeliefert wurden; außerdem garantierte der Sil-
bergehalt dem Brakteaten, ob verrufen oder nicht,
seine zeitlose Wertbeständigkeit. Die Verrufung
muß auch in Zusammenhang mit der Silberversor-
gung gesehen werden. Durch die Umprägung von
alten in neue Münzen wurde die Prägetätigkeit
sozusagen im Kreislaufverfahren am Leben gehalten
und garantierte dabei laufenden Gewinn. Wechsel-
zwang und Verrufung wirkten sich freilich im Laufe
der Zeit hemmend auf die Entwicklung der Wirt-
schaft aus, weshalb sie von den Städten bekämpft
wurden. Heute verdanken wir gerade dem Brauch
der Verrufung die erfreuliche Vielfalt und Mannig-
faltigkeit der erhaltenen Brakteaten.
In krassem Gegensatz zur Funktion der Brakteaten
als kurzlebiges Lokalgeld steht ihre hohe künstleri-
sche Qualität im 12. Jahrhundert, eine Qualität, die
nie zuvor und hiernach im deutschen Mittelalter
wieder erreicht wurde. Die Blüte der Brakteaten-
kunst liegt etwa zeitgleich mit der Regierung Frie-
drichs I. Barbarossa (1152-1190). Kunstgeschichtlich
gehören die Brakteaten somit in die späte Romanik
und stehen damit ganz in der Stilrichtung ihrer Zeit.
Sämtliche Bildelemente erscheinen in ihrer typisier-
ten Form. Architektonische Motive sind rein deko-
rativ und topisch zu verstehen, Kuppeln, Türme,
Mauern und Tore fügen sich in symmetrisch gestal-
tete Baugebilde. Menschliche Figuren, die niemals
individuell dargestellt sein wollen, sind oft von Ar-
chitekturen eingerahmt. Die meist frontal darge-
stellten weltlichen und geistlichen Münzherrn und
die Gestalten der Heiligen sind immer mit den
Attributen ihres Standes und ihrer Würde gekenn-
zeichnet.
Der Aufbau des Münzbildes ist streng symmetrisch,
was daneben auch die Gewinnung von Halbwerten
durch Zerbrechen erleichterte. Da die kunstge-
schichtliche Forschung die Brakteaten nach wie vor
völlig unbeachtet ließ, bietet sich hier ein breites
Betätigungsfeld, auf dem wertvolle Ergebnisse zu
gewinnen sein werden.
Die Höchstleistungen an Gestaltungskunst bei den
Brakteaten bleiben letztlich unerklärlich. Münzen
wurden in erster Linie nicht als Kunstwerke ge-
schaffen, im Gegenteil, Kunstfertigkeit ist für Zah-
lungsmittel eine Eigenschaft, die zusätzliche Kosten
und Zeitaufwand bei der Herstellung erfordert. Um
das Jahr 1200 war der Höhepunkt der künstleri-
schen Entwicklung schon überschritten. Die Brak-
teaten des 13. Jahrhunderts vermitteln schon das
Bild von nachlässiger Herstellung und geringem
Kunstbemühen.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Brakte-
aten begann 1678 mit einer Schrift des Jacob von
Mellen aus Lübeck, worin der Begriff „bracteat“
vorkommt. In Thüringen bildete sich am Hof des
münzkundigen Grafen Anton Günter II. von
Schwarzburg-Arnstadt ein echtes Zentrum der
Brakteatenforschung unter Johann Christoph
9
begrenzt. Es war für den Münzhern ein Gewinn,
wenn er möglichst oft und viel prägen ließ, wie wir
es aus Magdeburg kennen. Es verbreitete sich daher
im Brakteatengebiet der Brauch der Münzverru-
fung. In der Regel mußten einmal jährlich zu einem
bestimmten Termin auf dem Markt die alten Mün-
zen zwangsweise gegen neue eingewechselt werden;
das Tausch Verhältnis war meist 4 : 3. Doch daran
hielt sich die Bevölkerung kaum. Die Funde bewei-
sen, daß die verrufenen Pfennige mitnichten alle
abgeliefert wurden; außerdem garantierte der Sil-
bergehalt dem Brakteaten, ob verrufen oder nicht,
seine zeitlose Wertbeständigkeit. Die Verrufung
muß auch in Zusammenhang mit der Silberversor-
gung gesehen werden. Durch die Umprägung von
alten in neue Münzen wurde die Prägetätigkeit
sozusagen im Kreislaufverfahren am Leben gehalten
und garantierte dabei laufenden Gewinn. Wechsel-
zwang und Verrufung wirkten sich freilich im Laufe
der Zeit hemmend auf die Entwicklung der Wirt-
schaft aus, weshalb sie von den Städten bekämpft
wurden. Heute verdanken wir gerade dem Brauch
der Verrufung die erfreuliche Vielfalt und Mannig-
faltigkeit der erhaltenen Brakteaten.
In krassem Gegensatz zur Funktion der Brakteaten
als kurzlebiges Lokalgeld steht ihre hohe künstleri-
sche Qualität im 12. Jahrhundert, eine Qualität, die
nie zuvor und hiernach im deutschen Mittelalter
wieder erreicht wurde. Die Blüte der Brakteaten-
kunst liegt etwa zeitgleich mit der Regierung Frie-
drichs I. Barbarossa (1152-1190). Kunstgeschichtlich
gehören die Brakteaten somit in die späte Romanik
und stehen damit ganz in der Stilrichtung ihrer Zeit.
Sämtliche Bildelemente erscheinen in ihrer typisier-
ten Form. Architektonische Motive sind rein deko-
rativ und topisch zu verstehen, Kuppeln, Türme,
Mauern und Tore fügen sich in symmetrisch gestal-
tete Baugebilde. Menschliche Figuren, die niemals
individuell dargestellt sein wollen, sind oft von Ar-
chitekturen eingerahmt. Die meist frontal darge-
stellten weltlichen und geistlichen Münzherrn und
die Gestalten der Heiligen sind immer mit den
Attributen ihres Standes und ihrer Würde gekenn-
zeichnet.
Der Aufbau des Münzbildes ist streng symmetrisch,
was daneben auch die Gewinnung von Halbwerten
durch Zerbrechen erleichterte. Da die kunstge-
schichtliche Forschung die Brakteaten nach wie vor
völlig unbeachtet ließ, bietet sich hier ein breites
Betätigungsfeld, auf dem wertvolle Ergebnisse zu
gewinnen sein werden.
Die Höchstleistungen an Gestaltungskunst bei den
Brakteaten bleiben letztlich unerklärlich. Münzen
wurden in erster Linie nicht als Kunstwerke ge-
schaffen, im Gegenteil, Kunstfertigkeit ist für Zah-
lungsmittel eine Eigenschaft, die zusätzliche Kosten
und Zeitaufwand bei der Herstellung erfordert. Um
das Jahr 1200 war der Höhepunkt der künstleri-
schen Entwicklung schon überschritten. Die Brak-
teaten des 13. Jahrhunderts vermitteln schon das
Bild von nachlässiger Herstellung und geringem
Kunstbemühen.
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Brakte-
aten begann 1678 mit einer Schrift des Jacob von
Mellen aus Lübeck, worin der Begriff „bracteat“
vorkommt. In Thüringen bildete sich am Hof des
münzkundigen Grafen Anton Günter II. von
Schwarzburg-Arnstadt ein echtes Zentrum der
Brakteatenforschung unter Johann Christoph
9