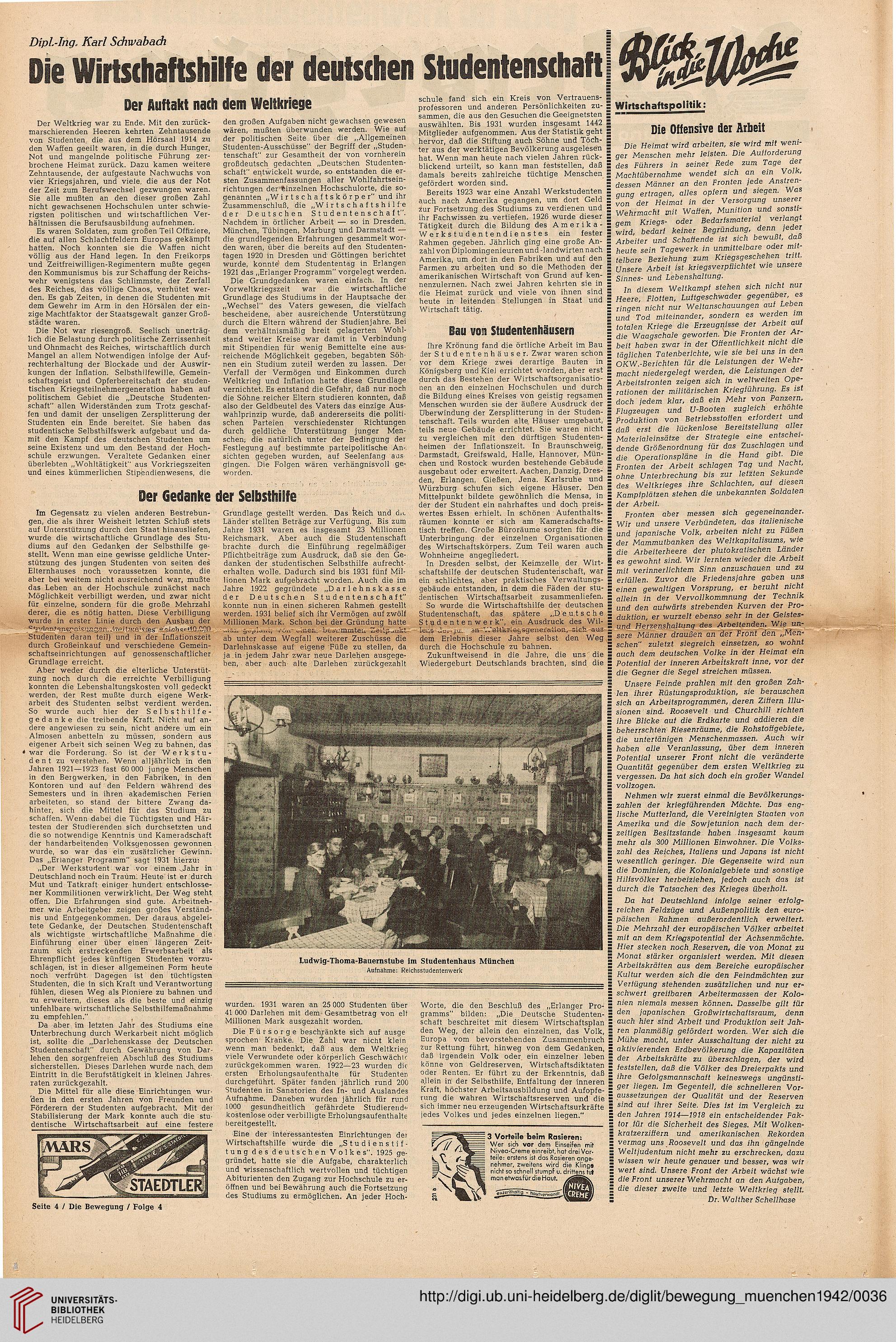Dipl-Ing. Karl Schwabach
Die Wirtschaftshilfe der deutschen Studentenschaft
Der Auftakt nach dem Weltkriege
Der Weltkrieg war zu Ende. Mit den zurück-
marschierenden Heeren kehrten Zehntausende
von Studenten, die aus dem Hörsaal 1914 zu
den Waffen geeilt waren, in die durch Hunger,
Not und mangelnde politische Führung zer-
brochene Heimat zurück. Dazu kamen weitere
Zehntausende, der aufgestaute Nachwuchs von
vier Kriegsjahren, und viele, die aus der Not
der Zeit zum Berufswechsel gezwungen waren.
Sie alle mußten an den dieser großen Zahl
nicht gewachsenen Hochschulen unter schwie-
rigsten politischen und wiitschaftlichen Ver-
hältnissen die Berufsausbildung aufnehmen.
Es waren Soldaten, zum großen Teil Offiziere,
die auf allen Schlachtfeldern Europas gekämpft
hatten. Noch konnten sie die Waffen nicht
völlig aus der Hand legen. In den Freikorps
und Zeitfreiwilligen-Regimentern mußte gegen
den Kommunismus bis zur Schaffung der Reichs-
wehr wenigstens das Schlimmste, der Zerfall
des Reiches, das völlige Chaos, verhütet wer-
den. Es gab Zeiten, in denen die Studenten mit
dem Gewehr im Arm in den Hörsälen der ein-
zige Machtfaktor der Staatsgewalt ganzer Groß-
städte waren.
Die Not war riesengroß. Seelisch unerträg-
lich die Belastung durch politische Zerrissenheit
und Ohnmacht des Reiches, wirtschaftlich durch
Mangel an allem Notwendigen infolge der Auf-
rechterhaltung der Blockade und der Auswir-
kungen der Inflation. Selbsthilfewille, Gemein-
schaftsgeist und Opferbereitschaft der studen-
tischen Kriegsteilnehmergeneration haben auf
politischem Gebiet die „Deutsche Studenten-
schaft" allen Widerständen zum Trotz geschaf-
fen und damit der unseligen Zersplitterung der
Studenten ein Ende bereitet. Sie haben das
studentische Selbsthilfswerk aufgebaut und da-
mit den Kampf des deutschen Studenten um
seine Existenz und um den Bestand der Hoch-
schule erzwungen. Veraltete Gedanken einer
überlebten „Wohltätigkeit" aus Vorkriegszeiten
und eines kümmerlichen Stipendienwesens, die
den großen Aufgaben nicht gewachsen gewesen
wären, mußten überwunden werden. Wie auf
der politischen Seite über die „Allgemeinen
Studenten-Ausschüsse" der Begriff der „Studen-
tenschaft" zur Gesamtheit der von vornherein
großdeutsch gedachten „Deutschen Studenten-
schaft" entwickelt wurde, so entstanden die er-
sten Zusammenfassungen aller Wohlfahrtsein-
richtungen der Einzelnen Hochschulorte, die so-
genannten „Wirtschaftskörper" und ihr
Zusammenschluß, die „Wirtschaftshilfe
der Deutschen Studentenschaf t".
Nachdem in örtlicher Arbeit — so in Dresden,
München, Tübingen, Marburg und Darmstadt —
die grundlegenden Erfahrungen gesammelt wor-
den waren, über die bereits auf den Studenten-
tagen 1920 in Dresden und Göttingen berichtet
wurde, konnte dem Studententag in Erlangen
1921 das „Erlanger Programm" vorgelegt werden.
Die Grundgedanken waren einfach. In der
Vorweltkriegszeit war die wirtschaftliche
Grundlage des Studiums in der Hauptsache der
„Wechsel" des Vaters gewesen, die vielfach
bescheidene, aber ausreichende Unterstützung
durch die Eltern während der Studienjahre. Bei
dem verhältnismäßig breit gelagerten Wohl-
stand weiter Kreise war damit in Verbindung
mit Stipendien für wenig Bemittelte eine aus-
reichende Möglichkeit gegeben, begabten Söh-
nen ein Studium zuteil werden zu lassen. Der
Verfall der Vermögen und Einkommen durch
Weltkrieg und Inflation hatte diese Grundlage
vernichtet. Es entstand die Gefahr, daß nur noch
die Söhne reicher Eltern studieren konnten, daß
also der Geldbeutel des Vaters das einzige Aus-
wahlprinzip wurde, daß andererseits die politi-
schen Parteien verschiedenster Richtungen
durch geldliche Unterstützung junger Men-
schen, die natürlich unter der Bedingung der
Festlegung auf bestimmte parteipolitische An-
sichten gegeben wurden, auf Seelenfang aus
gingen. Die Folgen wären verhängnisvoll ge-
worden.
Der Gedanke der Selbsthilfe
Im Gegensatz zu vielen anderen Bestrebun-
gen, die als ihrer Weisheit letzten Schluß stets
auf Unterstützung durch den Staat hinausliefen,
wurde die wirtschaftliche Grundlage des Stu-
diums auf den Gedanken der Selbsthilfe ge-
stellt. Wenn man eine gewisse geldliche Unter-
stützung des jungen Studenten von Seiten des
Elternhauses noch voraussetzen konnte, die
aber bei weitem nicht ausreichend war, mußte
das Leben an der Hochschule zunächst nach
Möglichkeit verbilligt werden, und zwar nicht
für einzelne, sondern für die große Mehrzahl
derer, die es nötig hatten. Diese Verbilligung
wurde in erster Linie durch den Ausbau der
c*3viftn.*<?n«J»ois '-Z&^JSJt. Sit3 i tIK8l$ res"" °. sich cc*1Q
Studenten daran teil) und in der Inflationszeit
durch Großeinkauf und verschiedene Gemein-
schaftseinrichtungen auf genossenschaftlicher
Grundlage erreicht.
Aber weder durch die elterliche Unterstüt-
zung noch duich die erreichte Verbilligung
konnten die Lebenshaltungskosten voll gedeckt
werden, der Rest mußte durch eigene Werk-
arbeit des Studenten selbst verdient werden.
So wurde auch hier der Selbsthilfe-
gedanke die treibende Kraft. Nicht auf an-
dere angewiesen zu sein, nicht andere um ein
Almosen anbetteln zu müssen, sondern aus
eigener Arbeit sich seinen Weg zu bahnen, das
war die Forderung. So ist der Werkstu-
dent zu verstehen. Wenn alljährlich in den
Jahren 1921 — 1923 fast 60 000 junge Menschen
in den Bergwerken, in den Fabriken, in den
Kontoren und auf den Feldern während des
Semesters und in ihren akademischen Ferien
arbeiteten, so stand der bittere Zwang da-
hinter, sich die Mittel für das Studium zu
schaffen. Wenn dabei die Tüchtigsten und Här-
testen der Studierenden sich durchsetzten und
die so notwendige Kenntnis und Kameradschaft
der handarbeitenden Volksgenossen gewonnen
wurde, so war das ein zusätzlicher Gewinn.
Das „Erlanger Programm" sagt 1931 hierzu:
„Der Werkstudent war vor einem .Jahr in
Deutschland noch ein Traum. Heute ist er durch
Mut und Tatkraft einiger hundert entschlosse-
ner Kommilitionen verwirklicht. Der Weg steht
offen. Die Erfahrungen sind gute. Arbeitneh-
mer wie Arbeitgeber zeigen großes Verständ-
nis und Entgegenkommen. Der daraus abgelei-
tete Gedanke, der Deutschen Studentenschaft
als wichtigste wirtschaftliche Maßnahme die
Einführung einer über einen längeren Zeit-
raum sich erstreckenden Erwerbsarbeit als
Ehrenpflicht jedes künftigen Studenten vorzu-
schlagen, ist in dieser allgemeinen Form heute
noch verfrüht. Dagegen ist den tüchtigsten
Studenten, die in sich Kraft und Verantwortung
fühlen, diesen Weg als Pioniere zu bahnen und
zu erweitern, dieses als die beste und einzig
unfehlbare wirtschaftliche Selbsthilfemaßnahme
zu empfehlen."
Da aber im letzten Jahr des Studiums eine
Unterbrechung durch Werkarbeit nicht möglich
ist, sollte die „Darlehenskasse der Deutschen
Studentenschaft" durch Gewährung von Dar-
lehen den sorgenfreien Abschluß des Studiums
sicherstellen. Dieses Darlehen wurde nach, dem
Eintritt in die Berufstätigkeit in kleinen Jahres-
raten zurückgezahlt.
Die Mittel für alle diese Einrichtungen wur-
'den in den ersten Jahren von Freunden und
Förderern der Studenten aufgebracht. Mit der
Stabilisierung der Mark konnte auch die stu-
dentische Wirtschaftsarbeit auf eine festere
Grundlage gestellt werden. Das feeich und dn-
Länder stellten Beträge zur Verfügung. Bis zum
Jahre 1931 waren es insgesamt 23 Millionen
Reichsmark. Aber auch die Studentenschaft
brachte durch die Einführung regelmäßiger
Pflichtbeiträge zum Ausdruck, daß sie den Ge-
danken der studentischen Selbsthilfe aufrecht-
erhalten wolle. Dadurch sind bis 1931 fünf Mil-
lionen Mark aufgebracht worden. Auch die im
Jahre 1922 gegründete „Darlehnskasse
der Deutschen Studentenschaft"
konnte nun in einen sicheren Rahmen gestellt
werden. 1931 belief sich ihr Vermögen auf zwölf
Millionen Mark. Schon bei der Gründung hatte
..i-:- y^iMx,;., /Oh- v*ineix.. bCcL.'mmtei* Zeitpunkt
ab unter dem Wegfall weiterer Zuschüsse die
Darlehnskasse auf eigene Füße zu stellen, da
ja in jedem Jahr zwar neue Darlehen ausgege-
ben, aber auch alte Darlehen zurückgezahlt
schule fand sich ein Kreis von Vertrauens-
professoren und anderen Persönlichkeiten zu-
sammen, die aus den Gesuchen die Geeignetsten
auswählten. Bis 1931 wurden insgesamt 1442
Mitglieder aufgenommen. Aus der Statistik geht
hervor, daß die Stiftung auch Söhne und Töch-
ter aus der werktätigen Bevölkerung ausgelesen
hat. Wenn man heute nach vielen Jahren rück-
blickend urteilt, so kann man feststellen, daß
damals bereits zahlreiche tüchtige Menschen
gefördert worden sind.
Bereits 1923 war eine Anzahl Werkstudenten
auch nach Amerika gegangen, um dort Geld
zur Fortsetzung des Studiums zu verdienen und
ihr Fachwissen zu vertiefen. 1926 wurde dieser
Tätigkeit durch die Bildung des Amerika-
Werkstudentendienstes ein fester
Rahmen gegeben. Jährlich ging eine große An-
zahl von Diplomingenieuren und -landwirten nach
Amerika, um dort in den Fabriken und auf den
Farmen zu arbeiten und so die Methoden der
amerikanischen Wirtschaft von Grund auf ken-
nenzulernen. Nach zwei Jahren kehrten sie in
die Heimat zurück und viele von ihnen sind
heute in leitenden Stellungen in Staat und
Wirtschaft tätig.
Bau von Studentenhäusern
Ihre Krönung fand die örtliche Arbeit im Bau
der Studentenhäuser. Zwar waren schon
vor dem Kriege zwei derartige Bauten in
Königsberg und Kiel errichtet worden, aber erst
durch das Bestehen der Wirtschaftsorganisatio-
nen an den einzelnen Hochschulen und durch
die Bildung eines Kreises von geistig regsamen
Menschen wurden sie der äußere Ausdruck der
Überwindung der Zersplitterung in der Studen-
tenschaft. Teils wurden alte Häuser umgebaut,
teils neue Gebäude errichtet. Sie waren nicht
zu vergleichen mit den dürftigen Studenten-
heimen der Inflationszeit. In Braunschweig,
Darmstadt, Greifswald, Halle, Hannover, Mün-
chen und Rostock wurden bestehende Gebäude
ausgebaut oder erweitert. Aachen, Danzig, Dres-
den, Erlangen, Gießen, Jena. Karlsruhe und
Würzburg schufen sich eigene Häuser. Den
Mittelpunkt bildete gewöhnlich die Mensa, in
der der Student ein nahrhaftes und doch preis-
wertes Essen erhielt. In schönen Aufenthalts-
räumen konnte er sich am Kameradschafts-
tisch treffen. Große Büroräume sorgten für die
Unterbringung der einzelnen Organisationen
des Wirtschaftskörpers. Zum Teil waren auch
Wohnheime angegliedert.
In Dresden selbst, der Keimzelle der Wirt-
schaftshilfe der deutschen Studentenschaft, war
ein schlichtes, aber praktisches Verwaltungs-
gebäude entstanden, in dem die Fäden der stu-
dentischen Wirtschaftsarbeit zusammenliefen.
So wurde die Wirtschaftshilfe der deutschen
Studentenschaft, das spätere „Deutsche
Studentenwer k", ein Ausdruck des Wil-
lems Jiji.ja. m Y."eHkriec,sgeiiei'ation, sich aus
dem Erlebnis dieser Jahre selbst den Weg
durch die Hochschule zu bahnen.
Zukunftweisend in die Jahre, die uns die
Wiedergeburt Deutschlands brachten, sind die
Wirtschaftspolitik
Ludwig-Thoma-Bauernstube im Studentenhaus München
Aufnahme: Reichsstudentenwerk
Seite 4 / Die Bewegung / Folge 4
wurden. 1931 waren an 25 000 Studenten über
41 000 Darlehen mit dem Gesamtbetrag von elf
Millionen Mark ausgezahlt worden.
Die Fürsorge beschränkte sich auf ausge
sprochen Kranke. Die Zahl war nicht klein
wenn man bedenkt, daß aus dem Weltkrieg
viele Verwundete oder körperlich Geschwächt
zurückgekommen waren. 1922—23 wurden die
ersten Erholungsaufenthalte für Studenten
durchgeführt. Später fanden jährlich rund 200
Studenten in Sanatorien des In- und Auslandes
Aufnahme. Daneben wurden jährlich für rund
1000 gesundheitlich gefährdete Studierend^
kostenlose oder verbilligte Erholungsaufenthalte
bereitgestellt.
Eine der interessantesten Einrichtungen dei
Wirtschaftshilfe wurde die „S t u d i e n s t i f -
tung des deutschen Volke s". 1925 ge-
gründet, hatte sie die Aufgabe, charakterlich
und wissenschaftlich wertvollen und tüchtigen
Abiturienten den Zugang zur Hochschule zu er-
öffnen und bei Bewährung auch die Fortsetzung
des Studiums zu ermöglichen. An jeder Hoch-
Worte, die den Beschluß des „Erlanger Pro-
gramms" bilden: „Die Deutsche Studenten-
schaft beschreitet mit diesem Wirtschaftsplan
den Weg, der allein den einzelnen, das Volk,
Europa vom bevorstehenden Zusammenbruch
zur Rettung führt, hinweg von dem Gedanken,
daß irgendein Volk oder ein einzelner leben
könne von Geldreserven, Wirtschaftsdiktaten
oder Renten. Er führt zu der Erkenntnis, daß
allein in der Selbsthilfe, Entfaltung der inneren
Kraft, höchster Arbeitsausbildung und Aufopfe-
rung die wahren Wirtschaftsreserven und die
sich immer neu erzeugenden Wirtschaftsurkräfte
jedes Volkes und jedes einzelnen liegen."
3 Vorteile beim Rasieren:
Wer sich vor dem Einseifen mit
Nivea-Creme einreibt, hat drei Vor-
teile: erstens ist das Rasieren ange-
nehmer, zweitens wird die Kling»
nicht so schnell stumpf u. drittens tut
man etwasfür die Haut.
Die Offensive der Arbeit
Die Heimat wird arbeiten, sie wird mit weni-
S ger Menschen mehr leisten. Die Auitorderung
E des Führers in seiner Rede zum Tage der
E Machtübernahme wendet sich an ein Volk,
S dessen Männer an den Fronten jede Anstren-
E gung ertragen, alles opfern und siegen. Was
E von der Heimat in der Versorgung unserer
E Wehrmacht mit Watten, Munition und sonsti-
S gern Kriegs- oder Bedarismaterial verlangt
E wird, bedarf keiner Begründung, denn jeder
E Arbeiter und Schaffende ist sich bewußt, daß
E heute sein Tagewerk in unmittelbare oder mit-
E felbare Beziehung zum Kriegsgeschehen tritt.
E Unsere Arbeit ist kriegsverpflichtet wie unsere
E Sinnes- und Lebenshaltung.
S In diesem Weltkampf stehen sich nicht nur
E Heere, Flotten, Luitgeschwader gegenüber, es
E ringen nicht nur Weltanschauungen aul Leben
§ und Tod miteinander, sondern es werden im
E totalen Kriege die Erzeugnisse der Arbeit auf
E die Waagschale geworfen. Die Fronten der Ar-
S heil haben zwar in der Öffentlichkeit nicht die
E täglichen Tatenberichte, wie sie bei uns in den
E OKW'.-Berichten iür die Leistungen der Wehr-
E macht niedergelegt werden, die Leistungen der
S Arbeitslronten zeigen sich in weltweiten Ope-
S iationen der militärischen Krieglührung. Es ist
= doch jedem klar, daß ein Mehr von Panzern,
E Flugzeugen und U-Booten zugleich erhöhte
S Produktion von Betriebsstoffen erfordert und
E daß erst die lückenlose Bereitstellung aller
S Materialeinsätze der Strategie eine entschel-
S dende Größenordnung iür das Zuschlagen und
E die Operationspläne in die Hand gibt. Die
S Fronten der Arbeit schlagen Tag und Nacht,
S ohne Unterbrechung bis zur letzten Sekunde
S des Weltkrieges ihre Schlachten, aul diesen
S Kampiplätzen stehen die unbekannten Soldaten
Z der Arbeit.
E Fronten aber messen sich gegeneinander.
E Wir und unsere Verbündeten, das italienische
S und japanische Volk, arbeiten nicht zu Füßen
E der Mammutbanken des Weltkapitalisums, wie
E die Arbeiterheere der plutokratischen Länder
5 es gewohnt sind. Wir lernten wieder die Arbeit
S mit verinnerlichtem Sinn anzuschauen und zu
E erlüllen. Zuvor die Friedensjahre gaben uns
S einen gewaltigen Vorsprung, er beruht nicht
S allein in der Vervollkommnung der Technik
S und den aufwärts strebenden Kurven der Pro-
S duktion, er wurzelt ebenso sehr In der Geistes-
E und Herzenshaltunq des Arbeitenden. Wie un-
S sere Männer draußen an der Front den „Men-
E sehen" zuletzt siegreich einsetzen, so wohnt
E auch dem deutschen Volke in der Heimat ein
2 Potential der Inneren Arbeltskraft inne, vor der
E die Gegner die Segel streichen müssen.
S Unsere Feinde prahlen mit den großen Zah-
E len ihrer Rüstungsproduktion, sie berauschen
E sich an Arbeitsprogrammen, deren Zittern lllu-
E sionen sind. Roosevelt und Churchill richten
E ihre Blicke aul die Erdkarte und addieren die
E beherrschten Riesenräume, die Rohstofigebiete,
E die untertänigen Menschenmassen. Auch wir
E haben alle Veranlassung, über dem inneren
S Potential unserer Front nicht die veränderte
E Quantität gegenüber dem ersten Weltkrieg zu
S vergessen. Da hat sich doch ein großer Wandel
5 vollzogen.
■ Nehmen wir zuerst einmal die Bevölkerungs-
£ zahlen der kriegführenden Mächte. Das eng-
E lische Mutterland, die Vereinigten Staaten von
E Amerika und die Sowjetunion nach dem der-
S zeitigen Besitzstande haben insgesamt kaum
E mehr als 300 Millionen Einwohner. Die Volks-
» zahl des Reiches, Italiens und Japans Ist nicht
E wesentlich geringer. Die Gegenseite wird nun
E die Dominien, die Kolonialgebiete und sonstige
5 Hilfsvölker herbeiziehen, jedoch auch das ist
E durch die Tatsachen des Krieges überholt.
5 Da hat Deutschland inlolge seiner erfolg-
B reichen Feldzüge und Außenpolitik den euro-
Z päischen Rahmen außerordentlich erweitert.
Z Die Mehrzahl der europäischen Völker arbeitet
Z mit an dem Kriegspotential der Achsenmächte.
Z Hier stecken noch Reserven, die von Monat zu
Z Monat stärker organisiert werden. Mit diesen
Z Arbeltskrätten aus dem Bereiche europäischer
Z Kultur werden sich die den Feindmächten zur
Z Vertügung stehenden zusätzlichen und nur er-
Z schwert greilbaren Arbeitermassen der Kolo-
Z nien niemals messen können. Dasselbe gilt lür
Z den japanischen Großwirtschaitsraum, denn
Z auch hier sind Arbeit und Produktion seit Jah-
5 ren planmäßig gefördert worden. Wer steh die
Z Mühe macht, unter Ausschaltung der nicht zu
Z aktivierenden Erdbevölkerung die Kapazitäten
S der Arbeitskrälte zu überschlagen, der wird
S ieststellen, daß die Völker des Dreierpakts und
S ihre Getolgsmannschalt keineswegs ungünsti-
| ger liegen. Im Gegenteil, die schnelleren Vor-
3 aussetzungen der Qualität und der Reserven
E sind aul ihrer Seite. Dies ist im Vergleich zu
£ den Jahren 1914—1918 ein entscheidender Fak-
E tor tür die Sicherheit des Sieges. Mit Wolken-
Z kratzerzitiern und amerikanischen Rekorden
£ vermag uns Roosevelt und das ihn gängelnde
£ 'Weltjudentum nicht mehr zu erschrecken, dazu
Z wissen wir heute genauer und besser, was wir
S wert sind. Unsere Front der Arbeit wächst wie
£ die Front unserer Wehrmacht an den Autgaben,
| die dieser zweite und letzte Weltkrieg stellt.
Z Dr. Walther Schellhase
Die Wirtschaftshilfe der deutschen Studentenschaft
Der Auftakt nach dem Weltkriege
Der Weltkrieg war zu Ende. Mit den zurück-
marschierenden Heeren kehrten Zehntausende
von Studenten, die aus dem Hörsaal 1914 zu
den Waffen geeilt waren, in die durch Hunger,
Not und mangelnde politische Führung zer-
brochene Heimat zurück. Dazu kamen weitere
Zehntausende, der aufgestaute Nachwuchs von
vier Kriegsjahren, und viele, die aus der Not
der Zeit zum Berufswechsel gezwungen waren.
Sie alle mußten an den dieser großen Zahl
nicht gewachsenen Hochschulen unter schwie-
rigsten politischen und wiitschaftlichen Ver-
hältnissen die Berufsausbildung aufnehmen.
Es waren Soldaten, zum großen Teil Offiziere,
die auf allen Schlachtfeldern Europas gekämpft
hatten. Noch konnten sie die Waffen nicht
völlig aus der Hand legen. In den Freikorps
und Zeitfreiwilligen-Regimentern mußte gegen
den Kommunismus bis zur Schaffung der Reichs-
wehr wenigstens das Schlimmste, der Zerfall
des Reiches, das völlige Chaos, verhütet wer-
den. Es gab Zeiten, in denen die Studenten mit
dem Gewehr im Arm in den Hörsälen der ein-
zige Machtfaktor der Staatsgewalt ganzer Groß-
städte waren.
Die Not war riesengroß. Seelisch unerträg-
lich die Belastung durch politische Zerrissenheit
und Ohnmacht des Reiches, wirtschaftlich durch
Mangel an allem Notwendigen infolge der Auf-
rechterhaltung der Blockade und der Auswir-
kungen der Inflation. Selbsthilfewille, Gemein-
schaftsgeist und Opferbereitschaft der studen-
tischen Kriegsteilnehmergeneration haben auf
politischem Gebiet die „Deutsche Studenten-
schaft" allen Widerständen zum Trotz geschaf-
fen und damit der unseligen Zersplitterung der
Studenten ein Ende bereitet. Sie haben das
studentische Selbsthilfswerk aufgebaut und da-
mit den Kampf des deutschen Studenten um
seine Existenz und um den Bestand der Hoch-
schule erzwungen. Veraltete Gedanken einer
überlebten „Wohltätigkeit" aus Vorkriegszeiten
und eines kümmerlichen Stipendienwesens, die
den großen Aufgaben nicht gewachsen gewesen
wären, mußten überwunden werden. Wie auf
der politischen Seite über die „Allgemeinen
Studenten-Ausschüsse" der Begriff der „Studen-
tenschaft" zur Gesamtheit der von vornherein
großdeutsch gedachten „Deutschen Studenten-
schaft" entwickelt wurde, so entstanden die er-
sten Zusammenfassungen aller Wohlfahrtsein-
richtungen der Einzelnen Hochschulorte, die so-
genannten „Wirtschaftskörper" und ihr
Zusammenschluß, die „Wirtschaftshilfe
der Deutschen Studentenschaf t".
Nachdem in örtlicher Arbeit — so in Dresden,
München, Tübingen, Marburg und Darmstadt —
die grundlegenden Erfahrungen gesammelt wor-
den waren, über die bereits auf den Studenten-
tagen 1920 in Dresden und Göttingen berichtet
wurde, konnte dem Studententag in Erlangen
1921 das „Erlanger Programm" vorgelegt werden.
Die Grundgedanken waren einfach. In der
Vorweltkriegszeit war die wirtschaftliche
Grundlage des Studiums in der Hauptsache der
„Wechsel" des Vaters gewesen, die vielfach
bescheidene, aber ausreichende Unterstützung
durch die Eltern während der Studienjahre. Bei
dem verhältnismäßig breit gelagerten Wohl-
stand weiter Kreise war damit in Verbindung
mit Stipendien für wenig Bemittelte eine aus-
reichende Möglichkeit gegeben, begabten Söh-
nen ein Studium zuteil werden zu lassen. Der
Verfall der Vermögen und Einkommen durch
Weltkrieg und Inflation hatte diese Grundlage
vernichtet. Es entstand die Gefahr, daß nur noch
die Söhne reicher Eltern studieren konnten, daß
also der Geldbeutel des Vaters das einzige Aus-
wahlprinzip wurde, daß andererseits die politi-
schen Parteien verschiedenster Richtungen
durch geldliche Unterstützung junger Men-
schen, die natürlich unter der Bedingung der
Festlegung auf bestimmte parteipolitische An-
sichten gegeben wurden, auf Seelenfang aus
gingen. Die Folgen wären verhängnisvoll ge-
worden.
Der Gedanke der Selbsthilfe
Im Gegensatz zu vielen anderen Bestrebun-
gen, die als ihrer Weisheit letzten Schluß stets
auf Unterstützung durch den Staat hinausliefen,
wurde die wirtschaftliche Grundlage des Stu-
diums auf den Gedanken der Selbsthilfe ge-
stellt. Wenn man eine gewisse geldliche Unter-
stützung des jungen Studenten von Seiten des
Elternhauses noch voraussetzen konnte, die
aber bei weitem nicht ausreichend war, mußte
das Leben an der Hochschule zunächst nach
Möglichkeit verbilligt werden, und zwar nicht
für einzelne, sondern für die große Mehrzahl
derer, die es nötig hatten. Diese Verbilligung
wurde in erster Linie durch den Ausbau der
c*3viftn.*<?n«J»ois '-Z&^JSJt. Sit3 i tIK8l$ res"" °. sich cc*1Q
Studenten daran teil) und in der Inflationszeit
durch Großeinkauf und verschiedene Gemein-
schaftseinrichtungen auf genossenschaftlicher
Grundlage erreicht.
Aber weder durch die elterliche Unterstüt-
zung noch duich die erreichte Verbilligung
konnten die Lebenshaltungskosten voll gedeckt
werden, der Rest mußte durch eigene Werk-
arbeit des Studenten selbst verdient werden.
So wurde auch hier der Selbsthilfe-
gedanke die treibende Kraft. Nicht auf an-
dere angewiesen zu sein, nicht andere um ein
Almosen anbetteln zu müssen, sondern aus
eigener Arbeit sich seinen Weg zu bahnen, das
war die Forderung. So ist der Werkstu-
dent zu verstehen. Wenn alljährlich in den
Jahren 1921 — 1923 fast 60 000 junge Menschen
in den Bergwerken, in den Fabriken, in den
Kontoren und auf den Feldern während des
Semesters und in ihren akademischen Ferien
arbeiteten, so stand der bittere Zwang da-
hinter, sich die Mittel für das Studium zu
schaffen. Wenn dabei die Tüchtigsten und Här-
testen der Studierenden sich durchsetzten und
die so notwendige Kenntnis und Kameradschaft
der handarbeitenden Volksgenossen gewonnen
wurde, so war das ein zusätzlicher Gewinn.
Das „Erlanger Programm" sagt 1931 hierzu:
„Der Werkstudent war vor einem .Jahr in
Deutschland noch ein Traum. Heute ist er durch
Mut und Tatkraft einiger hundert entschlosse-
ner Kommilitionen verwirklicht. Der Weg steht
offen. Die Erfahrungen sind gute. Arbeitneh-
mer wie Arbeitgeber zeigen großes Verständ-
nis und Entgegenkommen. Der daraus abgelei-
tete Gedanke, der Deutschen Studentenschaft
als wichtigste wirtschaftliche Maßnahme die
Einführung einer über einen längeren Zeit-
raum sich erstreckenden Erwerbsarbeit als
Ehrenpflicht jedes künftigen Studenten vorzu-
schlagen, ist in dieser allgemeinen Form heute
noch verfrüht. Dagegen ist den tüchtigsten
Studenten, die in sich Kraft und Verantwortung
fühlen, diesen Weg als Pioniere zu bahnen und
zu erweitern, dieses als die beste und einzig
unfehlbare wirtschaftliche Selbsthilfemaßnahme
zu empfehlen."
Da aber im letzten Jahr des Studiums eine
Unterbrechung durch Werkarbeit nicht möglich
ist, sollte die „Darlehenskasse der Deutschen
Studentenschaft" durch Gewährung von Dar-
lehen den sorgenfreien Abschluß des Studiums
sicherstellen. Dieses Darlehen wurde nach, dem
Eintritt in die Berufstätigkeit in kleinen Jahres-
raten zurückgezahlt.
Die Mittel für alle diese Einrichtungen wur-
'den in den ersten Jahren von Freunden und
Förderern der Studenten aufgebracht. Mit der
Stabilisierung der Mark konnte auch die stu-
dentische Wirtschaftsarbeit auf eine festere
Grundlage gestellt werden. Das feeich und dn-
Länder stellten Beträge zur Verfügung. Bis zum
Jahre 1931 waren es insgesamt 23 Millionen
Reichsmark. Aber auch die Studentenschaft
brachte durch die Einführung regelmäßiger
Pflichtbeiträge zum Ausdruck, daß sie den Ge-
danken der studentischen Selbsthilfe aufrecht-
erhalten wolle. Dadurch sind bis 1931 fünf Mil-
lionen Mark aufgebracht worden. Auch die im
Jahre 1922 gegründete „Darlehnskasse
der Deutschen Studentenschaft"
konnte nun in einen sicheren Rahmen gestellt
werden. 1931 belief sich ihr Vermögen auf zwölf
Millionen Mark. Schon bei der Gründung hatte
..i-:- y^iMx,;., /Oh- v*ineix.. bCcL.'mmtei* Zeitpunkt
ab unter dem Wegfall weiterer Zuschüsse die
Darlehnskasse auf eigene Füße zu stellen, da
ja in jedem Jahr zwar neue Darlehen ausgege-
ben, aber auch alte Darlehen zurückgezahlt
schule fand sich ein Kreis von Vertrauens-
professoren und anderen Persönlichkeiten zu-
sammen, die aus den Gesuchen die Geeignetsten
auswählten. Bis 1931 wurden insgesamt 1442
Mitglieder aufgenommen. Aus der Statistik geht
hervor, daß die Stiftung auch Söhne und Töch-
ter aus der werktätigen Bevölkerung ausgelesen
hat. Wenn man heute nach vielen Jahren rück-
blickend urteilt, so kann man feststellen, daß
damals bereits zahlreiche tüchtige Menschen
gefördert worden sind.
Bereits 1923 war eine Anzahl Werkstudenten
auch nach Amerika gegangen, um dort Geld
zur Fortsetzung des Studiums zu verdienen und
ihr Fachwissen zu vertiefen. 1926 wurde dieser
Tätigkeit durch die Bildung des Amerika-
Werkstudentendienstes ein fester
Rahmen gegeben. Jährlich ging eine große An-
zahl von Diplomingenieuren und -landwirten nach
Amerika, um dort in den Fabriken und auf den
Farmen zu arbeiten und so die Methoden der
amerikanischen Wirtschaft von Grund auf ken-
nenzulernen. Nach zwei Jahren kehrten sie in
die Heimat zurück und viele von ihnen sind
heute in leitenden Stellungen in Staat und
Wirtschaft tätig.
Bau von Studentenhäusern
Ihre Krönung fand die örtliche Arbeit im Bau
der Studentenhäuser. Zwar waren schon
vor dem Kriege zwei derartige Bauten in
Königsberg und Kiel errichtet worden, aber erst
durch das Bestehen der Wirtschaftsorganisatio-
nen an den einzelnen Hochschulen und durch
die Bildung eines Kreises von geistig regsamen
Menschen wurden sie der äußere Ausdruck der
Überwindung der Zersplitterung in der Studen-
tenschaft. Teils wurden alte Häuser umgebaut,
teils neue Gebäude errichtet. Sie waren nicht
zu vergleichen mit den dürftigen Studenten-
heimen der Inflationszeit. In Braunschweig,
Darmstadt, Greifswald, Halle, Hannover, Mün-
chen und Rostock wurden bestehende Gebäude
ausgebaut oder erweitert. Aachen, Danzig, Dres-
den, Erlangen, Gießen, Jena. Karlsruhe und
Würzburg schufen sich eigene Häuser. Den
Mittelpunkt bildete gewöhnlich die Mensa, in
der der Student ein nahrhaftes und doch preis-
wertes Essen erhielt. In schönen Aufenthalts-
räumen konnte er sich am Kameradschafts-
tisch treffen. Große Büroräume sorgten für die
Unterbringung der einzelnen Organisationen
des Wirtschaftskörpers. Zum Teil waren auch
Wohnheime angegliedert.
In Dresden selbst, der Keimzelle der Wirt-
schaftshilfe der deutschen Studentenschaft, war
ein schlichtes, aber praktisches Verwaltungs-
gebäude entstanden, in dem die Fäden der stu-
dentischen Wirtschaftsarbeit zusammenliefen.
So wurde die Wirtschaftshilfe der deutschen
Studentenschaft, das spätere „Deutsche
Studentenwer k", ein Ausdruck des Wil-
lems Jiji.ja. m Y."eHkriec,sgeiiei'ation, sich aus
dem Erlebnis dieser Jahre selbst den Weg
durch die Hochschule zu bahnen.
Zukunftweisend in die Jahre, die uns die
Wiedergeburt Deutschlands brachten, sind die
Wirtschaftspolitik
Ludwig-Thoma-Bauernstube im Studentenhaus München
Aufnahme: Reichsstudentenwerk
Seite 4 / Die Bewegung / Folge 4
wurden. 1931 waren an 25 000 Studenten über
41 000 Darlehen mit dem Gesamtbetrag von elf
Millionen Mark ausgezahlt worden.
Die Fürsorge beschränkte sich auf ausge
sprochen Kranke. Die Zahl war nicht klein
wenn man bedenkt, daß aus dem Weltkrieg
viele Verwundete oder körperlich Geschwächt
zurückgekommen waren. 1922—23 wurden die
ersten Erholungsaufenthalte für Studenten
durchgeführt. Später fanden jährlich rund 200
Studenten in Sanatorien des In- und Auslandes
Aufnahme. Daneben wurden jährlich für rund
1000 gesundheitlich gefährdete Studierend^
kostenlose oder verbilligte Erholungsaufenthalte
bereitgestellt.
Eine der interessantesten Einrichtungen dei
Wirtschaftshilfe wurde die „S t u d i e n s t i f -
tung des deutschen Volke s". 1925 ge-
gründet, hatte sie die Aufgabe, charakterlich
und wissenschaftlich wertvollen und tüchtigen
Abiturienten den Zugang zur Hochschule zu er-
öffnen und bei Bewährung auch die Fortsetzung
des Studiums zu ermöglichen. An jeder Hoch-
Worte, die den Beschluß des „Erlanger Pro-
gramms" bilden: „Die Deutsche Studenten-
schaft beschreitet mit diesem Wirtschaftsplan
den Weg, der allein den einzelnen, das Volk,
Europa vom bevorstehenden Zusammenbruch
zur Rettung führt, hinweg von dem Gedanken,
daß irgendein Volk oder ein einzelner leben
könne von Geldreserven, Wirtschaftsdiktaten
oder Renten. Er führt zu der Erkenntnis, daß
allein in der Selbsthilfe, Entfaltung der inneren
Kraft, höchster Arbeitsausbildung und Aufopfe-
rung die wahren Wirtschaftsreserven und die
sich immer neu erzeugenden Wirtschaftsurkräfte
jedes Volkes und jedes einzelnen liegen."
3 Vorteile beim Rasieren:
Wer sich vor dem Einseifen mit
Nivea-Creme einreibt, hat drei Vor-
teile: erstens ist das Rasieren ange-
nehmer, zweitens wird die Kling»
nicht so schnell stumpf u. drittens tut
man etwasfür die Haut.
Die Offensive der Arbeit
Die Heimat wird arbeiten, sie wird mit weni-
S ger Menschen mehr leisten. Die Auitorderung
E des Führers in seiner Rede zum Tage der
E Machtübernahme wendet sich an ein Volk,
S dessen Männer an den Fronten jede Anstren-
E gung ertragen, alles opfern und siegen. Was
E von der Heimat in der Versorgung unserer
E Wehrmacht mit Watten, Munition und sonsti-
S gern Kriegs- oder Bedarismaterial verlangt
E wird, bedarf keiner Begründung, denn jeder
E Arbeiter und Schaffende ist sich bewußt, daß
E heute sein Tagewerk in unmittelbare oder mit-
E felbare Beziehung zum Kriegsgeschehen tritt.
E Unsere Arbeit ist kriegsverpflichtet wie unsere
E Sinnes- und Lebenshaltung.
S In diesem Weltkampf stehen sich nicht nur
E Heere, Flotten, Luitgeschwader gegenüber, es
E ringen nicht nur Weltanschauungen aul Leben
§ und Tod miteinander, sondern es werden im
E totalen Kriege die Erzeugnisse der Arbeit auf
E die Waagschale geworfen. Die Fronten der Ar-
S heil haben zwar in der Öffentlichkeit nicht die
E täglichen Tatenberichte, wie sie bei uns in den
E OKW'.-Berichten iür die Leistungen der Wehr-
E macht niedergelegt werden, die Leistungen der
S Arbeitslronten zeigen sich in weltweiten Ope-
S iationen der militärischen Krieglührung. Es ist
= doch jedem klar, daß ein Mehr von Panzern,
E Flugzeugen und U-Booten zugleich erhöhte
S Produktion von Betriebsstoffen erfordert und
E daß erst die lückenlose Bereitstellung aller
S Materialeinsätze der Strategie eine entschel-
S dende Größenordnung iür das Zuschlagen und
E die Operationspläne in die Hand gibt. Die
S Fronten der Arbeit schlagen Tag und Nacht,
S ohne Unterbrechung bis zur letzten Sekunde
S des Weltkrieges ihre Schlachten, aul diesen
S Kampiplätzen stehen die unbekannten Soldaten
Z der Arbeit.
E Fronten aber messen sich gegeneinander.
E Wir und unsere Verbündeten, das italienische
S und japanische Volk, arbeiten nicht zu Füßen
E der Mammutbanken des Weltkapitalisums, wie
E die Arbeiterheere der plutokratischen Länder
5 es gewohnt sind. Wir lernten wieder die Arbeit
S mit verinnerlichtem Sinn anzuschauen und zu
E erlüllen. Zuvor die Friedensjahre gaben uns
S einen gewaltigen Vorsprung, er beruht nicht
S allein in der Vervollkommnung der Technik
S und den aufwärts strebenden Kurven der Pro-
S duktion, er wurzelt ebenso sehr In der Geistes-
E und Herzenshaltunq des Arbeitenden. Wie un-
S sere Männer draußen an der Front den „Men-
E sehen" zuletzt siegreich einsetzen, so wohnt
E auch dem deutschen Volke in der Heimat ein
2 Potential der Inneren Arbeltskraft inne, vor der
E die Gegner die Segel streichen müssen.
S Unsere Feinde prahlen mit den großen Zah-
E len ihrer Rüstungsproduktion, sie berauschen
E sich an Arbeitsprogrammen, deren Zittern lllu-
E sionen sind. Roosevelt und Churchill richten
E ihre Blicke aul die Erdkarte und addieren die
E beherrschten Riesenräume, die Rohstofigebiete,
E die untertänigen Menschenmassen. Auch wir
E haben alle Veranlassung, über dem inneren
S Potential unserer Front nicht die veränderte
E Quantität gegenüber dem ersten Weltkrieg zu
S vergessen. Da hat sich doch ein großer Wandel
5 vollzogen.
■ Nehmen wir zuerst einmal die Bevölkerungs-
£ zahlen der kriegführenden Mächte. Das eng-
E lische Mutterland, die Vereinigten Staaten von
E Amerika und die Sowjetunion nach dem der-
S zeitigen Besitzstande haben insgesamt kaum
E mehr als 300 Millionen Einwohner. Die Volks-
» zahl des Reiches, Italiens und Japans Ist nicht
E wesentlich geringer. Die Gegenseite wird nun
E die Dominien, die Kolonialgebiete und sonstige
5 Hilfsvölker herbeiziehen, jedoch auch das ist
E durch die Tatsachen des Krieges überholt.
5 Da hat Deutschland inlolge seiner erfolg-
B reichen Feldzüge und Außenpolitik den euro-
Z päischen Rahmen außerordentlich erweitert.
Z Die Mehrzahl der europäischen Völker arbeitet
Z mit an dem Kriegspotential der Achsenmächte.
Z Hier stecken noch Reserven, die von Monat zu
Z Monat stärker organisiert werden. Mit diesen
Z Arbeltskrätten aus dem Bereiche europäischer
Z Kultur werden sich die den Feindmächten zur
Z Vertügung stehenden zusätzlichen und nur er-
Z schwert greilbaren Arbeitermassen der Kolo-
Z nien niemals messen können. Dasselbe gilt lür
Z den japanischen Großwirtschaitsraum, denn
Z auch hier sind Arbeit und Produktion seit Jah-
5 ren planmäßig gefördert worden. Wer steh die
Z Mühe macht, unter Ausschaltung der nicht zu
Z aktivierenden Erdbevölkerung die Kapazitäten
S der Arbeitskrälte zu überschlagen, der wird
S ieststellen, daß die Völker des Dreierpakts und
S ihre Getolgsmannschalt keineswegs ungünsti-
| ger liegen. Im Gegenteil, die schnelleren Vor-
3 aussetzungen der Qualität und der Reserven
E sind aul ihrer Seite. Dies ist im Vergleich zu
£ den Jahren 1914—1918 ein entscheidender Fak-
E tor tür die Sicherheit des Sieges. Mit Wolken-
Z kratzerzitiern und amerikanischen Rekorden
£ vermag uns Roosevelt und das ihn gängelnde
£ 'Weltjudentum nicht mehr zu erschrecken, dazu
Z wissen wir heute genauer und besser, was wir
S wert sind. Unsere Front der Arbeit wächst wie
£ die Front unserer Wehrmacht an den Autgaben,
| die dieser zweite und letzte Weltkrieg stellt.
Z Dr. Walther Schellhase