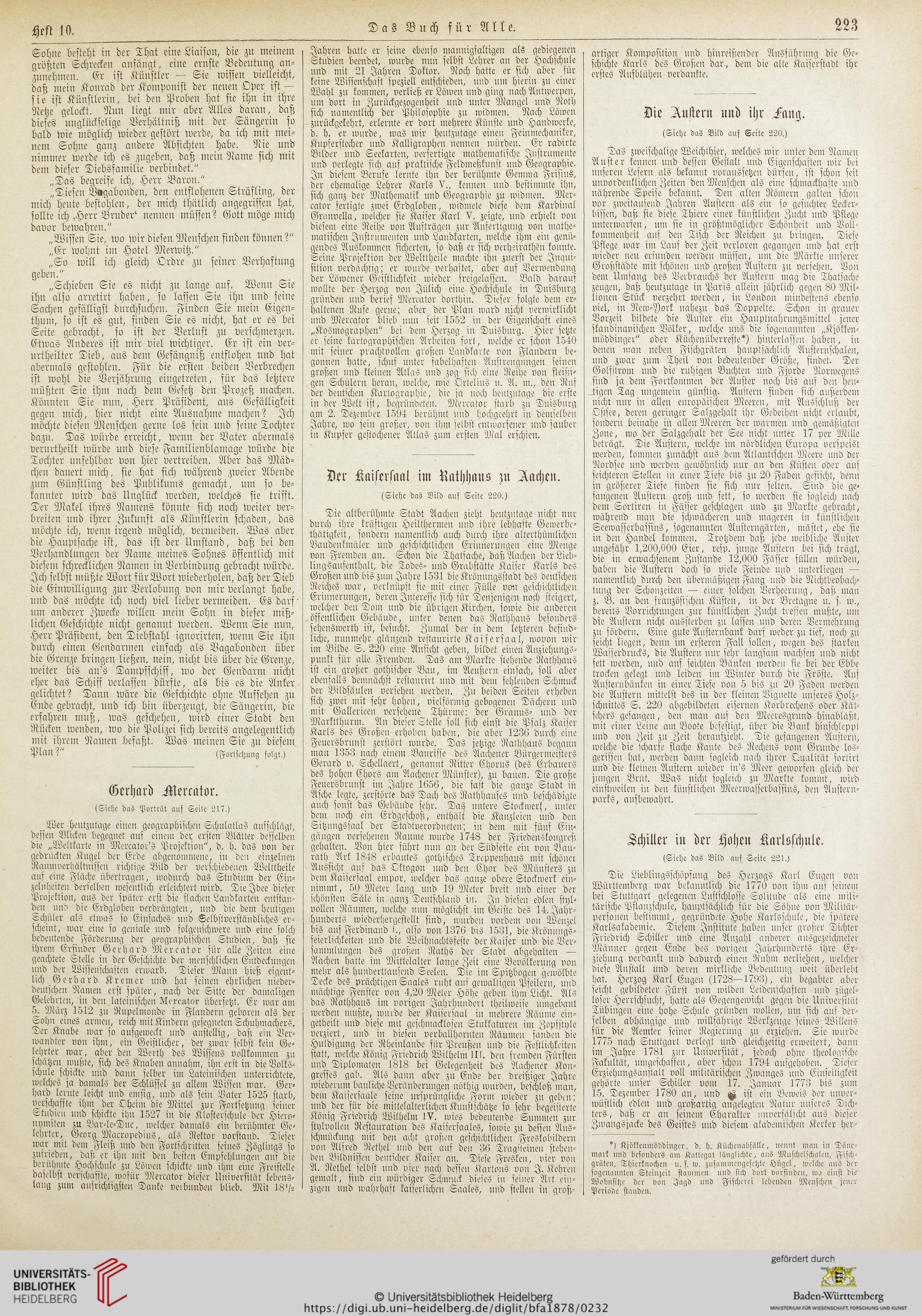Heft lO.
Sohne besteht in der That eine Liaison, die zu meinem
größten Schrecken anfängt, eine ernste Bedeutung an-
zunehmen. Er ist Künstler — Sie wissen vielleicht,
daß mein Konrad der Komponist der neuen Oper ist —
sie ist Künstlerin, bei den Proben hat sie ihn in ihre
Netze gelockt. Nun liegt mir aber Alles daran, daß
dieses Unglückselige Verhältniß mit der Sängerin so
bald wie möglich wieder gestört werde, da ich mit mei-
nem Sohne ganz andere Absichten habe. Nie und
nimmer werde ich es zugeben, daß mein Name sich mit
dem dieser Diebsfamilie verbindet."
„Das begreife ich, Herr Baron."
„Diesen Bagabonden, den entflohenen Sträfling, der
mich heute bestohlen, der mich thätlich angegriffen hat,
sollte ich .Herr Bruder' nennen müssend Gott möge mich
davor bewahren."
„Wissen Sie, wo wir diesen Menschen finden könnend"
„Er wohnt in: Hotel Merwitz."
„So will ich gleich Ordre zu seiner Verhaftung
geben."
„Schieben Sie es nicht zu lange ans. Wenn Sie
ihn also arretirt haben, so lassen Sie ihn und seine
Sachen gefälligst durchsuchen. Finden Sie mein Eigen-
thum, so ist es gut, finden Sie es nicht, hat er es bei
Seite gebracht, so ist der Verlust zu verschmerzen.
Etwas Anderes ist mir viel wichtiger. Er ist ein ver-
urtheilter Dieb, aus dem Gefünguiß entflohen und hat
abermals gestohlen. Für die ersten beiden Verbrechen
ist wohl die Verjährung eingetreten, für das letztere
müßten Sie ihm nach dem Gesetz den Prozeß machen.
Könnten Sie nun, Herr Präsident, aus Gefälligkeit
gegen mich, hier nicht eine Ausnahme machend Ich
möchte diesen Menschen gerne los fein und seine Tochter
dazu. Das würde erreicht, wenn der Vater abermals
verurtheilt würde und diese Familienblamage würde die
Tochter unfehlbar von hier vertreiben. Aber das Mäd-
chen dauert mich, sie hat sich während zweier Abende
zum Günstling des Publikums gemacht, um so be-
kannter wird das Unglück werden, welches sie trifft.
Der Makel ihres Namens könnte sich noch weiter ver-
breiten und ihrer Zukunft als Künstlerin schaden, das
möchte ich, wenn irgend möglich, vermeiden. Was aber
die Hauptsache ist, das ist der Umstand, daß bei den
Verhandlungen der Name meines Sohnes öffentlich mit
diesem schrecklichen Namen in Verbindung gebracht würde.
Ich selbst müßte Wort für Wort wiederholen, daß der Dieb
die Einwilligung zur Verlobung von mir verlangt habe,
und das möchte ich noch viel lieber vermeiden. Es darf
um anderer Zwecke willen mein Sohn in dieser miß-
lichen Geschichte nicht genannt werden. Wenn Sie nun,
Herr Präsident, den Diebstahl ignorirten, wenn Sie ihn
durch einen Gendarmen einfach als Aagabonden über
die Grenze bringen ließen, nein, nicht bis über die Grenze,
weiter bis an's Dampfschiff, wo der Gendarm nicht
eher das Schiff verlassen dürfte, als bis es die Anker
gelichtet d Dann wäre die Geschichte ohne Aufsehen zu
Ende gebracht, und ich bin überzeugt, die Sängerin, die
erfahren muß, was geschehen, wird einer Stadt den
Rücken wenden, wo die Polizei sich bereits angelegentlich
mit ihrem Namen befaßt. Was meinen Sie zu diesem
Pland" (Fortsetzung folgt.)
Gerhard Mercator.
(Stehe das Porträt auf Seite 217.)
Wer heutzutage einen geographischen Schnlatlas ansschlägt,
dessen Blicken begegnet auf einem der ersten Blätter desselben
die „Weltkarte in Mercator's Projektion", d. h. das von der
gedruckten Kugel der Erde abgenommene, in den einzelnen
Raumverhältnisseu richtige Bild der verschiedenen Welttheile
ans eine Fläche übertragen, wodurch das Studium der Ein-
zelnheiten derselben wesentlich erleichtert wird. Die Idee dieser
Projektion, aus der später erst die flachen Landkarten entstan-
den nnd die Erdgloben verdrängten, und die dem heutigen
Schüler als etwas so Einfaches und Selbstverständliches er-
scheint, war eine so geniale und folgenschwere nnd eine solch
bedeutende Förderung der geographischen Studien, daß sie
ihren.! Erfinder Gerhard Mercator für alle Zeiten eine
geachtete Stelle in der Geschichte der menschlichen Entdeckungen
und der Wissenschaften erwarb. Dieser Mann hieß eigent-
lich Gerhard Kremer und hat seinen ehrlichen nieder-
deutschen Namen erst später, nach der Sitte der damaligen
Gelehrten, in den lateinischen ÜUrcator übersetzt. Er war am
5. Marz 1512 zu Rupetmonde in Flandern geboren als der
Sohn eines armen, reich mit Kindern gesegneten Schuhmachers.
Der Knabe war so ausgeweckt und anstellig, daß ein Ver-
wandter von ihm, ein Geistlicher, der zwar selbst kein Ge-
lehrter war, aber den Werth des Wissens vollkommen zu
schützen wußte, sich des Knaben annahm, ihn erst in die Volks-
schule schickte nnd dann selber im Lateinischen unterrichtete,
welches ja damals der Schlüssel zu allem Wissen war. Ger-
hard tenüe leicht und emsig, und als sein Vater 1525 starb,
verschaffte ihm der Oheim die Mittel zur Fortsetzung seiner
Studien und schickte ihn 1527 in die Klosterschnle der Hiero-
nymilen zu Bar-le-Dnc, welcher damals ein berühmter Ge-
lehrter, Georg Macropedins, als Rektor vorstand. Dieser
ivar mit dem Fleiß und den Fortschritten feines Zöglings so
zufrieden, daß er ihn mit den besten Empfehlungen auf die
berühmte Hochschule zu Löwen schickte und ihm eine Freistelle
daselbst verschaffte, wofür Mercator dieser Universität lebens-
lang zum aufrichtigsten Danke verbunden blieb. Mit 18'/-
Das Buch für Alle.
Jahren hatte er seine ebenso mannigfaltigen als gediegenen
Studien beendet, wurde nun selbst Lehrer an der Hochschule
und niit 21 Jahren Doktor. Noch hatte er sich aber für
keine Wissenschaft speziell entschieden, und um hierin zu einer
Wahl zu kommen, verließ er Löwen und ging nach Antwerpen,
um dort iu Zurückgezogenheit und unter Mangel und Noth
sich namentlich der Philosophie zu widmen. Nach Löwen
zurückgekehrt, erlernte er dort mehrere Künste und Handwerke,
d. h. er wurde, was wir heutzutage einen Feinmechaniker,
Kupferstecher und Kalligraphen nennen würden. Er radirte
Bilder und Seekarten, verfertigte mathematische Instrumente
und verlegte sich auf praktische Feldmeßkunst und Geographie.
In diesem Berufe lernte ihn der berühmte Gemma Frisius,
der ehemalige Lehrer Karls V., kennen und bestimmte ihn,
sich ganz der Mathematik und Geographie zu widmen. Mer-
cator fertigte zwei Erdgloben, widmete diese dem Kardinal
Granvella, welcher sie Kaiser Karl V. zeigte, und erhielt von
diesem eine Reihe von Aufträgen zur Anfertigung von mathe-
matischen Instrumenten und Landkarten, welche ihm ein genü-
gendes Auskommen sicherten, so daß er sich verheiratheu konnte.
Seine Projektion der Welttheile machte ihn zuerst der Inqui-
sition verdächtig; er wurde verhaftet, aber auf Verwendung
der Lömener Geistlichkeit wieder freigelassen. Bald daraus
wollte der Herzog von Jülich eine Hochschule in Duisburg
gründen und berief Mercator dorthin. Dieser folgte dem er-
haltenen Rufe gerne; aber der Plan ward nicht verwirklicht
und Mercator blieb nun feit 1552 in der Eigenschaft eines
„Kosmographen" bei dem Herzog in Duisburg. Hier setzte
er seine kartographischen Arbeiten fort, welche er schon 1540
mit seiner prachtvollen großen Landkarte von Flandern be-
gonnen hatte, schuf unter fabelhaften Anstrengungen seinen
großen und kleinen Atlas nnd zog sich eine Reihe von fleißi-
gen Schülern heran, welche, wie Ortelins u. A. m., den Nus
der deutschen Kartographie, die ja noch heutzutage die erste
in der Welt ist, begründeten. Mercator starb zu Duisburg
am 2. Dezember 1594 berühmt und hochgeehrt in demselben
Jahre, wo sein großer, von ihm selbst entworfener und sauber
in Kupfer gestochener Atlas zum ersten Mal erschien.
Der Laiserlalü im Nathhaus zu Fachen.
(Siehe das Bild auf Seite 220.)
Die altberühmte Stadt Aachen zieht heutzutage nicht nur
durch ihre kräftigen Heilthermen und ihre lebhafte Gewerbe-
thätigkeit, sondern namentlich auch durch ihre alterthümlichen
Baudenkmäler und geschichtlichen Erinnerungen eine Menge
von Fremden an. t^chon die Thatsache, daß Aachen der Lieb-
lingsaufenthalt, die Todes- und Grabstätte Kaiser Karls des
Großen und bis zum Jahre 1531 die Krönungsstadt des deutschen
Reiches war, verknüpft sie mit einer Fülle von geschichtlichen
Erinnerungen, deren Interesse sich für Denjenigen noch steigert,
welcher den Dom nnd die übrigen Kirchen, sowie die anderen
öffentlichen Gebäude, unter denen das Nathhans besonders
sehenswerth ist, besucht. Zumal der in dem letzteren befind-
liche, nunmehr glänzend restaurirte Kaisersaal, wovon wir
im Bilde S. 220 eine Ansicht geben, bildet einen Anziehungs-
punkt für alle Fremden. Das am Markte stehende Nathhaus
ist ein großer gothischer Bau, im Aeußern einfach, soll aber
ebenfalls demnächst restanrirt nnd mit dem fehlenden Schmuck
der Bildsäulen versehen werden. Zu beiden Seiten erheben
sich zwei mit sehr hohen, vielförmig gebogenen Dächern und
mit Gallerieen versehene^ Thürme: der Granus- und der
Marktthurm. An dieser Stelle soll sich einst die Pfalz Kaiser
Karls des Großen erhoben haben, die aber 1236 durch eine
Feuersbrunst zerstört wurde. Das jetzige Nathhaus begann
man 1353 nach einem Baurisse des Aachener Bürgermeisters
Gerard v. Schellaert, genannt Ritter Chorus (des Erbauers
des hohen Chors am Aachener Münster), zu bauen. Die große
Feuersbrunst im Jahre 1656, die fast die ganze Stadt in
Asche siegte, zerstörte das Dach des Nathhauses und beschädigte
auch sonst das Gebäude sehr. Das untere Stockwersi, unter
dein noch ein Erdgeschoß, enthält die Kanzleien und den
Sitzungssaal der Stadtverordneten; in dem mit fünf Ein-
gängen versehenen Raume wurde 1748 der Friedenskongreß
gehalten. Von hier führt nun an der Südseite ein von Bau-
rath Ark 1848 erbautes gothisches Treppenhaus mit schöner
Aussicht auf das Oktogon und den Chor des Münsters zu
dem Kaisersaal empor, welcher das ganze obere Stockwerk ein-
nimmt, 50 Meter lang und 19 Nieter breit und einer der
schönsten Säle in ganz Deutschland in. In diesen edlen styl-
vollen Räumen, welche nun möglichst im Geiste des 14. Jahr-
hunderts wiederhergestellt sind, wurden vordem von Wenzel
bis auf Ferdinand >., also von 1376 bis 1531, die Krönungs-
feierlichkeiten nnd die Weihnachtsfeste der Kaiser und die Ver-
sammlungen des großen Raths der Stadt abgehalten —
Aachen hatte im Mittelaller lange Zeit eine Bevölkerung von
mehr als hunderttausend Seelen. Die im Spitzbogen gewölbte
Decke des prächtigen Saales ruht ans gewaltigen Pfeilern, und
mächtige Fenster von 4,20 Meter Höhe geben ihm Licht. Als
das Nathhaus im vorigen Jahrhundert theilweise umgebaut
werden mußte, wurde der Kaisersaal in mehrere Räume ein-
getheilt und diese mit geschmacklosen Stukkaturen im Zopfstyle
verziert, nnd in diesen verballhornten Räumen fanden die
Huldigung der Rheinlande für Preußen und die Festlichkeiten
statt, welche König Friedrich Wilhelm III. den fremden Fürsten
und Diplomaten 1818 bei Gelegenheit des Aachener Kon-
gresses gab. Als dann aber zu Ende der dreißiger Jahre
wiederum bauliche Veränderungen nöthig wurden, beschloß man,
dem Kaisersaale seine ursprüngliche Form wieder zu gebcn;
und der für die mittelalterlichen Knnstschütze so sehr begeisterte
König Friedrich Wilhelm IV. wies bedeutende Summen zur
stylvollen Restauration des Kaisersaales, sowie zu dessen Aus-
schmückung mit den acht großen geschichtlichen Freskobildern
von Alfred Rethel und den auf den 36 Tragüeinen stehen-
den Bildnissen deutscher Kaiser an. Diese Fresken, vier von
A. Rethel selbst und vier nach dessen Kartons von I. Kehren
gemalt, sind ein würdiger Schmuck dieses in seiner Art ein-
zigen und wahrhaft kaiserlichen Saales, nnd stellen in groß-
223
artiger Komposition und hinreißender Ausführung die Ge-
schichte Karls des Großen dar, dem die alte Kaiserstadt ihr
erstes Aufblühen verdankte.
Die Fickern und ihr Fang.
(Siehe das Bild auf Seite 220.)
Das zweischalige Weichlhier, welches wir unter dem Namen
Auster kennen und dessen Gestalt und Eigenschaften wir bei
unseren Lesern als bekannt voranssetzen dürfen, ist schon seit
unvordenklichen Zeiten den Menschen als eine schmackhafte und
nährende Speise bekannt. Den alten Römern galten schon
vor zweitausend Jahren Austern als ein so gesuchter Lecker-
bissen, daß sie diese Thiere einer künstlichen Zucht und Pflege
unterwarfen, um sie in größtmöglicher Schönheit nnd Voll-
kommenheit auf den Tisch der Reichen zu bringen. Diese
Pflege war im Laus der Zeit verloren gegangen nnd hat erst
wieder neu erfunden werden müssen, um die Märkte unserer
Großstädte mit schönen und großen Austern zu versehen. Von
dem Umfang des Verbrauchs der Austern mag die Thatsache
zeugen, daß heutzutage in Paris allein jährlich gegen 80 Mil-
lionen Stück verzehrt werden, in London mindestens ebenso
viel, in New-Pork nahezu das Doppelte. Schon in grauer
Vorzeit bildete die Auster ein Hauptnahrnngsmittel jener
skandinavischen Völker, welche uns die sogenannten „Kjökken-
möddinger" oder Küchenüberreste*) hinterlassen haben, in
denen man neben Fischgräten hauptsächlich Austernschalen,
und zwar zum Theil von bedeutender Größe, findet. Der
Golfstrom und die ruhigen Buchten und Fjorde Norwegens
sind ja dem Fortkommen der Auster noch bis auf den heu-
tigen Tag ungemein günstig. Austern finden sich außerdem
nicht nur in allen europäischen Meeren, mit Ausschluß der
Ostsee, deren geringer Salzgehalt ihr Gedeihen nicht erlaubt,
sondern beinahe in allen Meeren der warmen und gemäßigten
Zone, wo der Salzgehalt der See nicht unter 17 per Mille
beträgt. Die Austern, welche im nördlichen Europa verspeist
werden, kommen zunächst ans dem Atlantischen Meere nnd der
Nordsee und werden gewöhnlich nur an den Küsten oder auf
seichteren Stellen in einer Tiefe bis zn 20 Faden gefischt, denn
in größerer Tiefe finden sie sich nur selten. Sind die ge-
fangenen Austern groß und fett, so werden sie sogleich nach
dem Sortiren in Fässer geschlagen und zn Markte gebracht,
während man die schwächeren und mageren in künstlichen
Seewasserbassins, sogenannten Austerngärten, mästet, ehe sie
in den Handel kommen. Trotzdem daß jede weibliche Auster
ungefähr 1,200,000 Eier, resp. junge Austern bei sich trägt,
die in erwachsenem Zustande 12,000 Fässer füllen würden,
haben die Austern doch so viele Feinde und unterliegen —
namentlich durch den übermäßigen Fang und die Nichtbeobach-
tung der Schonzeiten — einer solchen Verheerung, daß man
z. B. an den französischen Küsten, in der Bretagne u. si w.,
bereits Vorrichtungen zur künstlichen Zucht treffen mußte, um
die Austern nicht aussterben zn lassen und deren Vermehrung
zn fördern. Eine gute Austernbank darf weder zn tief, noch zn
seicht liegen, denn im ersteren Fall sollen, wegen des starten
Wasserdrucks, die Austern nur sehr langsam wachsen und nicht
fett werden, und aus seichten Bänken werden sie bei der Ebbe
trocken gelegt und leiden im Winter durch die Fröste. Aus
Austernbänken in einer Tiefe von 5 bis zu 20 Faden werden
die Austern mittelst des in der kleinen Vignette unseres Holz-
schnittes S. 220 abgebildeten eisernen Korbrechens oder Kät-
schers gefangen, den man auf den Meeresgrund hinabläßt,
mit einer Leine am Boote befestigt, über die Bank hinschleppi
und von Zeit zn Zeit heraufzieht. Die gefangenen Austern,
welche die scharfe flache Kante des Rechens vom Grunde los-
gerissen hat, werden dann sogleich nach ihrer Qualität sortirt
und die kleinen Austern wieder in's Meer geworfen gleich der
jungen Brut. Was nicht sogleich zu Markte kommt, wird
einstweilen in den künstlichen Meerwasserbassins, den Anstern-
parks, aufbewahrt.
Schiller in der Hohen Knrlsschnle.
(Siehe das Bild auf Seite 221.)
Die Lieblingsschöpfung des Herzogs Karl Eugen von
Württemberg war bekanntlich die 1770 von ihm auf seinem
bei Stuttgart gelegenen Lustschlosse Solitude als eine mili-
tärische Pflanzschule, hauptsächlich sür die Söhne von Militär-
personen bestimmt, gegründete Hohe Karlsschule, die spätere
Karlsakademie. Diesem Institute haben unser großer Dichter
Friedrich Schiller und eine Anzahl anderer ausgezeichneter
Männer gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ihre Er-
ziehung verdankt nnd dadurch einen Ruhm verliehen, welcher
diese Anstalt und deren wirtliche Bedeutung weit überlebt
hat. Herzog Karl Eugen (1728—1793), ein begabter aber
seicht gebildeter Fürst von wilden Leidenschaften nnd zügel-
loser Herrschsucht, hatte als Gegengewicht gegen die Universität
Tübingen eine hohe Schule gründen wollen, um sich auf der-
selben abhängige und willfährige Werkzeuge seines Willens
sür die Aemter seiner Negierung zu erziehen. Sie wurde
1775 nach Stuttgart verlegt und gleichzeitig erweitert, dann
im Jahre 1781 zur Universität, jedoch ohne theologische
Fakultät, umgeschaffen, aber schon 1794 aufgehoben. Dieser
Erziehungsanstalt voll militärischen Zwanges und Einseitigkeit
gehörte unser Schiller vom 17. Januar 1773 bis zum
15. Dezember 1780 an, und H ist ein Beweis der unver-
wüstlich edlen nnd großartig angelegten Natur unseres Dich-
ters, daß er an seinem Charakter unverfälscht ans dieser
Zwangsjacke des Geistes und diesem akademischen Kerker her-
*) Kjökkenmöddinger, d. h. KUchenabfälle, nennt man in Däne-
mark und besonders am Kattegat länglichte, ans Muschelschalen, Fisch-
gräten, Thicrknochen u. s. tv. zusammengesetzte Hügel, welche aus der
sogenannten Steinzeit stammen und sich dort vorfinden, wo einst die
Wolmsitze der von Jagd und Fischerei lebenden Menschen jener
Periode standen.
Sohne besteht in der That eine Liaison, die zu meinem
größten Schrecken anfängt, eine ernste Bedeutung an-
zunehmen. Er ist Künstler — Sie wissen vielleicht,
daß mein Konrad der Komponist der neuen Oper ist —
sie ist Künstlerin, bei den Proben hat sie ihn in ihre
Netze gelockt. Nun liegt mir aber Alles daran, daß
dieses Unglückselige Verhältniß mit der Sängerin so
bald wie möglich wieder gestört werde, da ich mit mei-
nem Sohne ganz andere Absichten habe. Nie und
nimmer werde ich es zugeben, daß mein Name sich mit
dem dieser Diebsfamilie verbindet."
„Das begreife ich, Herr Baron."
„Diesen Bagabonden, den entflohenen Sträfling, der
mich heute bestohlen, der mich thätlich angegriffen hat,
sollte ich .Herr Bruder' nennen müssend Gott möge mich
davor bewahren."
„Wissen Sie, wo wir diesen Menschen finden könnend"
„Er wohnt in: Hotel Merwitz."
„So will ich gleich Ordre zu seiner Verhaftung
geben."
„Schieben Sie es nicht zu lange ans. Wenn Sie
ihn also arretirt haben, so lassen Sie ihn und seine
Sachen gefälligst durchsuchen. Finden Sie mein Eigen-
thum, so ist es gut, finden Sie es nicht, hat er es bei
Seite gebracht, so ist der Verlust zu verschmerzen.
Etwas Anderes ist mir viel wichtiger. Er ist ein ver-
urtheilter Dieb, aus dem Gefünguiß entflohen und hat
abermals gestohlen. Für die ersten beiden Verbrechen
ist wohl die Verjährung eingetreten, für das letztere
müßten Sie ihm nach dem Gesetz den Prozeß machen.
Könnten Sie nun, Herr Präsident, aus Gefälligkeit
gegen mich, hier nicht eine Ausnahme machend Ich
möchte diesen Menschen gerne los fein und seine Tochter
dazu. Das würde erreicht, wenn der Vater abermals
verurtheilt würde und diese Familienblamage würde die
Tochter unfehlbar von hier vertreiben. Aber das Mäd-
chen dauert mich, sie hat sich während zweier Abende
zum Günstling des Publikums gemacht, um so be-
kannter wird das Unglück werden, welches sie trifft.
Der Makel ihres Namens könnte sich noch weiter ver-
breiten und ihrer Zukunft als Künstlerin schaden, das
möchte ich, wenn irgend möglich, vermeiden. Was aber
die Hauptsache ist, das ist der Umstand, daß bei den
Verhandlungen der Name meines Sohnes öffentlich mit
diesem schrecklichen Namen in Verbindung gebracht würde.
Ich selbst müßte Wort für Wort wiederholen, daß der Dieb
die Einwilligung zur Verlobung von mir verlangt habe,
und das möchte ich noch viel lieber vermeiden. Es darf
um anderer Zwecke willen mein Sohn in dieser miß-
lichen Geschichte nicht genannt werden. Wenn Sie nun,
Herr Präsident, den Diebstahl ignorirten, wenn Sie ihn
durch einen Gendarmen einfach als Aagabonden über
die Grenze bringen ließen, nein, nicht bis über die Grenze,
weiter bis an's Dampfschiff, wo der Gendarm nicht
eher das Schiff verlassen dürfte, als bis es die Anker
gelichtet d Dann wäre die Geschichte ohne Aufsehen zu
Ende gebracht, und ich bin überzeugt, die Sängerin, die
erfahren muß, was geschehen, wird einer Stadt den
Rücken wenden, wo die Polizei sich bereits angelegentlich
mit ihrem Namen befaßt. Was meinen Sie zu diesem
Pland" (Fortsetzung folgt.)
Gerhard Mercator.
(Stehe das Porträt auf Seite 217.)
Wer heutzutage einen geographischen Schnlatlas ansschlägt,
dessen Blicken begegnet auf einem der ersten Blätter desselben
die „Weltkarte in Mercator's Projektion", d. h. das von der
gedruckten Kugel der Erde abgenommene, in den einzelnen
Raumverhältnisseu richtige Bild der verschiedenen Welttheile
ans eine Fläche übertragen, wodurch das Studium der Ein-
zelnheiten derselben wesentlich erleichtert wird. Die Idee dieser
Projektion, aus der später erst die flachen Landkarten entstan-
den nnd die Erdgloben verdrängten, und die dem heutigen
Schüler als etwas so Einfaches und Selbstverständliches er-
scheint, war eine so geniale und folgenschwere nnd eine solch
bedeutende Förderung der geographischen Studien, daß sie
ihren.! Erfinder Gerhard Mercator für alle Zeiten eine
geachtete Stelle in der Geschichte der menschlichen Entdeckungen
und der Wissenschaften erwarb. Dieser Mann hieß eigent-
lich Gerhard Kremer und hat seinen ehrlichen nieder-
deutschen Namen erst später, nach der Sitte der damaligen
Gelehrten, in den lateinischen ÜUrcator übersetzt. Er war am
5. Marz 1512 zu Rupetmonde in Flandern geboren als der
Sohn eines armen, reich mit Kindern gesegneten Schuhmachers.
Der Knabe war so ausgeweckt und anstellig, daß ein Ver-
wandter von ihm, ein Geistlicher, der zwar selbst kein Ge-
lehrter war, aber den Werth des Wissens vollkommen zu
schützen wußte, sich des Knaben annahm, ihn erst in die Volks-
schule schickte nnd dann selber im Lateinischen unterrichtete,
welches ja damals der Schlüssel zu allem Wissen war. Ger-
hard tenüe leicht und emsig, und als sein Vater 1525 starb,
verschaffte ihm der Oheim die Mittel zur Fortsetzung seiner
Studien und schickte ihn 1527 in die Klosterschnle der Hiero-
nymilen zu Bar-le-Dnc, welcher damals ein berühmter Ge-
lehrter, Georg Macropedins, als Rektor vorstand. Dieser
ivar mit dem Fleiß und den Fortschritten feines Zöglings so
zufrieden, daß er ihn mit den besten Empfehlungen auf die
berühmte Hochschule zu Löwen schickte und ihm eine Freistelle
daselbst verschaffte, wofür Mercator dieser Universität lebens-
lang zum aufrichtigsten Danke verbunden blieb. Mit 18'/-
Das Buch für Alle.
Jahren hatte er seine ebenso mannigfaltigen als gediegenen
Studien beendet, wurde nun selbst Lehrer an der Hochschule
und niit 21 Jahren Doktor. Noch hatte er sich aber für
keine Wissenschaft speziell entschieden, und um hierin zu einer
Wahl zu kommen, verließ er Löwen und ging nach Antwerpen,
um dort iu Zurückgezogenheit und unter Mangel und Noth
sich namentlich der Philosophie zu widmen. Nach Löwen
zurückgekehrt, erlernte er dort mehrere Künste und Handwerke,
d. h. er wurde, was wir heutzutage einen Feinmechaniker,
Kupferstecher und Kalligraphen nennen würden. Er radirte
Bilder und Seekarten, verfertigte mathematische Instrumente
und verlegte sich auf praktische Feldmeßkunst und Geographie.
In diesem Berufe lernte ihn der berühmte Gemma Frisius,
der ehemalige Lehrer Karls V., kennen und bestimmte ihn,
sich ganz der Mathematik und Geographie zu widmen. Mer-
cator fertigte zwei Erdgloben, widmete diese dem Kardinal
Granvella, welcher sie Kaiser Karl V. zeigte, und erhielt von
diesem eine Reihe von Aufträgen zur Anfertigung von mathe-
matischen Instrumenten und Landkarten, welche ihm ein genü-
gendes Auskommen sicherten, so daß er sich verheiratheu konnte.
Seine Projektion der Welttheile machte ihn zuerst der Inqui-
sition verdächtig; er wurde verhaftet, aber auf Verwendung
der Lömener Geistlichkeit wieder freigelassen. Bald daraus
wollte der Herzog von Jülich eine Hochschule in Duisburg
gründen und berief Mercator dorthin. Dieser folgte dem er-
haltenen Rufe gerne; aber der Plan ward nicht verwirklicht
und Mercator blieb nun feit 1552 in der Eigenschaft eines
„Kosmographen" bei dem Herzog in Duisburg. Hier setzte
er seine kartographischen Arbeiten fort, welche er schon 1540
mit seiner prachtvollen großen Landkarte von Flandern be-
gonnen hatte, schuf unter fabelhaften Anstrengungen seinen
großen und kleinen Atlas nnd zog sich eine Reihe von fleißi-
gen Schülern heran, welche, wie Ortelins u. A. m., den Nus
der deutschen Kartographie, die ja noch heutzutage die erste
in der Welt ist, begründeten. Mercator starb zu Duisburg
am 2. Dezember 1594 berühmt und hochgeehrt in demselben
Jahre, wo sein großer, von ihm selbst entworfener und sauber
in Kupfer gestochener Atlas zum ersten Mal erschien.
Der Laiserlalü im Nathhaus zu Fachen.
(Siehe das Bild auf Seite 220.)
Die altberühmte Stadt Aachen zieht heutzutage nicht nur
durch ihre kräftigen Heilthermen und ihre lebhafte Gewerbe-
thätigkeit, sondern namentlich auch durch ihre alterthümlichen
Baudenkmäler und geschichtlichen Erinnerungen eine Menge
von Fremden an. t^chon die Thatsache, daß Aachen der Lieb-
lingsaufenthalt, die Todes- und Grabstätte Kaiser Karls des
Großen und bis zum Jahre 1531 die Krönungsstadt des deutschen
Reiches war, verknüpft sie mit einer Fülle von geschichtlichen
Erinnerungen, deren Interesse sich für Denjenigen noch steigert,
welcher den Dom nnd die übrigen Kirchen, sowie die anderen
öffentlichen Gebäude, unter denen das Nathhans besonders
sehenswerth ist, besucht. Zumal der in dem letzteren befind-
liche, nunmehr glänzend restaurirte Kaisersaal, wovon wir
im Bilde S. 220 eine Ansicht geben, bildet einen Anziehungs-
punkt für alle Fremden. Das am Markte stehende Nathhaus
ist ein großer gothischer Bau, im Aeußern einfach, soll aber
ebenfalls demnächst restanrirt nnd mit dem fehlenden Schmuck
der Bildsäulen versehen werden. Zu beiden Seiten erheben
sich zwei mit sehr hohen, vielförmig gebogenen Dächern und
mit Gallerieen versehene^ Thürme: der Granus- und der
Marktthurm. An dieser Stelle soll sich einst die Pfalz Kaiser
Karls des Großen erhoben haben, die aber 1236 durch eine
Feuersbrunst zerstört wurde. Das jetzige Nathhaus begann
man 1353 nach einem Baurisse des Aachener Bürgermeisters
Gerard v. Schellaert, genannt Ritter Chorus (des Erbauers
des hohen Chors am Aachener Münster), zu bauen. Die große
Feuersbrunst im Jahre 1656, die fast die ganze Stadt in
Asche siegte, zerstörte das Dach des Nathhauses und beschädigte
auch sonst das Gebäude sehr. Das untere Stockwersi, unter
dein noch ein Erdgeschoß, enthält die Kanzleien und den
Sitzungssaal der Stadtverordneten; in dem mit fünf Ein-
gängen versehenen Raume wurde 1748 der Friedenskongreß
gehalten. Von hier führt nun an der Südseite ein von Bau-
rath Ark 1848 erbautes gothisches Treppenhaus mit schöner
Aussicht auf das Oktogon und den Chor des Münsters zu
dem Kaisersaal empor, welcher das ganze obere Stockwerk ein-
nimmt, 50 Meter lang und 19 Nieter breit und einer der
schönsten Säle in ganz Deutschland in. In diesen edlen styl-
vollen Räumen, welche nun möglichst im Geiste des 14. Jahr-
hunderts wiederhergestellt sind, wurden vordem von Wenzel
bis auf Ferdinand >., also von 1376 bis 1531, die Krönungs-
feierlichkeiten nnd die Weihnachtsfeste der Kaiser und die Ver-
sammlungen des großen Raths der Stadt abgehalten —
Aachen hatte im Mittelaller lange Zeit eine Bevölkerung von
mehr als hunderttausend Seelen. Die im Spitzbogen gewölbte
Decke des prächtigen Saales ruht ans gewaltigen Pfeilern, und
mächtige Fenster von 4,20 Meter Höhe geben ihm Licht. Als
das Nathhaus im vorigen Jahrhundert theilweise umgebaut
werden mußte, wurde der Kaisersaal in mehrere Räume ein-
getheilt und diese mit geschmacklosen Stukkaturen im Zopfstyle
verziert, nnd in diesen verballhornten Räumen fanden die
Huldigung der Rheinlande für Preußen und die Festlichkeiten
statt, welche König Friedrich Wilhelm III. den fremden Fürsten
und Diplomaten 1818 bei Gelegenheit des Aachener Kon-
gresses gab. Als dann aber zu Ende der dreißiger Jahre
wiederum bauliche Veränderungen nöthig wurden, beschloß man,
dem Kaisersaale seine ursprüngliche Form wieder zu gebcn;
und der für die mittelalterlichen Knnstschütze so sehr begeisterte
König Friedrich Wilhelm IV. wies bedeutende Summen zur
stylvollen Restauration des Kaisersaales, sowie zu dessen Aus-
schmückung mit den acht großen geschichtlichen Freskobildern
von Alfred Rethel und den auf den 36 Tragüeinen stehen-
den Bildnissen deutscher Kaiser an. Diese Fresken, vier von
A. Rethel selbst und vier nach dessen Kartons von I. Kehren
gemalt, sind ein würdiger Schmuck dieses in seiner Art ein-
zigen und wahrhaft kaiserlichen Saales, nnd stellen in groß-
223
artiger Komposition und hinreißender Ausführung die Ge-
schichte Karls des Großen dar, dem die alte Kaiserstadt ihr
erstes Aufblühen verdankte.
Die Fickern und ihr Fang.
(Siehe das Bild auf Seite 220.)
Das zweischalige Weichlhier, welches wir unter dem Namen
Auster kennen und dessen Gestalt und Eigenschaften wir bei
unseren Lesern als bekannt voranssetzen dürfen, ist schon seit
unvordenklichen Zeiten den Menschen als eine schmackhafte und
nährende Speise bekannt. Den alten Römern galten schon
vor zweitausend Jahren Austern als ein so gesuchter Lecker-
bissen, daß sie diese Thiere einer künstlichen Zucht und Pflege
unterwarfen, um sie in größtmöglicher Schönheit nnd Voll-
kommenheit auf den Tisch der Reichen zu bringen. Diese
Pflege war im Laus der Zeit verloren gegangen nnd hat erst
wieder neu erfunden werden müssen, um die Märkte unserer
Großstädte mit schönen und großen Austern zu versehen. Von
dem Umfang des Verbrauchs der Austern mag die Thatsache
zeugen, daß heutzutage in Paris allein jährlich gegen 80 Mil-
lionen Stück verzehrt werden, in London mindestens ebenso
viel, in New-Pork nahezu das Doppelte. Schon in grauer
Vorzeit bildete die Auster ein Hauptnahrnngsmittel jener
skandinavischen Völker, welche uns die sogenannten „Kjökken-
möddinger" oder Küchenüberreste*) hinterlassen haben, in
denen man neben Fischgräten hauptsächlich Austernschalen,
und zwar zum Theil von bedeutender Größe, findet. Der
Golfstrom und die ruhigen Buchten und Fjorde Norwegens
sind ja dem Fortkommen der Auster noch bis auf den heu-
tigen Tag ungemein günstig. Austern finden sich außerdem
nicht nur in allen europäischen Meeren, mit Ausschluß der
Ostsee, deren geringer Salzgehalt ihr Gedeihen nicht erlaubt,
sondern beinahe in allen Meeren der warmen und gemäßigten
Zone, wo der Salzgehalt der See nicht unter 17 per Mille
beträgt. Die Austern, welche im nördlichen Europa verspeist
werden, kommen zunächst ans dem Atlantischen Meere nnd der
Nordsee und werden gewöhnlich nur an den Küsten oder auf
seichteren Stellen in einer Tiefe bis zn 20 Faden gefischt, denn
in größerer Tiefe finden sie sich nur selten. Sind die ge-
fangenen Austern groß und fett, so werden sie sogleich nach
dem Sortiren in Fässer geschlagen und zn Markte gebracht,
während man die schwächeren und mageren in künstlichen
Seewasserbassins, sogenannten Austerngärten, mästet, ehe sie
in den Handel kommen. Trotzdem daß jede weibliche Auster
ungefähr 1,200,000 Eier, resp. junge Austern bei sich trägt,
die in erwachsenem Zustande 12,000 Fässer füllen würden,
haben die Austern doch so viele Feinde und unterliegen —
namentlich durch den übermäßigen Fang und die Nichtbeobach-
tung der Schonzeiten — einer solchen Verheerung, daß man
z. B. an den französischen Küsten, in der Bretagne u. si w.,
bereits Vorrichtungen zur künstlichen Zucht treffen mußte, um
die Austern nicht aussterben zn lassen und deren Vermehrung
zn fördern. Eine gute Austernbank darf weder zn tief, noch zn
seicht liegen, denn im ersteren Fall sollen, wegen des starten
Wasserdrucks, die Austern nur sehr langsam wachsen und nicht
fett werden, und aus seichten Bänken werden sie bei der Ebbe
trocken gelegt und leiden im Winter durch die Fröste. Aus
Austernbänken in einer Tiefe von 5 bis zu 20 Faden werden
die Austern mittelst des in der kleinen Vignette unseres Holz-
schnittes S. 220 abgebildeten eisernen Korbrechens oder Kät-
schers gefangen, den man auf den Meeresgrund hinabläßt,
mit einer Leine am Boote befestigt, über die Bank hinschleppi
und von Zeit zn Zeit heraufzieht. Die gefangenen Austern,
welche die scharfe flache Kante des Rechens vom Grunde los-
gerissen hat, werden dann sogleich nach ihrer Qualität sortirt
und die kleinen Austern wieder in's Meer geworfen gleich der
jungen Brut. Was nicht sogleich zu Markte kommt, wird
einstweilen in den künstlichen Meerwasserbassins, den Anstern-
parks, aufbewahrt.
Schiller in der Hohen Knrlsschnle.
(Siehe das Bild auf Seite 221.)
Die Lieblingsschöpfung des Herzogs Karl Eugen von
Württemberg war bekanntlich die 1770 von ihm auf seinem
bei Stuttgart gelegenen Lustschlosse Solitude als eine mili-
tärische Pflanzschule, hauptsächlich sür die Söhne von Militär-
personen bestimmt, gegründete Hohe Karlsschule, die spätere
Karlsakademie. Diesem Institute haben unser großer Dichter
Friedrich Schiller und eine Anzahl anderer ausgezeichneter
Männer gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ihre Er-
ziehung verdankt nnd dadurch einen Ruhm verliehen, welcher
diese Anstalt und deren wirtliche Bedeutung weit überlebt
hat. Herzog Karl Eugen (1728—1793), ein begabter aber
seicht gebildeter Fürst von wilden Leidenschaften nnd zügel-
loser Herrschsucht, hatte als Gegengewicht gegen die Universität
Tübingen eine hohe Schule gründen wollen, um sich auf der-
selben abhängige und willfährige Werkzeuge seines Willens
sür die Aemter seiner Negierung zu erziehen. Sie wurde
1775 nach Stuttgart verlegt und gleichzeitig erweitert, dann
im Jahre 1781 zur Universität, jedoch ohne theologische
Fakultät, umgeschaffen, aber schon 1794 aufgehoben. Dieser
Erziehungsanstalt voll militärischen Zwanges und Einseitigkeit
gehörte unser Schiller vom 17. Januar 1773 bis zum
15. Dezember 1780 an, und H ist ein Beweis der unver-
wüstlich edlen nnd großartig angelegten Natur unseres Dich-
ters, daß er an seinem Charakter unverfälscht ans dieser
Zwangsjacke des Geistes und diesem akademischen Kerker her-
*) Kjökkenmöddinger, d. h. KUchenabfälle, nennt man in Däne-
mark und besonders am Kattegat länglichte, ans Muschelschalen, Fisch-
gräten, Thicrknochen u. s. tv. zusammengesetzte Hügel, welche aus der
sogenannten Steinzeit stammen und sich dort vorfinden, wo einst die
Wolmsitze der von Jagd und Fischerei lebenden Menschen jener
Periode standen.