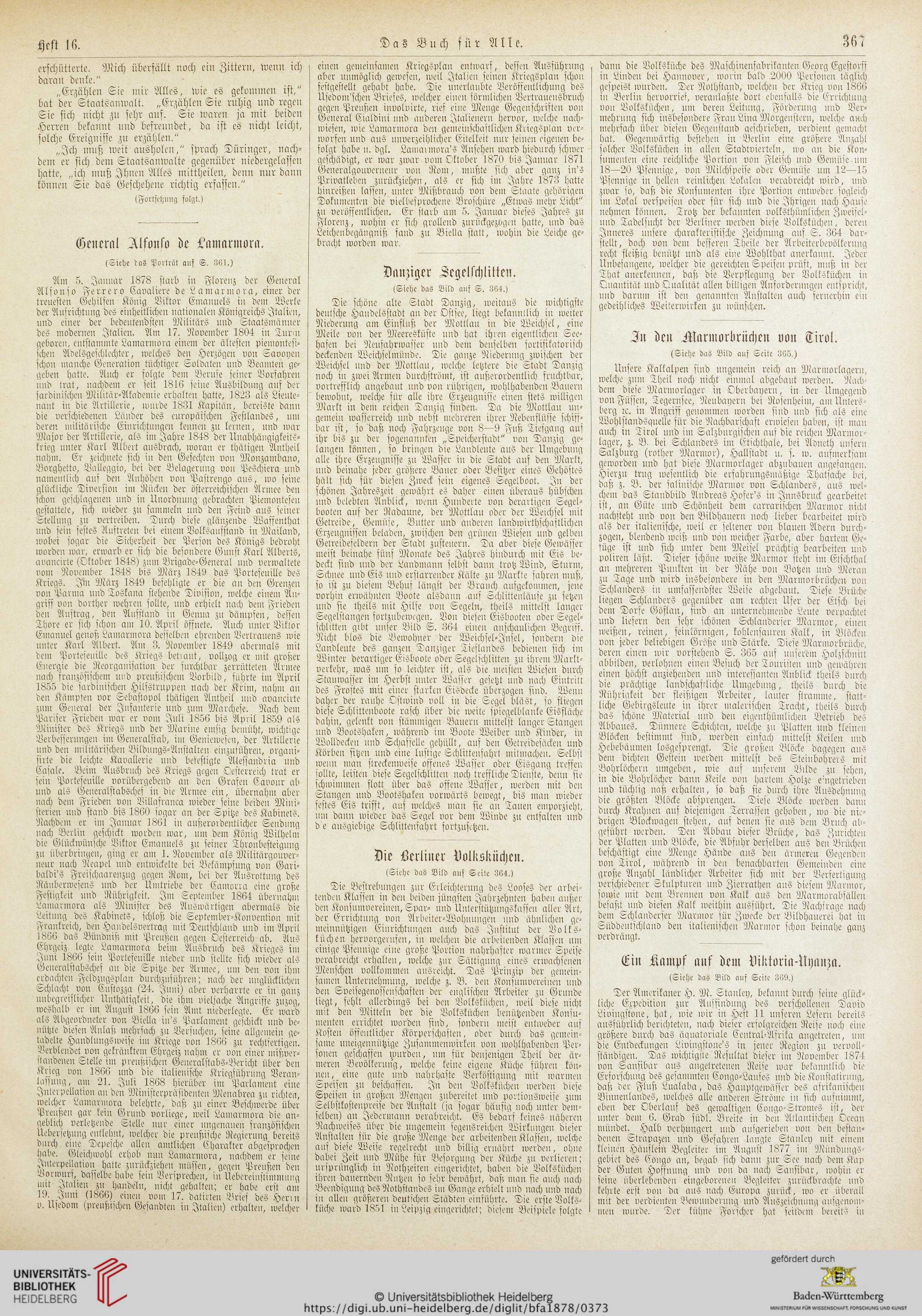M 16. __
erschütterte. Mich üb-rsällt »och ein Zittern, wenn ich
daran denke."
„Erzählen Sie nur Alles, wie es gekommen ist,"
bat der Staatsanwalt. „Erzählen Sie rnhig und regen
Sie sich nicht zu sehr aus. Sie waren ja mit beiden
Herren bekannt und befreundet, da ist es nicht leicht,
solche Ereignisse zu erzählen."
„Ich muß weit ausholen," sprach Düringer, nach-
dem er sich dem Staatsanwalte gegenüber niedergelassen
hatte, „ich muß Ihnen Alles mittheilen,denn nur dann
können Sie das Geschehene richtig erfassen."
(Fortsetzung folgt.)
General Älfonlo de Lnmarmorn.
(Siehe ras Porträt auf S. 361.)
Am 5. Jamme 1878 starb in Florenz der General
Alfonso Ferrero Cavaliere de La marmorn, einer der
treuesten Gehilfen König Viktor Emanuels in dem Werke
der Aufrichtung des einheitlichen nationalen Königreichs Italien,
und einer der bedeutendsten Militärs und Staatsmänner
des modernen Italien. Am 17. November 1804 in Tnrm
geboren, entstammte Lamarmora einem der ältesten pieinontesi-
schen Aöelsgeschlechter, welches den Herzögen von Savoyen
schon manche Generation tüchtiger Soldaten und Beamten ge-
geben hatte. Anch er folgte dem Berufe seiner Vorfahren
imd trat, nachdem er seit 1816 seine Ausbildung auf der
sardinischen Militär-Akademie erhalten hatte, 1823 als Lieute-
nant in die Artillerie, wurde 1831 Kapitän, bereiste dann
die verschiedenen Länder des europäischen Festlandes, um
deren militärische Einrichtungen kennen zu lernen, und war
Major der Artillerie, als im Jahre 1848 der Unabhängigkeits-
krieg unter Karl Albert ausbrach, woran er thätigen Antheil
nahm. Er zeichnete sich in den Gefechten von Monzambano,
Borghetto, Valleggio, bei der Belagerung von Peschiera und
namentlich auf den Anhöhen von Pastrengo aus, wo seine
glückliche Diversion im Rücken der österreichischen Armee den
schon geschlagenen und in Unordnung gebrachten Piemontesen
gestattete, sich wieder zu sammeln und den Feind aus seiner
Stellung zu vertreiben. Durch diese glänzende Waffenthat
lind sein festes Auftreten bei einem Volksaufstand in Mailand,
wobei sogar die Sicherheit der Person des Königs bedroht
worden war, erwarb er sich die besondere Gunst Karl Alberts,
avancirte (Oktober 1848) zum Brigade-General und verwaltete
vom November 1848 bis März 1849 das Portefeuille des
Kriegs. Im März 1849 befehligte er die an den Grenzen
von Parma und Toskana stehende Division, welche einem An-
griff voil dorther wehren sollte, lind erhielt nach dem Frieden
den Auftrag, den Aufstand in Genua zu dämpfen, dessen
Thore er sich schon am 10. April öffnete. Auch unter Viktor
Emanuel genoß Lamarmora desselben ehrenden Vertrauens wie
unter Karl Albert. Am 3. November 1849 abermals mit
dem Portefeuille des Kriegs betiaut, vollzog er mit großer
Energie die Reorganisation der furchtbar zerrütteten Armee
nach französischem und preußischem Vorbild, führte im April
1855 die sardinischen Hilfstruppen nach der Krim, nahm an
den Kämpfen vor Sebastopol thätigen Antheil und avancirte
znm General der Infanterie und zum Marchese. Nach dein
Pariser Frieden war er vom Juli 1856 bis April 1859 als
Minister des Kriegs lind der Marine emsig bemüht, wichtige
Verbesserungen im Generalstab, im Geniewesen, der Artillerie
und den militärischen Bildungs-Anstalien einzwühren, organi-
sirte die leichte Kavallerie und befestigte Alessandria und
Casale. Beim Ausbruch des Kriegs gegen Oesterreich trat er
sein Portefeuille vorübergebend an den Grafen Cavour ab
und als Generalstabschef in die Armee ein, übernahm aber
nach dem Frieden von Villafranca wieder seine beiden Mini-
sterien und stand bis 1860 sogar an der Spitze des Kabinets.
Nachdem er im Januar 1861 in äußeren deutlicher Sendung
nach Berlin geschickt worden war, um dem König Wilhelm
die Glückwünsche Viktor Emanuels zu seiner Thronbesteigung
zu überbringen, ging er am 1. November als Militärgouver-
neur uach Neapel und entwickelte bei Bekämpfung von Gari-
baldi's Freischaarenzug gegen Rom, bei der Ausrottung des
Nänberwesens und der Umtriebe der Camorra eine große
Festigkeit und Rührigkeit. Im September 1864 übernahm
Lamarmora als Minister des Auswärtigen abermals die
Leitung des Kabinets, schloß die September-Konvention mit
Frankreich, den Handelsvertrag mit Deutschland und im April
l866 das Bündnis; mit Preußen gegen Oesterreich ab. Aus
Ehrgeiz legte Lamarmora beim AnSbruch des Krieges im
Juni 1866 sein Portefeuille nieder und stellte sich wieder als
Generalstabschef an die Spitze der Armee, um den von ihm
erdachten Feldzugsplan durchzuführen; nach der unglücklichen
Schlacht von Cnstozza (24. Juni) aber verharrte er in ganz
unbegreiflicher Unthätigkeit, die ihm vielfache Angriffe zuzog,
weshalb er im August 1866 fein Amt niederlegte. Er ward
als Abgeordneter von Biella in's Parlament geschickt und be-
nützte diesen Anlaß mehrfach zu Versuchen, seine allgemein ge-
tadelte Handlungsweise im Kriege von 1866 zu rechtfertigen.
Verblendet von gekränktem Ehrgeiz nahm er von einer mißver-
standenen Stelle im preußischen Generalstabs-Bericht über den
Krieg von 1866 und die italienische Kriegführung Veran-
lassung, am 21. Juli 1868 hierüber im Parlament eine
Interpellation an den Ministerpräsidenten Menabrea zn richten,
welcher Lamarmora belehrte, daß zn einer Beschwerde über
Preußen gar kein Grund vorliege, weil Lamarmora die an-
geblich verletzende Stelle nur einer ungenauen französischen
Übersetzung entlehnt, welcher die preußische Regierung bereits
durch eine Depesche allen amtlichen Charakter abgesprochen
habe. Gleichwohl erhob nun Lamarmora, nachdem er seine
Interpellation hatte zurückziehen müssen, gegen Preußen den
Vornmrf, dasselbe haste sein Versprechen, in Üebereinstimmung
mit Italien zn handeln, nicht gehalten; er habe erst am
19. Juni (1866) einen vom 17. datirten Brief des Herin
v. Usedom (preußischen Gesandten in Italien) erhalten, welcher
Das Buch für Alle.
einen gemeinsamen Kriegsplan entwarf, dessen Ausführung
aber unmöglich gewesen, weil Italien seinen Kriegsplan schon
festgestellt gehabt habe. Die unerlaubte Veröffentlichung des
Usedom'schen Briefes, welcher einen förmlichen Vertrauensbrnch
gegen Preußen involvirte, rief eine Menge Gegenschriften von
General Cialdini und anderen Italienern hervor, welche nach-
wiesen, wie Lamarmora den genieinschaftlichen Kriegsplan ver-
worfen und aus unverzeihlicher Eitelkeit nur seinen eigenen be-
folgt habe n. dgl. Lamaimora's Ansehen^ward hiedurch schiver
geschädigt, er war zwar vom Oktober 1870 bis Januar 1871
Generalgouverneur von Rom, mußte sich aber ganz in's
Privatleben zurückziehen, als er sich im Jahre ll^73 hatte
hinreißen lassen, unter Mißbrauch von dem Staate gehörigen
Dokumenten die vielbesprochene Broschüre „Etwas mehr Licht"
zn veröffentlichen. Er starb am 5. Januar dieses Jahres zu
Florenz, wohin er sich grollend zurückgezogen hatte, und das
Leichenbegängnis; fand zu Biella statt, wohin die Leiche ge-
bracht worden war.
Dlllmger Zegellchlitten.
(Siehe das Bild aus S. 364.)
Die schöne alte Stadt Danzig, weitaus die wichtigste
deutsche Handelsstadt an der Ostsee, liegt bekanntlich in weiter
Niederung am Einfluß der Mottlau iu die Weichsel, eine
Meile von der Meeresküste und hat ihren eigentlichen See-
hafen bei Neufahrwasser und dem denselben fortifikatorisch
deckenden Weichselmünde. Die ganze Niederung-Wischen der
Weichsel und der Mottlan, welche letztere die Stadt Danzig
noch in zwei Armen durchströmt, ist außerordentlich fruchtbar,
vortrefflich angebaut und von rührigen, wohlhabenden Bauern
bewohnt, welche für alle ihre Erzeugnisse einen stets willigen
Markt in dem reichen Danzig finden. Da die Mottlan un-
gemein wasserreich und nebst mehreren ihrer Nebenflüsse fchiff-
star ist, so daß noch Fahrzeuge von 8—9 Fuß Tiefgang aus
ihr bis zu der sogenannten „Speicherstadt" von Danzig ge-
langen können, so bringen die Landleute aus der Umgebung
alle ihre Erzeugnisse zn Wasser in die Stadt auf den Markt,
und beinahe jeder größere Bauer oder Besitzer eines Gehöftes
hält sich für diesen Zweck sein eigenes Segelboot. In der
schönen Jahreszeit gewährt es daher einen überaus hübschen
und belebten Anblick, wenn Hunderte von derartigen Segel-
stooten auf der Radaune, der Mottlan oder der Weichsel mit
Getreide, Gemüse, Butter und anderen landwirthschaftlichen
Erzeugnissen beladen, zwischen den grünen Wiesen und gelben
Getreidefeldern der Stadt zustenern. Da aber diese Gewässer
meist beinahe fünf Monate des Jahres hindurch mit Eis ste-
deckt sind und der Landmann selbst dann trotz Wind, Sturm,
Schnee und Eis und erstarrender Kälte zu Markte fahren muß,
so ist zu diesem Behuf längst der Brauch aufgekommen, jene
vorhin erwähnten Boote alsdann ans Schlittenläuse zu setzen
und sie theils mit Hilfe von Segeln, theils mittelst langer
Segelstangen fortzubewcgen. Von diesen Eisbooten oder Segel-
schlitten gibt unser Bild S. 364 einen anschaulichen Begriff.
Nicht blos die Bewohner der Weichsel-Insel, sondern die
Landleute des ganzen Danziger Tieflandes bedienen sich im
Winter derartiger Eisboote oder Segelschlitten zu ihrem Marlt-
verkehr, was um so leichter ist, als die meisten Wiesen durch
Stauwasser im Herbst unter Wasser gesetzt und nach Eintritt
des Frostes mit einer starken Eisdecke überzogen sind. Wenn
daher der rauhe Ostwind voll in die Segel bläst, so fliegen
diese Schlittenboote rasch über die weite spiegelblanke Eisfläche
dahin, gelenkt von stämmigen Bauern mittelst langer Stangen
und Bootshaken, während im Boote Weiber nnd Kinder, in
Wolldecken und Schaffelle gehüllt, auf den Getreidesäcken nnd
Körben sitzen und eine lustige Schlittenfahrt mitmachen. Selbst
wenn man streckenweise offenes Wasser oder Eisgang treffen
sollte, leisten diese Segelschlitten noch treffliche Dienste, denn sie
schwimmen flott über das offene Wasser, werden mit den
Stangen nnd Bootshaken vorwärts bewegt, bis man wieder
festes Eis trifft, auf welches man sie an Tauen emporzieht,
um dann wieder das Segel vor dem Winde zu entfalten und
d e ausgiebige Schlittenfahrt fortzufctzen.
Oie berliner Volksküchen.
(Siehe das Bild auf Seile 364.)
Die Bestrebungen zur Erleichterung des Looses der arbei-
tenden Klassen in den beiden jüngsten Jahrzehnten haben außer
den Konsumvereinen, Spar- nnd Unterstütznngskassen aller Art,
der Errichtung von Arbeiter-Wohnungen nnd ähnlichen ge-
meinnützigen Einrichtungen auch das Institut der Volks-
küchen hervorgerufen, in welchen die arbeitenden Klassen um
einige Pfennige eine große Portion nahrhafter warmer speise
verabreicht erhalten, welche zur Sättigung eines erwachsenen
Menschen vollkommen ausreicht. Das Prinzip der gemein-
samen Unternehmung, welche z. B. den Konsumvereinen und
den Sveisegenossenschasten der englischen Arbeiter zu Grunde
liegt, fehlt allerdings bei den Volksküchen, weil diese nicht
mit den Mitteln der die Volksküchen benützenden Konsu-
menten errichtet worden sind, sondern meist entweder auf
Kosten öffentlicher Körperschaften, oder durch das gemein-
same uneigennützige Zusammenwirken von wohlhabenden Per-
sonen geschaffen wurden, nm für denjenigen Theil der är-
meren Bevölkerung, welche keine eigene Küche führen kön-
nen,, eine gute und nahrhafte Verköstigung mit warmen
Speisen zu beschaffen. In den Volksküchen werden diese
Speisen in großen Biengen znbereitet nnd portionsweise znm
Selbstkostenpreise der Anstalt (ja sogar häufig noch unter dem-
selben) an Jedermann verabreicht. Es bedarf keines näheren
Nachweises über die ungemein segensreichen Wirkungen dieser
Anstalten für die große Menge der arbeitenden Klassen, welche
auf diese Weise regelrecht nud billig ernährt werden, ohne
dastei Zeit und Blühe sür Besorgung der Küche zu verlieren;
ursprünglich in Nothzeiteu eingerichtet, haben die Volksküchen
ihren dauernden Nutzen so sehr stewährt, daß man sie auch nach
Beendigung des Nothstandes im Gange erhielt und nach und nach
in allen größeren deutschen Städten einführte. Die erste Volks-
küche ward 1851 in Leipzig eingerichtet; diesem Beispiele folgte
367
dann die Volksküche des Maschinenfabrikanten Georg Egestorfs
in Linden bei Hannover, worin bald 2000 Personen täglich
gespeist wurden. Der Nothstand, welchen der Krieg von 1866
in Berlin hervorrief, veranlaßte dort ebenfalls die Errichtung
von Volksküchen, nm deren Leitung, Förderung und Ver-
mehrung sich insbesondere Fran Lina Morgenstern, welche anch
mehrfach über diesen Gegenstand geschrieben, verdient gemacht
hat. Gegenwärtig bestehen rn Berlin eine größere Anzahl
solcher Volksküchen in allen Stadtvierteln, wo an die Kon-
sumenten eine reichliche Portion von Fleisch und Gemüse um
18—20 Pfennige, von Milchspeise oder Gemüse um 12—15
Pfennige in Hellen reinlichen Lokalen verabreicht wird, und
zwar so, daß die Konsumenten ihre Portion entweder sogleich
im Lokal verspeisen oder für sich und die Ihrigen nach Hause
nehmen können. Trotz der bekannten volksthümlichen Zweifel-
und Tadelsucht der Berliner werden diese Volksküchen, deren
Inneres unsere charakteristische Zeichnung auf S. 364 dar-
stellt, doch von dem besseren Theile der Arbeiterbevölkernng
recht fleißig benützt und als eine Wohlthat anerkannt. Jeder
Unbefangene, welcher die gereichten Speisen prüft, muß in der
That anerkennen, daß die Verpflegung der Volksküchen in
Quantität nnd Qualität allen billigen Anforderungen entspricht,
und darum ist den genannten Anstalten anch fernerhin ein
gedeihliches Weiterwirken zu wünschen.
In deil Mtmnorbrilcheil von Tirol.
(Siehe das Bild auf Seite 365.)
Unsere Kalkalpen sind ungemein reich an Marmorlagern,
welche znm Theil noch nicht einmal abgebant werden. Nach-
dem diese Marmorlager in Oberbayern, in der Umgegend
von Füssen, Tegernsee, Neubayern bei Rosenheim, am Unters-
berg rc. in Angriff genommen worden sind und sich als eine
Wohlstandsquelle für die Nachbarschaft erwiesen haben, ist man
auch in Tirol und im Salzburgischen auf die reichen Marmor-
lager, z. B. bei Schlanders im Etschthale, bei Aoneth unfern
Salzstnrg (rother Marmor), Hallstadt u. s. w. aufmerksam
geworden und hat diese Marmorlager abzubanen angefangen.
Hierzu trug wesentlich die erfahrnngsmäßige Thatfache bei,
daß z. B. der salinische Marmor von Schlanders, aus wei-
chem das Standbild Andreas Hofer's in Innsbruck gearbeitet
ist, an Güte und Schönheit dem carrarischen Marmor nicht
nachsteht und von den Bildhauern noch lieber bearbeitet wird
als der italienische, weil er seltener von blauen Adern durch-
zogen, blendend weiß und von weicher Farbe, aber hartem Ge-
füge ist und sich unter dem Meisel prächtig bearbeiten und
poliren läßt. Dieser schöne weiße Marmor steht im Etschthal
an mehreren Punkten in der Nähe von Botzen und Meran
zu Tage und wird insbesondere in den Marmorbrüchen von
Schlanders in umfassendster Weise abgebaut. Diese Brüche
liegen Schlanders gegenüber am rechten Ufer der Etsch bei
dem Dorfe Göflan, sind an unternehmende Leute verpachtet
und liefern den sehr schönen Schlanderser Marmor, einen
weißen, reinen, feinkörnigen, kohlensauren Kalk, in Blöcken
von jeder beliebigen Größe und Stärke. Diese Maruwrbrüche,
deren einen wir vorstehend S. 365 auf unserem Holzschnitt
abbilden, verlohnen einen Besuch der Touristen und gewähren
einen höchst anziehenden nnd interessanten Anblick theils durch
die prächtige landschaftliche Umgebung, theils durch die
Rührigkeit der fleißigen Arbeiter, lauter stramme, statt-
liche Gebirgsleute in ihrer malerischen Tracht, theils durch
das schöne Material nnd den eigenthümlichen Betrieb deS
Abbaues. Dünnere Schichten, welche zn Platten und kleinen
Blöcken bestimmt sind, werden einfach mittelst Keilen und
Hebebänmen losgesprengt. Die großen Blöcke dagegen ans
dem dichten Gestein werden mittelst des Steinbohrers mit
Bohrlöchern umgeben, wie auf unserem Bilde zu sehen,
in die Bohrlöcher dann Keile von hartem Holze emgetrieben
und tüchtig naß erhalten, so daß sie durch ihre Ausdehnung
die größten Blöcke absprengen. Diese Blöcke werden dann
durch Krahnen auf diejenigen Terrassen gehoben, wo die nie-
drigen Blockwagen stehen, auf denen sie ans dem Bruch ab-
gesührt werden. Den Abbau dieser Brüche, das Zurichten
der Platten nnd Blöcke, die Abfuhr derselben aus den Brüchen
beschäftigt eine Menge Hände aus den ärmeren Gegenden
von Tirol, während in den benachbarten Gemeinden eine
große Anzahl^ländlicher Arbeiter sich mit der Verfertigung
verschiedener Skulpturen und Zierrathen aus diesem Marmor,
sowie mit dem Brennen von Kalk aus den Marmorabfällen
stefaßt und diesen Kalk weithin ansführt. Tie Nachfrage nach
dem Schlanderser Marmor sür Zwecke der Bildhauerei hat in
Süddentschlanö den italienischen Marmor schon beinahe ganz
verdrängt. _
Lin Kampf auf dem Mtona-NyanM.
(Siehe das Bild auf Seite 369.)
Der Amerikaner H. M. Stanley, bekannt durch seine glück-
liche Expedition zur Auffindung des verschollenen David
Livingstone, hat, wie nur in Heft 11 unseren Lesern bereits
ausführlich berichteten, nach dieser erfolgreichen Reise noch eine
größere durch das äquatoriale Central-Afrika angetreten, um
die Entdeckungen Livingstone's in jener Region zn vervoll-
ständigen. Das wichtigste Resultat dieser im November 1874
von Sansibar aus angetretenen Reise war bekanntlich die
Erforschung des gesummten Congo-Lauses nnd die Konstatirnng,
daß der Flnß Lualabn, das Hanptgewässer des afrikanischen
Binnenlandes, welches alle anderen Ströme in sich aufnimmt,
eben der Oberlauf des gewaltigen Congo-stromes ist, der
unter dem 6. Grad südl. Breite in den Atlantischen Ocean
mündet. Halb verhungert nnd aufgerieben von den bestan-
denen Strapazen nnd Gefahren langte Stanley mit einem
kleinen Häuflein Begleiter im August 1877 im Mündungs-
gebiet des Congo an, begab sich dann zM-See nach dem Kap
der Guten Hoffnung und von da nach Sansibar, wohin er
seine überlebenden eingeborenen Begleiter zurückbrachte und
kehlte erst von da aus uach Europa zurück, wo er überall
mit der verdienten Bewunderung und Auszeichnung ausgenom-
men wurde. Der kühne Forscher hat seitdem bereits in
erschütterte. Mich üb-rsällt »och ein Zittern, wenn ich
daran denke."
„Erzählen Sie nur Alles, wie es gekommen ist,"
bat der Staatsanwalt. „Erzählen Sie rnhig und regen
Sie sich nicht zu sehr aus. Sie waren ja mit beiden
Herren bekannt und befreundet, da ist es nicht leicht,
solche Ereignisse zu erzählen."
„Ich muß weit ausholen," sprach Düringer, nach-
dem er sich dem Staatsanwalte gegenüber niedergelassen
hatte, „ich muß Ihnen Alles mittheilen,denn nur dann
können Sie das Geschehene richtig erfassen."
(Fortsetzung folgt.)
General Älfonlo de Lnmarmorn.
(Siehe ras Porträt auf S. 361.)
Am 5. Jamme 1878 starb in Florenz der General
Alfonso Ferrero Cavaliere de La marmorn, einer der
treuesten Gehilfen König Viktor Emanuels in dem Werke
der Aufrichtung des einheitlichen nationalen Königreichs Italien,
und einer der bedeutendsten Militärs und Staatsmänner
des modernen Italien. Am 17. November 1804 in Tnrm
geboren, entstammte Lamarmora einem der ältesten pieinontesi-
schen Aöelsgeschlechter, welches den Herzögen von Savoyen
schon manche Generation tüchtiger Soldaten und Beamten ge-
geben hatte. Anch er folgte dem Berufe seiner Vorfahren
imd trat, nachdem er seit 1816 seine Ausbildung auf der
sardinischen Militär-Akademie erhalten hatte, 1823 als Lieute-
nant in die Artillerie, wurde 1831 Kapitän, bereiste dann
die verschiedenen Länder des europäischen Festlandes, um
deren militärische Einrichtungen kennen zu lernen, und war
Major der Artillerie, als im Jahre 1848 der Unabhängigkeits-
krieg unter Karl Albert ausbrach, woran er thätigen Antheil
nahm. Er zeichnete sich in den Gefechten von Monzambano,
Borghetto, Valleggio, bei der Belagerung von Peschiera und
namentlich auf den Anhöhen von Pastrengo aus, wo seine
glückliche Diversion im Rücken der österreichischen Armee den
schon geschlagenen und in Unordnung gebrachten Piemontesen
gestattete, sich wieder zu sammeln und den Feind aus seiner
Stellung zu vertreiben. Durch diese glänzende Waffenthat
lind sein festes Auftreten bei einem Volksaufstand in Mailand,
wobei sogar die Sicherheit der Person des Königs bedroht
worden war, erwarb er sich die besondere Gunst Karl Alberts,
avancirte (Oktober 1848) zum Brigade-General und verwaltete
vom November 1848 bis März 1849 das Portefeuille des
Kriegs. Im März 1849 befehligte er die an den Grenzen
von Parma und Toskana stehende Division, welche einem An-
griff voil dorther wehren sollte, lind erhielt nach dem Frieden
den Auftrag, den Aufstand in Genua zu dämpfen, dessen
Thore er sich schon am 10. April öffnete. Auch unter Viktor
Emanuel genoß Lamarmora desselben ehrenden Vertrauens wie
unter Karl Albert. Am 3. November 1849 abermals mit
dem Portefeuille des Kriegs betiaut, vollzog er mit großer
Energie die Reorganisation der furchtbar zerrütteten Armee
nach französischem und preußischem Vorbild, führte im April
1855 die sardinischen Hilfstruppen nach der Krim, nahm an
den Kämpfen vor Sebastopol thätigen Antheil und avancirte
znm General der Infanterie und zum Marchese. Nach dein
Pariser Frieden war er vom Juli 1856 bis April 1859 als
Minister des Kriegs lind der Marine emsig bemüht, wichtige
Verbesserungen im Generalstab, im Geniewesen, der Artillerie
und den militärischen Bildungs-Anstalien einzwühren, organi-
sirte die leichte Kavallerie und befestigte Alessandria und
Casale. Beim Ausbruch des Kriegs gegen Oesterreich trat er
sein Portefeuille vorübergebend an den Grafen Cavour ab
und als Generalstabschef in die Armee ein, übernahm aber
nach dem Frieden von Villafranca wieder seine beiden Mini-
sterien und stand bis 1860 sogar an der Spitze des Kabinets.
Nachdem er im Januar 1861 in äußeren deutlicher Sendung
nach Berlin geschickt worden war, um dem König Wilhelm
die Glückwünsche Viktor Emanuels zu seiner Thronbesteigung
zu überbringen, ging er am 1. November als Militärgouver-
neur uach Neapel und entwickelte bei Bekämpfung von Gari-
baldi's Freischaarenzug gegen Rom, bei der Ausrottung des
Nänberwesens und der Umtriebe der Camorra eine große
Festigkeit und Rührigkeit. Im September 1864 übernahm
Lamarmora als Minister des Auswärtigen abermals die
Leitung des Kabinets, schloß die September-Konvention mit
Frankreich, den Handelsvertrag mit Deutschland und im April
l866 das Bündnis; mit Preußen gegen Oesterreich ab. Aus
Ehrgeiz legte Lamarmora beim AnSbruch des Krieges im
Juni 1866 sein Portefeuille nieder und stellte sich wieder als
Generalstabschef an die Spitze der Armee, um den von ihm
erdachten Feldzugsplan durchzuführen; nach der unglücklichen
Schlacht von Cnstozza (24. Juni) aber verharrte er in ganz
unbegreiflicher Unthätigkeit, die ihm vielfache Angriffe zuzog,
weshalb er im August 1866 fein Amt niederlegte. Er ward
als Abgeordneter von Biella in's Parlament geschickt und be-
nützte diesen Anlaß mehrfach zu Versuchen, seine allgemein ge-
tadelte Handlungsweise im Kriege von 1866 zu rechtfertigen.
Verblendet von gekränktem Ehrgeiz nahm er von einer mißver-
standenen Stelle im preußischen Generalstabs-Bericht über den
Krieg von 1866 und die italienische Kriegführung Veran-
lassung, am 21. Juli 1868 hierüber im Parlament eine
Interpellation an den Ministerpräsidenten Menabrea zn richten,
welcher Lamarmora belehrte, daß zn einer Beschwerde über
Preußen gar kein Grund vorliege, weil Lamarmora die an-
geblich verletzende Stelle nur einer ungenauen französischen
Übersetzung entlehnt, welcher die preußische Regierung bereits
durch eine Depesche allen amtlichen Charakter abgesprochen
habe. Gleichwohl erhob nun Lamarmora, nachdem er seine
Interpellation hatte zurückziehen müssen, gegen Preußen den
Vornmrf, dasselbe haste sein Versprechen, in Üebereinstimmung
mit Italien zn handeln, nicht gehalten; er habe erst am
19. Juni (1866) einen vom 17. datirten Brief des Herin
v. Usedom (preußischen Gesandten in Italien) erhalten, welcher
Das Buch für Alle.
einen gemeinsamen Kriegsplan entwarf, dessen Ausführung
aber unmöglich gewesen, weil Italien seinen Kriegsplan schon
festgestellt gehabt habe. Die unerlaubte Veröffentlichung des
Usedom'schen Briefes, welcher einen förmlichen Vertrauensbrnch
gegen Preußen involvirte, rief eine Menge Gegenschriften von
General Cialdini und anderen Italienern hervor, welche nach-
wiesen, wie Lamarmora den genieinschaftlichen Kriegsplan ver-
worfen und aus unverzeihlicher Eitelkeit nur seinen eigenen be-
folgt habe n. dgl. Lamaimora's Ansehen^ward hiedurch schiver
geschädigt, er war zwar vom Oktober 1870 bis Januar 1871
Generalgouverneur von Rom, mußte sich aber ganz in's
Privatleben zurückziehen, als er sich im Jahre ll^73 hatte
hinreißen lassen, unter Mißbrauch von dem Staate gehörigen
Dokumenten die vielbesprochene Broschüre „Etwas mehr Licht"
zn veröffentlichen. Er starb am 5. Januar dieses Jahres zu
Florenz, wohin er sich grollend zurückgezogen hatte, und das
Leichenbegängnis; fand zu Biella statt, wohin die Leiche ge-
bracht worden war.
Dlllmger Zegellchlitten.
(Siehe das Bild aus S. 364.)
Die schöne alte Stadt Danzig, weitaus die wichtigste
deutsche Handelsstadt an der Ostsee, liegt bekanntlich in weiter
Niederung am Einfluß der Mottlau iu die Weichsel, eine
Meile von der Meeresküste und hat ihren eigentlichen See-
hafen bei Neufahrwasser und dem denselben fortifikatorisch
deckenden Weichselmünde. Die ganze Niederung-Wischen der
Weichsel und der Mottlan, welche letztere die Stadt Danzig
noch in zwei Armen durchströmt, ist außerordentlich fruchtbar,
vortrefflich angebaut und von rührigen, wohlhabenden Bauern
bewohnt, welche für alle ihre Erzeugnisse einen stets willigen
Markt in dem reichen Danzig finden. Da die Mottlan un-
gemein wasserreich und nebst mehreren ihrer Nebenflüsse fchiff-
star ist, so daß noch Fahrzeuge von 8—9 Fuß Tiefgang aus
ihr bis zu der sogenannten „Speicherstadt" von Danzig ge-
langen können, so bringen die Landleute aus der Umgebung
alle ihre Erzeugnisse zn Wasser in die Stadt auf den Markt,
und beinahe jeder größere Bauer oder Besitzer eines Gehöftes
hält sich für diesen Zweck sein eigenes Segelboot. In der
schönen Jahreszeit gewährt es daher einen überaus hübschen
und belebten Anblick, wenn Hunderte von derartigen Segel-
stooten auf der Radaune, der Mottlan oder der Weichsel mit
Getreide, Gemüse, Butter und anderen landwirthschaftlichen
Erzeugnissen beladen, zwischen den grünen Wiesen und gelben
Getreidefeldern der Stadt zustenern. Da aber diese Gewässer
meist beinahe fünf Monate des Jahres hindurch mit Eis ste-
deckt sind und der Landmann selbst dann trotz Wind, Sturm,
Schnee und Eis und erstarrender Kälte zu Markte fahren muß,
so ist zu diesem Behuf längst der Brauch aufgekommen, jene
vorhin erwähnten Boote alsdann ans Schlittenläuse zu setzen
und sie theils mit Hilfe von Segeln, theils mittelst langer
Segelstangen fortzubewcgen. Von diesen Eisbooten oder Segel-
schlitten gibt unser Bild S. 364 einen anschaulichen Begriff.
Nicht blos die Bewohner der Weichsel-Insel, sondern die
Landleute des ganzen Danziger Tieflandes bedienen sich im
Winter derartiger Eisboote oder Segelschlitten zu ihrem Marlt-
verkehr, was um so leichter ist, als die meisten Wiesen durch
Stauwasser im Herbst unter Wasser gesetzt und nach Eintritt
des Frostes mit einer starken Eisdecke überzogen sind. Wenn
daher der rauhe Ostwind voll in die Segel bläst, so fliegen
diese Schlittenboote rasch über die weite spiegelblanke Eisfläche
dahin, gelenkt von stämmigen Bauern mittelst langer Stangen
und Bootshaken, während im Boote Weiber nnd Kinder, in
Wolldecken und Schaffelle gehüllt, auf den Getreidesäcken nnd
Körben sitzen und eine lustige Schlittenfahrt mitmachen. Selbst
wenn man streckenweise offenes Wasser oder Eisgang treffen
sollte, leisten diese Segelschlitten noch treffliche Dienste, denn sie
schwimmen flott über das offene Wasser, werden mit den
Stangen nnd Bootshaken vorwärts bewegt, bis man wieder
festes Eis trifft, auf welches man sie an Tauen emporzieht,
um dann wieder das Segel vor dem Winde zu entfalten und
d e ausgiebige Schlittenfahrt fortzufctzen.
Oie berliner Volksküchen.
(Siehe das Bild auf Seile 364.)
Die Bestrebungen zur Erleichterung des Looses der arbei-
tenden Klassen in den beiden jüngsten Jahrzehnten haben außer
den Konsumvereinen, Spar- nnd Unterstütznngskassen aller Art,
der Errichtung von Arbeiter-Wohnungen nnd ähnlichen ge-
meinnützigen Einrichtungen auch das Institut der Volks-
küchen hervorgerufen, in welchen die arbeitenden Klassen um
einige Pfennige eine große Portion nahrhafter warmer speise
verabreicht erhalten, welche zur Sättigung eines erwachsenen
Menschen vollkommen ausreicht. Das Prinzip der gemein-
samen Unternehmung, welche z. B. den Konsumvereinen und
den Sveisegenossenschasten der englischen Arbeiter zu Grunde
liegt, fehlt allerdings bei den Volksküchen, weil diese nicht
mit den Mitteln der die Volksküchen benützenden Konsu-
menten errichtet worden sind, sondern meist entweder auf
Kosten öffentlicher Körperschaften, oder durch das gemein-
same uneigennützige Zusammenwirken von wohlhabenden Per-
sonen geschaffen wurden, nm für denjenigen Theil der är-
meren Bevölkerung, welche keine eigene Küche führen kön-
nen,, eine gute und nahrhafte Verköstigung mit warmen
Speisen zu beschaffen. In den Volksküchen werden diese
Speisen in großen Biengen znbereitet nnd portionsweise znm
Selbstkostenpreise der Anstalt (ja sogar häufig noch unter dem-
selben) an Jedermann verabreicht. Es bedarf keines näheren
Nachweises über die ungemein segensreichen Wirkungen dieser
Anstalten für die große Menge der arbeitenden Klassen, welche
auf diese Weise regelrecht nud billig ernährt werden, ohne
dastei Zeit und Blühe sür Besorgung der Küche zu verlieren;
ursprünglich in Nothzeiteu eingerichtet, haben die Volksküchen
ihren dauernden Nutzen so sehr stewährt, daß man sie auch nach
Beendigung des Nothstandes im Gange erhielt und nach und nach
in allen größeren deutschen Städten einführte. Die erste Volks-
küche ward 1851 in Leipzig eingerichtet; diesem Beispiele folgte
367
dann die Volksküche des Maschinenfabrikanten Georg Egestorfs
in Linden bei Hannover, worin bald 2000 Personen täglich
gespeist wurden. Der Nothstand, welchen der Krieg von 1866
in Berlin hervorrief, veranlaßte dort ebenfalls die Errichtung
von Volksküchen, nm deren Leitung, Förderung und Ver-
mehrung sich insbesondere Fran Lina Morgenstern, welche anch
mehrfach über diesen Gegenstand geschrieben, verdient gemacht
hat. Gegenwärtig bestehen rn Berlin eine größere Anzahl
solcher Volksküchen in allen Stadtvierteln, wo an die Kon-
sumenten eine reichliche Portion von Fleisch und Gemüse um
18—20 Pfennige, von Milchspeise oder Gemüse um 12—15
Pfennige in Hellen reinlichen Lokalen verabreicht wird, und
zwar so, daß die Konsumenten ihre Portion entweder sogleich
im Lokal verspeisen oder für sich und die Ihrigen nach Hause
nehmen können. Trotz der bekannten volksthümlichen Zweifel-
und Tadelsucht der Berliner werden diese Volksküchen, deren
Inneres unsere charakteristische Zeichnung auf S. 364 dar-
stellt, doch von dem besseren Theile der Arbeiterbevölkernng
recht fleißig benützt und als eine Wohlthat anerkannt. Jeder
Unbefangene, welcher die gereichten Speisen prüft, muß in der
That anerkennen, daß die Verpflegung der Volksküchen in
Quantität nnd Qualität allen billigen Anforderungen entspricht,
und darum ist den genannten Anstalten anch fernerhin ein
gedeihliches Weiterwirken zu wünschen.
In deil Mtmnorbrilcheil von Tirol.
(Siehe das Bild auf Seite 365.)
Unsere Kalkalpen sind ungemein reich an Marmorlagern,
welche znm Theil noch nicht einmal abgebant werden. Nach-
dem diese Marmorlager in Oberbayern, in der Umgegend
von Füssen, Tegernsee, Neubayern bei Rosenheim, am Unters-
berg rc. in Angriff genommen worden sind und sich als eine
Wohlstandsquelle für die Nachbarschaft erwiesen haben, ist man
auch in Tirol und im Salzburgischen auf die reichen Marmor-
lager, z. B. bei Schlanders im Etschthale, bei Aoneth unfern
Salzstnrg (rother Marmor), Hallstadt u. s. w. aufmerksam
geworden und hat diese Marmorlager abzubanen angefangen.
Hierzu trug wesentlich die erfahrnngsmäßige Thatfache bei,
daß z. B. der salinische Marmor von Schlanders, aus wei-
chem das Standbild Andreas Hofer's in Innsbruck gearbeitet
ist, an Güte und Schönheit dem carrarischen Marmor nicht
nachsteht und von den Bildhauern noch lieber bearbeitet wird
als der italienische, weil er seltener von blauen Adern durch-
zogen, blendend weiß und von weicher Farbe, aber hartem Ge-
füge ist und sich unter dem Meisel prächtig bearbeiten und
poliren läßt. Dieser schöne weiße Marmor steht im Etschthal
an mehreren Punkten in der Nähe von Botzen und Meran
zu Tage und wird insbesondere in den Marmorbrüchen von
Schlanders in umfassendster Weise abgebaut. Diese Brüche
liegen Schlanders gegenüber am rechten Ufer der Etsch bei
dem Dorfe Göflan, sind an unternehmende Leute verpachtet
und liefern den sehr schönen Schlanderser Marmor, einen
weißen, reinen, feinkörnigen, kohlensauren Kalk, in Blöcken
von jeder beliebigen Größe und Stärke. Diese Maruwrbrüche,
deren einen wir vorstehend S. 365 auf unserem Holzschnitt
abbilden, verlohnen einen Besuch der Touristen und gewähren
einen höchst anziehenden nnd interessanten Anblick theils durch
die prächtige landschaftliche Umgebung, theils durch die
Rührigkeit der fleißigen Arbeiter, lauter stramme, statt-
liche Gebirgsleute in ihrer malerischen Tracht, theils durch
das schöne Material nnd den eigenthümlichen Betrieb deS
Abbaues. Dünnere Schichten, welche zn Platten und kleinen
Blöcken bestimmt sind, werden einfach mittelst Keilen und
Hebebänmen losgesprengt. Die großen Blöcke dagegen ans
dem dichten Gestein werden mittelst des Steinbohrers mit
Bohrlöchern umgeben, wie auf unserem Bilde zu sehen,
in die Bohrlöcher dann Keile von hartem Holze emgetrieben
und tüchtig naß erhalten, so daß sie durch ihre Ausdehnung
die größten Blöcke absprengen. Diese Blöcke werden dann
durch Krahnen auf diejenigen Terrassen gehoben, wo die nie-
drigen Blockwagen stehen, auf denen sie ans dem Bruch ab-
gesührt werden. Den Abbau dieser Brüche, das Zurichten
der Platten nnd Blöcke, die Abfuhr derselben aus den Brüchen
beschäftigt eine Menge Hände aus den ärmeren Gegenden
von Tirol, während in den benachbarten Gemeinden eine
große Anzahl^ländlicher Arbeiter sich mit der Verfertigung
verschiedener Skulpturen und Zierrathen aus diesem Marmor,
sowie mit dem Brennen von Kalk aus den Marmorabfällen
stefaßt und diesen Kalk weithin ansführt. Tie Nachfrage nach
dem Schlanderser Marmor sür Zwecke der Bildhauerei hat in
Süddentschlanö den italienischen Marmor schon beinahe ganz
verdrängt. _
Lin Kampf auf dem Mtona-NyanM.
(Siehe das Bild auf Seite 369.)
Der Amerikaner H. M. Stanley, bekannt durch seine glück-
liche Expedition zur Auffindung des verschollenen David
Livingstone, hat, wie nur in Heft 11 unseren Lesern bereits
ausführlich berichteten, nach dieser erfolgreichen Reise noch eine
größere durch das äquatoriale Central-Afrika angetreten, um
die Entdeckungen Livingstone's in jener Region zn vervoll-
ständigen. Das wichtigste Resultat dieser im November 1874
von Sansibar aus angetretenen Reise war bekanntlich die
Erforschung des gesummten Congo-Lauses nnd die Konstatirnng,
daß der Flnß Lualabn, das Hanptgewässer des afrikanischen
Binnenlandes, welches alle anderen Ströme in sich aufnimmt,
eben der Oberlauf des gewaltigen Congo-stromes ist, der
unter dem 6. Grad südl. Breite in den Atlantischen Ocean
mündet. Halb verhungert nnd aufgerieben von den bestan-
denen Strapazen nnd Gefahren langte Stanley mit einem
kleinen Häuflein Begleiter im August 1877 im Mündungs-
gebiet des Congo an, begab sich dann zM-See nach dem Kap
der Guten Hoffnung und von da nach Sansibar, wohin er
seine überlebenden eingeborenen Begleiter zurückbrachte und
kehlte erst von da aus uach Europa zurück, wo er überall
mit der verdienten Bewunderung und Auszeichnung ausgenom-
men wurde. Der kühne Forscher hat seitdem bereits in