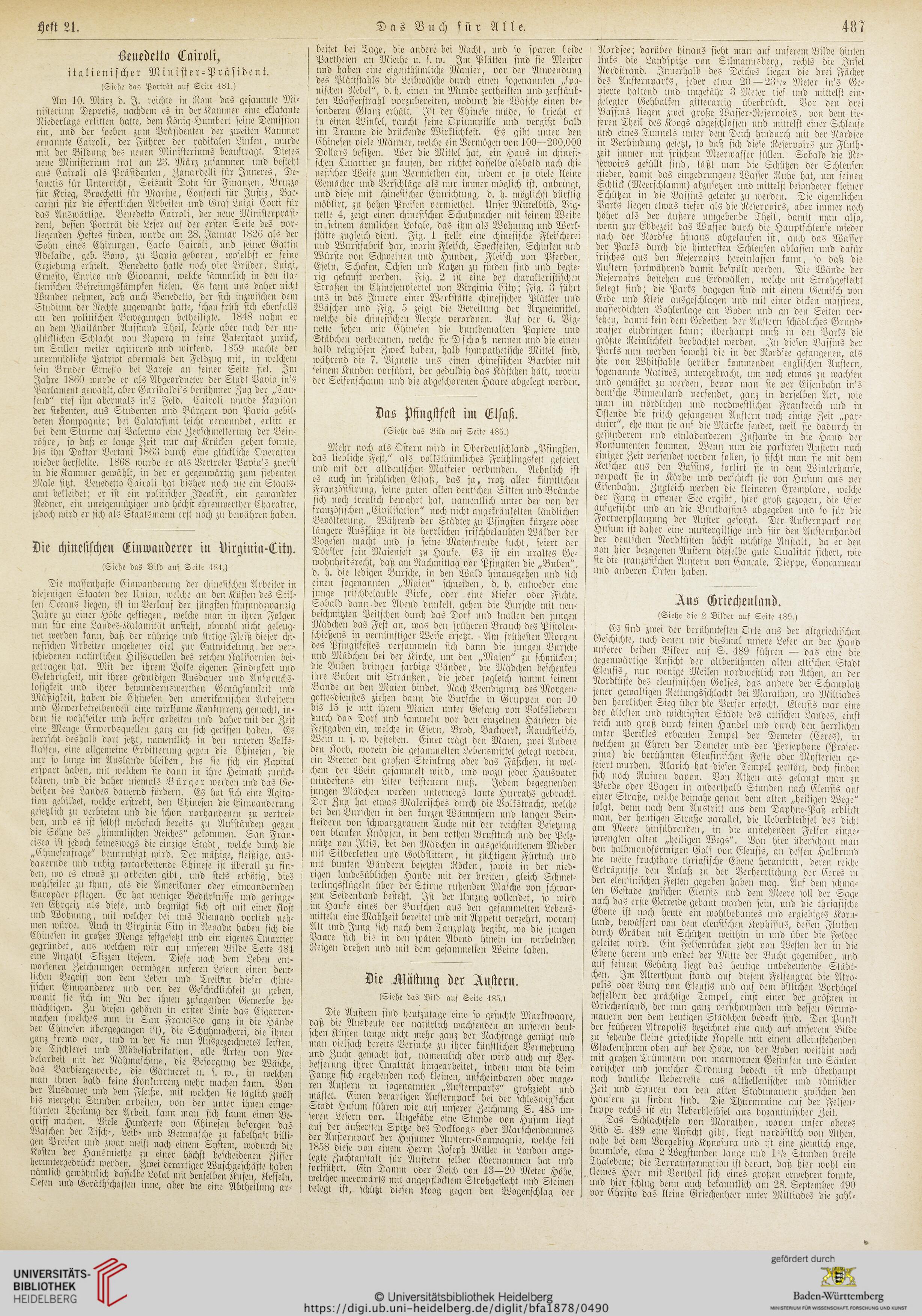Heft 2l.
Deuedetto Cniroll^
italienischer Minister-Präsident.
(Siehe das Porträt auf Scite 481.)
Ain 10. Marz d. I. reichte in Nam das gesnmmte Mi-
nisterium Depretis, nachdem cs in der Kammer eine eklatante
Niederlage erlitten hatte, dem König Humbert seine Demisnon
ein, und der soeben zum Präsidenten der zwecken Kammer
ernannte Cairoli, der Führer der radikalen Linken, wurde
niit der Bildung des neuen Ministeriums beauftragt. Dieses
neue Ministerium trat am 23. März zusammen nnd besteht
ans Cairoli als Präsidenten, Zanardelli für Inneres, De-
sauctis für Unterricht, Seismit Dota für Finanzen, Brnzzo
für Krieg, Brocchetti für Marine, Conforti für Justiz, Bac-
carini für die öffentlichen Arbeiten nnd Graf Luigi Corti für
das Auswärtige. Beiredetto Cairoli, der nene^Ministerpräst-
dent, dessen Porträt die Leser ans der ersten Seite des vor-
liegenden Heftes finden, wurde am 28. Januar 1826 als der
Sohn eines Chirurgen, Carlo Cairoli, nnd feiner Gattin
Adelaide, geb. Bono, zu Pavia geboren, woselbst er feine
Crziehnng erhielt. Benedetto hatte noch vier Brüder, Luigi,
Ernesto, Enrico nnd Giovanni, welche fämmtlich in den ita-
lienischen Befreiungskämpfen fielen. Es kanu uns daher nicht
Wunder nehmen, daß mich Benedetto, der sich inzwischen dem
Studium der Rechte zugewandt hatte, schon früh sich ebenfalls
an den politischen Bewegungen betheiligte. 1848 nahm er
an dem Mailänder Ausstand Theil, kehrte aber nach der un-
glücklichen Schlacht von Novara m feine Vaterstadt zurück,
im Stillen weiter agitirend und wirkend. 1859 machte der
unermüdliche Patriot abermals den Feldzug mit, in welchem
fein Brnder Ernesto bei Varese an feiner Seite fiel, ^m
Jahre 1860 wurde er als Abgeordneter der Stadt PaviaPn's
Parlament gewählt, aber Garibaldi's berühmter Zug decf „Tau-
send" rief ihn abermals in's Feld. Cairoli wurde Kapitän
der siebenten, aus Studenten und Bürgern von Pavia gebil-
deten Kompagnie; bei Calatafimi leicht verwundet, erlitt er
bei dem Sturme auf Palermo eine Zerschmetterung der Bein-
röhre, so das; er lange Zeit nur auf Krücken gehen konnte,
bis ihn Doktor Bcrtani 1863 durch eine glückliche Operation
wieder herstellte. 1868 wurde er als Vertreter Pavia's zuerst
in die Kammer gewählt, in der er gegenwärtig zum siebenten
Male sitzt. Benedetto Cairoli hat bisher noch nie ein Staats-
amt bekleidet; er ist ein politischer Idealist, ein gewandter
Redner, ein uneigennütziger und höchst ehrenwerther Charakter,
jedoch wird er sich als Staatsmann erst noch zn bewähren haben.
Die chinesischen Einwanderer in Dirginia-Lity.
(Siehe das Bild auf Scite 484.)
Die massenhafte Einwanderung der chinesischen Arbeiter in
diejenigen Staaten der Union, welche an den Küsten des Stil-
len Oceans liegen, ist im Verlauf der jüngsten fünfundzwanzig
Jahre zu einer Höhe gestiegen, welche man in ihren Folgen
nnn für eine Landes-Kalamität anfieht, obwohl nicht geleug-
net werden kann, daß der rührige und stetige Fleis; dieser chi-
nesischen Arbeiter ungeheuer viel zur Entwickelung , der ver-
schiedenen natürlichen Hilfsquellen des reichen Kalifornien bei-
getragen hat. Mit der ihrem Volke eigenen Findigkeit und
Gelehrigkeit, mit ihrer geduldigen Ausdauer nnd Anspruchs-
losigkeit und ihrer bewundernswerthen Genügsamkeit und
Mäßigkeit, haben die Chinesen den amerikanischen Arbeitern
und Gewerbetreibenden eine wirksame Konkurrenz gemacht, in-
dem sie wohlfeiler und besser arbeiten und daher mit der Zeit
eine Menge Erwerbsquellen ganz an sich gerissen haben. Es
herrscht deshalb dort jetzt, namentlich in den unteren Volks-
klassen, eine allgemeine Erbitterung gegen die Chinesen, die
nur so lange im Auslände bleiben, bis sie sich ein Kapital
erspart haben, mit welchem sie daun in ihre Heimath zurück-
kehren, und die daher niemals Bürger werden nnd das Ge-
deihen des Landes dauernd fördern. Es hat sich eine Agita-
tion gebildet, welche erstrebt, den Chinesen die Einwanderung
gesetzlich zu verbieten und die schon vorhandenen zu vertrei-
ben, und es ist selbst mehrfach bereits zu Aufständen gegen
die Söhne des „himmlischen Reiches" gekommen. San Fran-
cisco ist jedoch keineswegs die einzige Stadt, welche durch die
„Chinesenfrage" beunruhigt wird. Der mäßige, fleißige, aus-
dauernde nnd ruhig sortarbeitende Chinese ist überall zu fin-
den, wo es etwas zn arbeiten gibt, und stets erbötig, dies
wohlfeiler zn thun, als die Amerikaner oder einwandernden
Europäer pflegen. Er hat weniger Bedürfnisse und geringe-
ren Ehrgeiz als diese, und begnügt sich oft mit einer Kost
und Wohnung, mit welcher bei nns Niemand vorlieb neh-
men würde. Auch in Virginia City in Nevada haben sich die
Chinesen in großer Menge festgesetzt und ein eigenes Quartier-
gegründet, aus welchem wir auf unserem Bilde Seite 484
eine Anzahl Skizzen liefern. Diese nach dem Leben ent-
worfenen Zeichnungen vermögen unseren Lesern einen deut-
lichen Begriff von dem Leben und Treibtm dieser chine-
sischen Einwanderer nnd von der Geschicklichkeit zn geben,
womit sie sich im Nu der ihnen zusagenden Gewerbe be-
mächtigen. Zn diesen gehören in erster Linie das Cigarren-
machen (welches nnn in San Francisco ganz in die Hände
der Chinesen übergegangen ist), die Schuhmacherei, die ihnen
ganz fremd war, und in der sie nnn Ausgezeichnetes leisten,
die Tischlerei nnd Möbelfabrikation, alle Arten von Na-
delarbeit mit der Nähmaschine, die Besorgung der Wäiche,
das Barbiergewerbe, die Gärtnerei n. s. w., in welchen
man ihnen bald keine Konkurrenz mehr machen kann. Von
der Ausdauer und dem Fleiße, mit welchen sie täglich zwölf
bis vierzehn Stunden arbeiten, von der unter ihnen einge-
sührten Theilung der Arbeit kann man sich kaum einen Be-
griff machen. Viele Hunderte von Chinesen besorgen das
Waschen der Tisch-, Leib- und Bettwäsche zu fabelhaft billi-
gen Preisen und zwar meist nach einem System, wodurch die
Kosten der Hansmiethe zn einer höchst bescheidenen Ziffer
heruntergedrückt werden. Zwei derartiger Waschgefchäfte haben
nämlich gewöhnlich dasselbe Lokal mit denselben Kufen, Kesseln,
Oesen und Geräth'chaslen inne, aber die eine Abteilung ar-
Das Buch für Alle.
487
beitet bei Tage, die andere bei Nacht, nnd so sparen l eide
Partheien an Miethe u. s. w. Im Plätten sind sie Meister
nnd haben eine eigenthümliche Manier, vor der Anwendung
des Plättstahls die Leibwäsche durch einen sogenannten „spa-
nischen Nebel", d. h. einen im Munde zertheilten und zerstäub-
ten Wasserstrahl vorznbereiten, wodurch die Wäsche einen be-
sonderen Glanz erhält. Ist der Chinese müde, so kriecht er
in einen Winkel, raucht seine Opiumpille, und vergißt bald
im Traume die drückende Wirklichkeit. Es gibt unter den
Chinesen viele Männer, welche ein Vermögen von 100—200,000
Dollars besitzen. Wer die Mittel hat, ein Haus im chinesi-
schen Quartier zu kaufen, der richtet dasselbe alsbald nach chi-
nesischer Weise zum Vermiethen ein, indem er so viele kleine
Gemächer nnd Verschlüge als nur immer möglich ist, anbringt,
und diese mit chinesischer Einrichtung, d. h. möglichst dürftig
möblirt, zn hohen Preisen, vernuethet. Unser Mütelbild, Vig-
nette 4, zeigt einen chinesischen Schuhmacher mit seinem Weibe
in seinem ärmlichen Lokale, das ihm als Wohnung und Werk-
stätte zugleich dient. Fig. 1 stellt eine chinesische Fleischerei
und Wnrstsabrik dar, worin Fleisch, Speckseiten, Schinken nnd
Würste von Schweinen und Hunden, Fleisch von Pferden,
Eseln, Schafen, Ochsen nnd Katzen zu finden sind und begie-
rig gekauft werden. Fig. 2 ist eine der charakteristischen
Straßen im Chinesenviertel von Virginia City; Fig. 3 führt
nns in das Innere einer Werkstätte chinesischer Plätter und
Wäscher und Fig. 5 zeigt die Bereitung der Arzneimittel,
welche die chinesischen Aerzte verordnen. Auf der 6. Vig-
nette sehen wir Chinesen die buntbemalten Papiere nno
Stäbchen verbrennen, welche sie Dschoß nennen und die einen
halb religiösen Zweck haben, halb sympathetische Mittel sind,
während die 7. Vignette uns einen chinesischen Barbier mit
seinem Kunden vorsührt, der geduldig das Kästchen hält, worin
der Seifenschaum und die abgeschorenen Haare abgelegt werden.
Das psinsMli im Elsaß.
(Siehe das Bild auf Seite 485.)
Mehr noch als Ostern wild in Oberdentschland „Pfingsten,
das liebliche Fest," als volksthümliches Frühlingsfest gefeiert
und mit der alldeutschen Maifeier verbunden. Aehnlich ist
es auch im sröhlichen Elsaß, das ja, trotz aller künstlichen
Französisirung, seine guten alten deutschen Sitten und Bräuche
sich noch treulich bewahrt hat, namentlich unter der von der
französischen „Civilisation" noch nicht angekränkelten ländlichen
Bevölkerung. Während der Städter zu Pfingsten kürzere oder-
längere Ausflüge in die herrlichen frischbelaubten Wälder der
Vogesen macht und so seine Maienfreude sucht, feiert der
Dörfler sein Maiensest zn Hause. Es ist ein uraltes Ge-
wohnheitsrecht, das; am Nachmittag vor Pfingsten die „Buben",
d. h. die ledigen Bursche, in den Wald hinausgehen und sich
einen sogenannten „Maien" schneiden, d. h. entweder eine
junge frischbelanbte Birke, oder eine Kiefer oder Fichte.
Sobald dann der Abend dunkelt, gehen die Bursche mit ncn-
beschmitzten Peitschen durch das Dorf und knallen den jungen
Mädchen das Fest an, was den früheren Brauch des Pistolen-
schießens in vernünftiger Weise ersetzt. - Am frühesten Morgen
des Pfingstfestes versammeln sich dann die jungen Bursche
und Mädchen bei der Kirche, um den „Maien" zn schmücken;
die Buben bringen farbige Bänder, die Mädchen beschenken
ihre Buben mit Sträußen, die jeder sogleich jammt seinem
Bande an den Maien bindet. Nach Beendigung des Morgen-
gottesdienstes ziehen dann die Bursche in Gruppen von 10
bis 15 je mit ihrem Maien unter Gesang von Volksliedern
durch das Dorf und sammeln vor den einzelnen Häusern die
Festgaben ein, welche in Eiern, Brod, Backwerk, Rauchfleisch,
Wein n. s. w. bestehen. Einer trügt den Maien, zwei Andere
den Korb, worein die gesammelten Lebensmittel gelegt werden,
ein Vierter den großen Steinkrng oder das Füßchen, in wel-
chem der Wein gesammelt wird, und wozu jeder Hausvater
mindestens ein Liter beisteueru muß. Jedem begegnenden
jungen Mädchen werden unterwegs laute Hurrahs gebracht.
Der Zug Hal etwas Malerisches durch die Volkstracht, welche
bei deu Burschen in den kurzen Wämmsern und langen Bein-
kleidern von schwarzgrauem Tuche mit der reichsten Besetzung
von blanken Knöpfen, in dem rothen Brusttuch und der Pelz-
mütze von Iltis, bei den Mädchen in ausgeschnittenem Mieder
mit Silberketten und Goldflittern, in züchtigem Fürtuch und
> mit bunten Bändern besetzten Nöcken, sonne in der nied-
i rigen landesüblichen Haube mit der breiten, gleich Schmet-
i terlingsflügeln über der Stirne ruhenden Masche von schwar-
zem Seidenband besteht. Ist der Umzug vollendet, so wird
im Hause eines der Burschen ans den gesammelten Lebens-
mitteln eine Mahlzeit bereitet nnd mit Appetit verzehrt, worauf
Alt und Jung sich nach dem Tanzplatz begibt, wo die jungen
Paare sich bis in den späten Abend hinein im wirbelnden
Neigen drehen und mit dem gesammelten Weine laben.
Die Mästung der Mustern.
(Siehe das Bild aus Seite 485.>
Die Austern sind heutzutage eiue so gesuchte Marktmaare,
das; die Ausbeute der natürlich wachsenden an unseren deut-
schen Küsten lange nicht mehr ganz der Nachfrage genügt und
man vielfach bereits Versuche zn ihrer künstlichen Äermehrung
und Zucht gemacht hat, namentlich aber wird auch aus Ver-
besserung ihrer Qualität hingearbeitet, indem man die beim
Fange sich ergebenden noch kleinen, unscheinbaren oder mage-
reu Austern in sogenannten „Ansternparks" großzieht und
mästet. Einen derartigen Austernpark bei der scbleswig'schen
Stadt Husum führen wir ans unserer Zeichnung S. 485 un-
seren Lesern vor. Ungefähr eine Stunde von Husum liegt
auf der äußersten Spitze des Tockkoogs oder Marschendammes
der Austernpark der Husumer Austern-Compagnie, welche feit
1858 diese von einem Herrn Joseph Miller in London ange-
legte Zuchtanstalt sür Austern selber übernommen hat nnd
fortführt. Ein Damm oder Deich von 13—20 Nieter Höhe,
welcher meerwürts nut angepflöcktem Strohgeslccht und Steinen
belegt ist, schützt diesen Koog gegen den Wogenschlag der
Nordsee; darüber hinaus sieht man auf unserem Bilde hinten
links die Landspitze von silmannsberg, rechts die Insel
Nordstrand. Innerhalb des Deiches liegen die drei Fächer
des Austernparks, jeder etwa 20-23'/- Meter in's Ge-
vierte haltend und ungefähr 3 Bieter tief nnd mittelst ein-
gelegter Gehbalkcn gitterartig überbrückt. Vor den drei
Bassins liegen zwei große Wasser-Reservoirs, von dem tie-
feren Theil des Koogs abgeschlossen und mittelst einer Schleuse
und eines Tunnels unter dem Deich hindurch mit der Nordsee
in Verbindung gesetzt, so das; sich diese Reservoirs zur Fluth-
zeit immer mit frischem Meerwasser füllen. Sobald die Re-
servoirs gefüllt sind, läßt man die Schützen der Schleusen
nieder, damit das eingedrnngene Wasser Ruhe hat, um seinen
Schlick (Meerschlamm) abzusetzen nnd mittelst besonderer kleiner
Schützen in die Bassins geleitet zn werden. Die eigentlichen
Parks liegen etwas tiefer als die Reservoirs, aber immer noch
höher als der äußere umgebende Theil, damit man also,
wenn zur Ebbezeit das Wasser durch die Hauptschlense wieder
nach der Nordsee hinaus abgelaufen ist, auch das Wasser
der Parks durch die hintersten Schleusen ablassen und dafür
frisches aus den Reservoirs hereinlassen kann, so daß die
Austern fortwährend damit bespült werden. Die Wände der
Reservoirs bestehen ans Erdwäüen, welche mit Strohgeflecbt
belegt sind; die Parks dagegen sind mit einem Gemisch von
Erde und Kleie ansgeschlagen und mit einer dicken massiven,
wasserdichten Bohlenlage am Boden und an den Seiten ver-
sehen, damit kein dem Gedeihen der Austern schädliches Grund-
wasser eindringen kann; überhaupt muß in den Parks die
größte Reinlichkeit beobachtet werden. In diesen Bassins der
Parks nun werden sowohl die in der Nordsee gefangenen, als
die von Whitstable herüber kommenden englischen Austern,
sogenannte. Natives, nntergebracht, um noch etwas zn wachsen
und gemästet zn werden, bevor man sie per Eisenbahn in's
deutsche Binnenland versendet, ganz in derselben Art, wie
man im nördlichen und nordwestlichen Frankreich nnd in
Ostende die frisch gefangenen Austern noch einige Zeit „par-
guirt", ehe man sie auf die Märkte sendet, weil sie dadurch in
gesünderem und einladenderem Zustande in die Hand der
Konsnmenten kommen. Wenn nun die parkirten Austern nach
einiger Zeit versendet werden sollen, so fischt man sie mit dem
Ketscher ans den Bassins, sortirt sie in dem Winterhause,
verpackt sie in Körbe und verschickt sie von Husum ans per
Eisenbahn. Zugleich werden die kleineren Exemplare, welche
der Fang in offener See ergibt, hier groß gezogen, die Eier
aufgefischt und an die Brntbassins abgegeben und so für die
Fortverpflanznng der Auster gesorgt. Der Auiternpark von
Husum ist daher eine mustergiltige nnd für den Ansternhandel
der deutschen Nordküsten höchst wichtige Anstalt, da er den
von hier bezogenen Austern dieselbe gute Qualität sichert, wie
sie die französischen Austern von Caneale, Dieppe, Conearnean
nnd anderen Orten haben.
Fus Griechenland.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 189.)
.Es sind zwei der berühmtesten Orte aus der altgriechischen
Geschichte, nach denen mir diesmal unsere Leser an der Hand
unserer beiden Bilder ans S. 489 führen — das eine die
gegenwärtige Ansicht der altberühmten alten attischen Stadt
Elensis., nur wenige Meilen nordwestlich von Athen, an der
Nordküste des eleusinifchen Golfes, das andere der Schauplatz
jener gewaltigen Nettungsschlacht bei Marathon, wo Miltiades
den herrlichen Sieg über die Perser erfocht. Elensis war eine
der ältesten nnd wichtigsten Städte des attischen Landes, einst
reich und groß durch feinen Handel nnd durch den herrlichen
unter Perikles erbauten Tempel der Demeter (Ceres), in
welchem zu Ehren der Demeter und der Persephone (Proser-
pina) die berühmten Eleusinischen Feste oder Mysterien ge-
feiert wurden. Alarich hat diesen Tempel zerstört, doch finden
sich noch Ruinen davon. Von Athen ans gelangt man zu
Pferde oder Wagen in anderthalb Stunden nach Eleusis auf
einer Straße, welche beinahe genau dein alten „heiligen Wege"
folgt, denn nach dem Austritt nns dem Daphne-Pas; erblickt
man, der heutigen Straße parallel, die Ueberbleibsel des dicht
am Meere hinführenden, in die anstehenden Felsen einge-
sprengten alten „heiligen Wegs". Von hier überschaut man
den halbmondförmigen Golf von Elensis, an dessen Halbrund
die weite, fruchtbare thriasische Ebene herantritt, deren reiche
Erträgnisse den Anlaß zn der Verherrlichung der Ceres in
den eleusinifchen Festen gegeben haben mag. Auf dem schma-
len Gestade zwischen Eleusis und dem Meere soll der Sage
nach das erste Getreide gebaut worden fein, und die thriasische
Ebene ist noch heute ein wohlbebantes und ergiebiges Korn-
land, bewässert von dein elensifchcn Kephissns, dessen Fluthen
durch Gräben mit Schützen weithin in und über die Felder-
geleitet wird. Ein Felsenrücken zieht von Westen her in die
Ebene herein nnd endet der Mitte der Bucht gegenüber, und
auf feinem Gehäng liegt das heutige unbedeutende Städt-
chen. Im Alterthnm stand auf diesem Felseugrat die Akro-
polis oder Burg von Elensis und auf dem östlichen Vorhügel
desselben der prächtige Tempel., einst einer der größten in
Griechenland, der nun ganz verschwunden nnd dessen Grund-
mauern von dem heutigen Städtchen bedeckt sind. Den Punkt
der früheren Akropolis bezeichnet eine auch auf unserem Bilde
zu sehende kleine griechische Kapelle mit einem alleinstehenden
Glockenthurm oben auf der Höhe, wo der Boden weithin noch
mit großen Tlümmern von marmornen Gesimsen und Säulen
dorischer und jonischer Ordnung bedeckt ist und überhaupt
noch baulllhe Ueberreste aus nlthellenischer und römischer
Zeit und Spuren von den alten Stadtmauern zwischen den
Häu'ern zn finden sind. Die Thurmruine auf der Felsen-
kuppe rechts ist ein Ueberbleibsel aus byzantinischer Zeit.
Das Schlachtfeld von Marathon, wovon unser oberes
Bild S. 489 eine Ansicht gibt, liegt nordöstlich von Athen,
nahe bei dem Vorgebirg Kynosura und ist eine ziemlich enge,
baumlose, etwa 2 Wegstunden lange und l'/r Stunden breite
Thalebene; die Terrainformation ist derart, daß hier wohl ein
kleines Heer mit Vortheil sich eines großen erwehren konnte,
und hier schlug denn auch bekanntlich am 28. September 490
vor Christo das kleine Gricchenheer unter Miltiades die zahl-
Deuedetto Cniroll^
italienischer Minister-Präsident.
(Siehe das Porträt auf Scite 481.)
Ain 10. Marz d. I. reichte in Nam das gesnmmte Mi-
nisterium Depretis, nachdem cs in der Kammer eine eklatante
Niederlage erlitten hatte, dem König Humbert seine Demisnon
ein, und der soeben zum Präsidenten der zwecken Kammer
ernannte Cairoli, der Führer der radikalen Linken, wurde
niit der Bildung des neuen Ministeriums beauftragt. Dieses
neue Ministerium trat am 23. März zusammen nnd besteht
ans Cairoli als Präsidenten, Zanardelli für Inneres, De-
sauctis für Unterricht, Seismit Dota für Finanzen, Brnzzo
für Krieg, Brocchetti für Marine, Conforti für Justiz, Bac-
carini für die öffentlichen Arbeiten nnd Graf Luigi Corti für
das Auswärtige. Beiredetto Cairoli, der nene^Ministerpräst-
dent, dessen Porträt die Leser ans der ersten Seite des vor-
liegenden Heftes finden, wurde am 28. Januar 1826 als der
Sohn eines Chirurgen, Carlo Cairoli, nnd feiner Gattin
Adelaide, geb. Bono, zu Pavia geboren, woselbst er feine
Crziehnng erhielt. Benedetto hatte noch vier Brüder, Luigi,
Ernesto, Enrico nnd Giovanni, welche fämmtlich in den ita-
lienischen Befreiungskämpfen fielen. Es kanu uns daher nicht
Wunder nehmen, daß mich Benedetto, der sich inzwischen dem
Studium der Rechte zugewandt hatte, schon früh sich ebenfalls
an den politischen Bewegungen betheiligte. 1848 nahm er
an dem Mailänder Ausstand Theil, kehrte aber nach der un-
glücklichen Schlacht von Novara m feine Vaterstadt zurück,
im Stillen weiter agitirend und wirkend. 1859 machte der
unermüdliche Patriot abermals den Feldzug mit, in welchem
fein Brnder Ernesto bei Varese an feiner Seite fiel, ^m
Jahre 1860 wurde er als Abgeordneter der Stadt PaviaPn's
Parlament gewählt, aber Garibaldi's berühmter Zug decf „Tau-
send" rief ihn abermals in's Feld. Cairoli wurde Kapitän
der siebenten, aus Studenten und Bürgern von Pavia gebil-
deten Kompagnie; bei Calatafimi leicht verwundet, erlitt er
bei dem Sturme auf Palermo eine Zerschmetterung der Bein-
röhre, so das; er lange Zeit nur auf Krücken gehen konnte,
bis ihn Doktor Bcrtani 1863 durch eine glückliche Operation
wieder herstellte. 1868 wurde er als Vertreter Pavia's zuerst
in die Kammer gewählt, in der er gegenwärtig zum siebenten
Male sitzt. Benedetto Cairoli hat bisher noch nie ein Staats-
amt bekleidet; er ist ein politischer Idealist, ein gewandter
Redner, ein uneigennütziger und höchst ehrenwerther Charakter,
jedoch wird er sich als Staatsmann erst noch zn bewähren haben.
Die chinesischen Einwanderer in Dirginia-Lity.
(Siehe das Bild auf Scite 484.)
Die massenhafte Einwanderung der chinesischen Arbeiter in
diejenigen Staaten der Union, welche an den Küsten des Stil-
len Oceans liegen, ist im Verlauf der jüngsten fünfundzwanzig
Jahre zu einer Höhe gestiegen, welche man in ihren Folgen
nnn für eine Landes-Kalamität anfieht, obwohl nicht geleug-
net werden kann, daß der rührige und stetige Fleis; dieser chi-
nesischen Arbeiter ungeheuer viel zur Entwickelung , der ver-
schiedenen natürlichen Hilfsquellen des reichen Kalifornien bei-
getragen hat. Mit der ihrem Volke eigenen Findigkeit und
Gelehrigkeit, mit ihrer geduldigen Ausdauer nnd Anspruchs-
losigkeit und ihrer bewundernswerthen Genügsamkeit und
Mäßigkeit, haben die Chinesen den amerikanischen Arbeitern
und Gewerbetreibenden eine wirksame Konkurrenz gemacht, in-
dem sie wohlfeiler und besser arbeiten und daher mit der Zeit
eine Menge Erwerbsquellen ganz an sich gerissen haben. Es
herrscht deshalb dort jetzt, namentlich in den unteren Volks-
klassen, eine allgemeine Erbitterung gegen die Chinesen, die
nur so lange im Auslände bleiben, bis sie sich ein Kapital
erspart haben, mit welchem sie daun in ihre Heimath zurück-
kehren, und die daher niemals Bürger werden nnd das Ge-
deihen des Landes dauernd fördern. Es hat sich eine Agita-
tion gebildet, welche erstrebt, den Chinesen die Einwanderung
gesetzlich zu verbieten und die schon vorhandenen zu vertrei-
ben, und es ist selbst mehrfach bereits zu Aufständen gegen
die Söhne des „himmlischen Reiches" gekommen. San Fran-
cisco ist jedoch keineswegs die einzige Stadt, welche durch die
„Chinesenfrage" beunruhigt wird. Der mäßige, fleißige, aus-
dauernde nnd ruhig sortarbeitende Chinese ist überall zu fin-
den, wo es etwas zn arbeiten gibt, und stets erbötig, dies
wohlfeiler zn thun, als die Amerikaner oder einwandernden
Europäer pflegen. Er hat weniger Bedürfnisse und geringe-
ren Ehrgeiz als diese, und begnügt sich oft mit einer Kost
und Wohnung, mit welcher bei nns Niemand vorlieb neh-
men würde. Auch in Virginia City in Nevada haben sich die
Chinesen in großer Menge festgesetzt und ein eigenes Quartier-
gegründet, aus welchem wir auf unserem Bilde Seite 484
eine Anzahl Skizzen liefern. Diese nach dem Leben ent-
worfenen Zeichnungen vermögen unseren Lesern einen deut-
lichen Begriff von dem Leben und Treibtm dieser chine-
sischen Einwanderer nnd von der Geschicklichkeit zn geben,
womit sie sich im Nu der ihnen zusagenden Gewerbe be-
mächtigen. Zn diesen gehören in erster Linie das Cigarren-
machen (welches nnn in San Francisco ganz in die Hände
der Chinesen übergegangen ist), die Schuhmacherei, die ihnen
ganz fremd war, und in der sie nnn Ausgezeichnetes leisten,
die Tischlerei nnd Möbelfabrikation, alle Arten von Na-
delarbeit mit der Nähmaschine, die Besorgung der Wäiche,
das Barbiergewerbe, die Gärtnerei n. s. w., in welchen
man ihnen bald keine Konkurrenz mehr machen kann. Von
der Ausdauer und dem Fleiße, mit welchen sie täglich zwölf
bis vierzehn Stunden arbeiten, von der unter ihnen einge-
sührten Theilung der Arbeit kann man sich kaum einen Be-
griff machen. Viele Hunderte von Chinesen besorgen das
Waschen der Tisch-, Leib- und Bettwäsche zu fabelhaft billi-
gen Preisen und zwar meist nach einem System, wodurch die
Kosten der Hansmiethe zn einer höchst bescheidenen Ziffer
heruntergedrückt werden. Zwei derartiger Waschgefchäfte haben
nämlich gewöhnlich dasselbe Lokal mit denselben Kufen, Kesseln,
Oesen und Geräth'chaslen inne, aber die eine Abteilung ar-
Das Buch für Alle.
487
beitet bei Tage, die andere bei Nacht, nnd so sparen l eide
Partheien an Miethe u. s. w. Im Plätten sind sie Meister
nnd haben eine eigenthümliche Manier, vor der Anwendung
des Plättstahls die Leibwäsche durch einen sogenannten „spa-
nischen Nebel", d. h. einen im Munde zertheilten und zerstäub-
ten Wasserstrahl vorznbereiten, wodurch die Wäsche einen be-
sonderen Glanz erhält. Ist der Chinese müde, so kriecht er
in einen Winkel, raucht seine Opiumpille, und vergißt bald
im Traume die drückende Wirklichkeit. Es gibt unter den
Chinesen viele Männer, welche ein Vermögen von 100—200,000
Dollars besitzen. Wer die Mittel hat, ein Haus im chinesi-
schen Quartier zu kaufen, der richtet dasselbe alsbald nach chi-
nesischer Weise zum Vermiethen ein, indem er so viele kleine
Gemächer nnd Verschlüge als nur immer möglich ist, anbringt,
und diese mit chinesischer Einrichtung, d. h. möglichst dürftig
möblirt, zn hohen Preisen, vernuethet. Unser Mütelbild, Vig-
nette 4, zeigt einen chinesischen Schuhmacher mit seinem Weibe
in seinem ärmlichen Lokale, das ihm als Wohnung und Werk-
stätte zugleich dient. Fig. 1 stellt eine chinesische Fleischerei
und Wnrstsabrik dar, worin Fleisch, Speckseiten, Schinken nnd
Würste von Schweinen und Hunden, Fleisch von Pferden,
Eseln, Schafen, Ochsen nnd Katzen zu finden sind und begie-
rig gekauft werden. Fig. 2 ist eine der charakteristischen
Straßen im Chinesenviertel von Virginia City; Fig. 3 führt
nns in das Innere einer Werkstätte chinesischer Plätter und
Wäscher und Fig. 5 zeigt die Bereitung der Arzneimittel,
welche die chinesischen Aerzte verordnen. Auf der 6. Vig-
nette sehen wir Chinesen die buntbemalten Papiere nno
Stäbchen verbrennen, welche sie Dschoß nennen und die einen
halb religiösen Zweck haben, halb sympathetische Mittel sind,
während die 7. Vignette uns einen chinesischen Barbier mit
seinem Kunden vorsührt, der geduldig das Kästchen hält, worin
der Seifenschaum und die abgeschorenen Haare abgelegt werden.
Das psinsMli im Elsaß.
(Siehe das Bild auf Seite 485.)
Mehr noch als Ostern wild in Oberdentschland „Pfingsten,
das liebliche Fest," als volksthümliches Frühlingsfest gefeiert
und mit der alldeutschen Maifeier verbunden. Aehnlich ist
es auch im sröhlichen Elsaß, das ja, trotz aller künstlichen
Französisirung, seine guten alten deutschen Sitten und Bräuche
sich noch treulich bewahrt hat, namentlich unter der von der
französischen „Civilisation" noch nicht angekränkelten ländlichen
Bevölkerung. Während der Städter zu Pfingsten kürzere oder-
längere Ausflüge in die herrlichen frischbelaubten Wälder der
Vogesen macht und so seine Maienfreude sucht, feiert der
Dörfler sein Maiensest zn Hause. Es ist ein uraltes Ge-
wohnheitsrecht, das; am Nachmittag vor Pfingsten die „Buben",
d. h. die ledigen Bursche, in den Wald hinausgehen und sich
einen sogenannten „Maien" schneiden, d. h. entweder eine
junge frischbelanbte Birke, oder eine Kiefer oder Fichte.
Sobald dann der Abend dunkelt, gehen die Bursche mit ncn-
beschmitzten Peitschen durch das Dorf und knallen den jungen
Mädchen das Fest an, was den früheren Brauch des Pistolen-
schießens in vernünftiger Weise ersetzt. - Am frühesten Morgen
des Pfingstfestes versammeln sich dann die jungen Bursche
und Mädchen bei der Kirche, um den „Maien" zn schmücken;
die Buben bringen farbige Bänder, die Mädchen beschenken
ihre Buben mit Sträußen, die jeder sogleich jammt seinem
Bande an den Maien bindet. Nach Beendigung des Morgen-
gottesdienstes ziehen dann die Bursche in Gruppen von 10
bis 15 je mit ihrem Maien unter Gesang von Volksliedern
durch das Dorf und sammeln vor den einzelnen Häusern die
Festgaben ein, welche in Eiern, Brod, Backwerk, Rauchfleisch,
Wein n. s. w. bestehen. Einer trügt den Maien, zwei Andere
den Korb, worein die gesammelten Lebensmittel gelegt werden,
ein Vierter den großen Steinkrng oder das Füßchen, in wel-
chem der Wein gesammelt wird, und wozu jeder Hausvater
mindestens ein Liter beisteueru muß. Jedem begegnenden
jungen Mädchen werden unterwegs laute Hurrahs gebracht.
Der Zug Hal etwas Malerisches durch die Volkstracht, welche
bei deu Burschen in den kurzen Wämmsern und langen Bein-
kleidern von schwarzgrauem Tuche mit der reichsten Besetzung
von blanken Knöpfen, in dem rothen Brusttuch und der Pelz-
mütze von Iltis, bei den Mädchen in ausgeschnittenem Mieder
mit Silberketten und Goldflittern, in züchtigem Fürtuch und
> mit bunten Bändern besetzten Nöcken, sonne in der nied-
i rigen landesüblichen Haube mit der breiten, gleich Schmet-
i terlingsflügeln über der Stirne ruhenden Masche von schwar-
zem Seidenband besteht. Ist der Umzug vollendet, so wird
im Hause eines der Burschen ans den gesammelten Lebens-
mitteln eine Mahlzeit bereitet nnd mit Appetit verzehrt, worauf
Alt und Jung sich nach dem Tanzplatz begibt, wo die jungen
Paare sich bis in den späten Abend hinein im wirbelnden
Neigen drehen und mit dem gesammelten Weine laben.
Die Mästung der Mustern.
(Siehe das Bild aus Seite 485.>
Die Austern sind heutzutage eiue so gesuchte Marktmaare,
das; die Ausbeute der natürlich wachsenden an unseren deut-
schen Küsten lange nicht mehr ganz der Nachfrage genügt und
man vielfach bereits Versuche zn ihrer künstlichen Äermehrung
und Zucht gemacht hat, namentlich aber wird auch aus Ver-
besserung ihrer Qualität hingearbeitet, indem man die beim
Fange sich ergebenden noch kleinen, unscheinbaren oder mage-
reu Austern in sogenannten „Ansternparks" großzieht und
mästet. Einen derartigen Austernpark bei der scbleswig'schen
Stadt Husum führen wir ans unserer Zeichnung S. 485 un-
seren Lesern vor. Ungefähr eine Stunde von Husum liegt
auf der äußersten Spitze des Tockkoogs oder Marschendammes
der Austernpark der Husumer Austern-Compagnie, welche feit
1858 diese von einem Herrn Joseph Miller in London ange-
legte Zuchtanstalt sür Austern selber übernommen hat nnd
fortführt. Ein Damm oder Deich von 13—20 Nieter Höhe,
welcher meerwürts nut angepflöcktem Strohgeslccht und Steinen
belegt ist, schützt diesen Koog gegen den Wogenschlag der
Nordsee; darüber hinaus sieht man auf unserem Bilde hinten
links die Landspitze von silmannsberg, rechts die Insel
Nordstrand. Innerhalb des Deiches liegen die drei Fächer
des Austernparks, jeder etwa 20-23'/- Meter in's Ge-
vierte haltend und ungefähr 3 Bieter tief nnd mittelst ein-
gelegter Gehbalkcn gitterartig überbrückt. Vor den drei
Bassins liegen zwei große Wasser-Reservoirs, von dem tie-
feren Theil des Koogs abgeschlossen und mittelst einer Schleuse
und eines Tunnels unter dem Deich hindurch mit der Nordsee
in Verbindung gesetzt, so das; sich diese Reservoirs zur Fluth-
zeit immer mit frischem Meerwasser füllen. Sobald die Re-
servoirs gefüllt sind, läßt man die Schützen der Schleusen
nieder, damit das eingedrnngene Wasser Ruhe hat, um seinen
Schlick (Meerschlamm) abzusetzen nnd mittelst besonderer kleiner
Schützen in die Bassins geleitet zn werden. Die eigentlichen
Parks liegen etwas tiefer als die Reservoirs, aber immer noch
höher als der äußere umgebende Theil, damit man also,
wenn zur Ebbezeit das Wasser durch die Hauptschlense wieder
nach der Nordsee hinaus abgelaufen ist, auch das Wasser
der Parks durch die hintersten Schleusen ablassen und dafür
frisches aus den Reservoirs hereinlassen kann, so daß die
Austern fortwährend damit bespült werden. Die Wände der
Reservoirs bestehen ans Erdwäüen, welche mit Strohgeflecbt
belegt sind; die Parks dagegen sind mit einem Gemisch von
Erde und Kleie ansgeschlagen und mit einer dicken massiven,
wasserdichten Bohlenlage am Boden und an den Seiten ver-
sehen, damit kein dem Gedeihen der Austern schädliches Grund-
wasser eindringen kann; überhaupt muß in den Parks die
größte Reinlichkeit beobachtet werden. In diesen Bassins der
Parks nun werden sowohl die in der Nordsee gefangenen, als
die von Whitstable herüber kommenden englischen Austern,
sogenannte. Natives, nntergebracht, um noch etwas zn wachsen
und gemästet zn werden, bevor man sie per Eisenbahn in's
deutsche Binnenland versendet, ganz in derselben Art, wie
man im nördlichen und nordwestlichen Frankreich nnd in
Ostende die frisch gefangenen Austern noch einige Zeit „par-
guirt", ehe man sie auf die Märkte sendet, weil sie dadurch in
gesünderem und einladenderem Zustande in die Hand der
Konsnmenten kommen. Wenn nun die parkirten Austern nach
einiger Zeit versendet werden sollen, so fischt man sie mit dem
Ketscher ans den Bassins, sortirt sie in dem Winterhause,
verpackt sie in Körbe und verschickt sie von Husum ans per
Eisenbahn. Zugleich werden die kleineren Exemplare, welche
der Fang in offener See ergibt, hier groß gezogen, die Eier
aufgefischt und an die Brntbassins abgegeben und so für die
Fortverpflanznng der Auster gesorgt. Der Auiternpark von
Husum ist daher eine mustergiltige nnd für den Ansternhandel
der deutschen Nordküsten höchst wichtige Anstalt, da er den
von hier bezogenen Austern dieselbe gute Qualität sichert, wie
sie die französischen Austern von Caneale, Dieppe, Conearnean
nnd anderen Orten haben.
Fus Griechenland.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 189.)
.Es sind zwei der berühmtesten Orte aus der altgriechischen
Geschichte, nach denen mir diesmal unsere Leser an der Hand
unserer beiden Bilder ans S. 489 führen — das eine die
gegenwärtige Ansicht der altberühmten alten attischen Stadt
Elensis., nur wenige Meilen nordwestlich von Athen, an der
Nordküste des eleusinifchen Golfes, das andere der Schauplatz
jener gewaltigen Nettungsschlacht bei Marathon, wo Miltiades
den herrlichen Sieg über die Perser erfocht. Elensis war eine
der ältesten nnd wichtigsten Städte des attischen Landes, einst
reich und groß durch feinen Handel nnd durch den herrlichen
unter Perikles erbauten Tempel der Demeter (Ceres), in
welchem zu Ehren der Demeter und der Persephone (Proser-
pina) die berühmten Eleusinischen Feste oder Mysterien ge-
feiert wurden. Alarich hat diesen Tempel zerstört, doch finden
sich noch Ruinen davon. Von Athen ans gelangt man zu
Pferde oder Wagen in anderthalb Stunden nach Eleusis auf
einer Straße, welche beinahe genau dein alten „heiligen Wege"
folgt, denn nach dem Austritt nns dem Daphne-Pas; erblickt
man, der heutigen Straße parallel, die Ueberbleibsel des dicht
am Meere hinführenden, in die anstehenden Felsen einge-
sprengten alten „heiligen Wegs". Von hier überschaut man
den halbmondförmigen Golf von Elensis, an dessen Halbrund
die weite, fruchtbare thriasische Ebene herantritt, deren reiche
Erträgnisse den Anlaß zn der Verherrlichung der Ceres in
den eleusinifchen Festen gegeben haben mag. Auf dem schma-
len Gestade zwischen Eleusis und dem Meere soll der Sage
nach das erste Getreide gebaut worden fein, und die thriasische
Ebene ist noch heute ein wohlbebantes und ergiebiges Korn-
land, bewässert von dein elensifchcn Kephissns, dessen Fluthen
durch Gräben mit Schützen weithin in und über die Felder-
geleitet wird. Ein Felsenrücken zieht von Westen her in die
Ebene herein nnd endet der Mitte der Bucht gegenüber, und
auf feinem Gehäng liegt das heutige unbedeutende Städt-
chen. Im Alterthnm stand auf diesem Felseugrat die Akro-
polis oder Burg von Elensis und auf dem östlichen Vorhügel
desselben der prächtige Tempel., einst einer der größten in
Griechenland, der nun ganz verschwunden nnd dessen Grund-
mauern von dem heutigen Städtchen bedeckt sind. Den Punkt
der früheren Akropolis bezeichnet eine auch auf unserem Bilde
zu sehende kleine griechische Kapelle mit einem alleinstehenden
Glockenthurm oben auf der Höhe, wo der Boden weithin noch
mit großen Tlümmern von marmornen Gesimsen und Säulen
dorischer und jonischer Ordnung bedeckt ist und überhaupt
noch baulllhe Ueberreste aus nlthellenischer und römischer
Zeit und Spuren von den alten Stadtmauern zwischen den
Häu'ern zn finden sind. Die Thurmruine auf der Felsen-
kuppe rechts ist ein Ueberbleibsel aus byzantinischer Zeit.
Das Schlachtfeld von Marathon, wovon unser oberes
Bild S. 489 eine Ansicht gibt, liegt nordöstlich von Athen,
nahe bei dem Vorgebirg Kynosura und ist eine ziemlich enge,
baumlose, etwa 2 Wegstunden lange und l'/r Stunden breite
Thalebene; die Terrainformation ist derart, daß hier wohl ein
kleines Heer mit Vortheil sich eines großen erwehren konnte,
und hier schlug denn auch bekanntlich am 28. September 490
vor Christo das kleine Gricchenheer unter Miltiades die zahl-