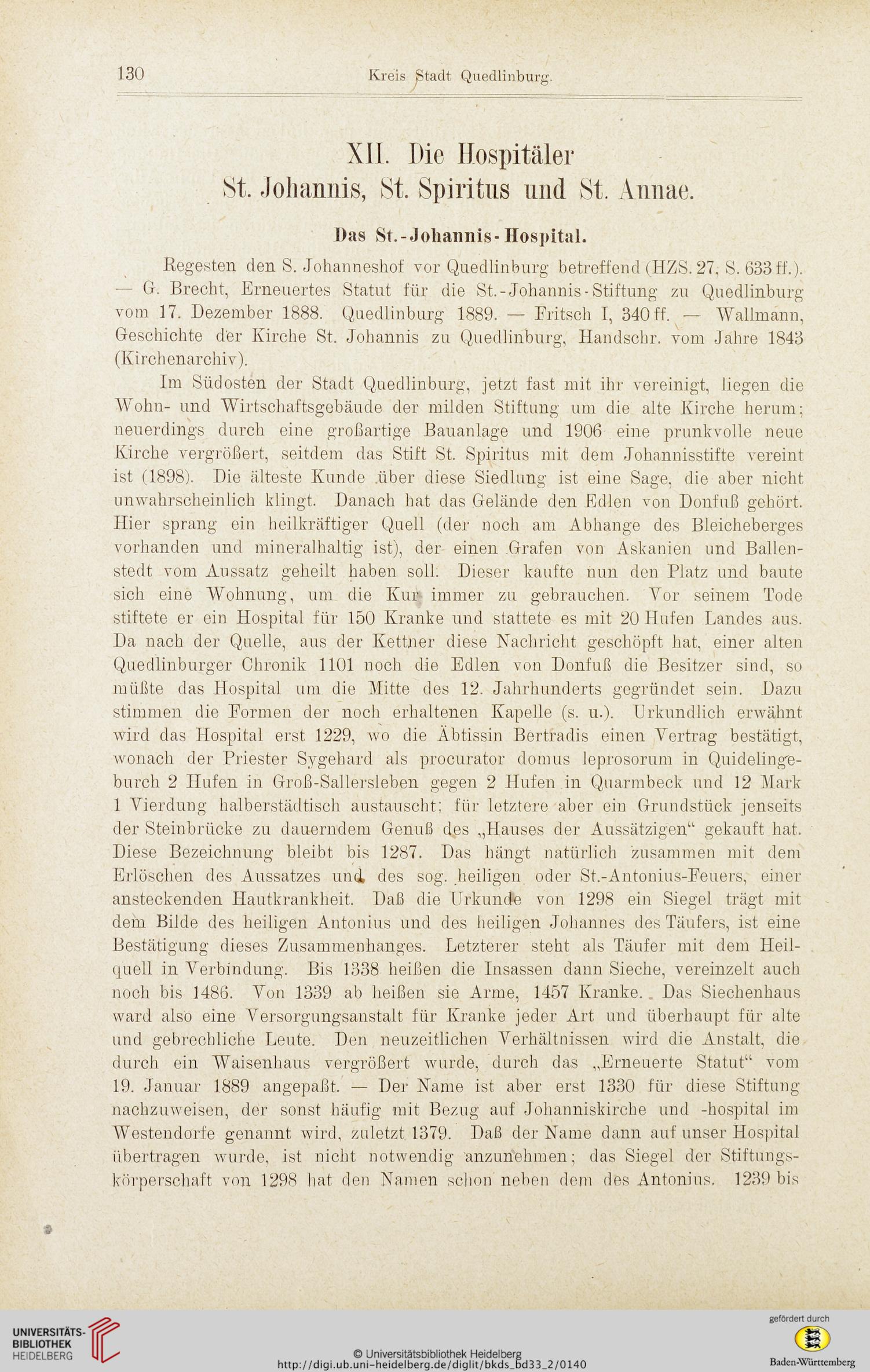130
Kreis Stadt Quedlinburg.
XII. Die Hospitäler
St. Johannis, St. Spiritus und St. Annae.
Das St.-Johannis -Hospital.
Regesten den S. Johanneshol vor Quedlinburg betreffend (HZS. 27, S. 633 ff.).
— 0. Brecht, Erneuertes Statut für die St.-Johannis-Stiftung zu Quedlinburg
vom 17. Dezember 1888. Quedlinburg 1889. — Eritsch I, 340 ff. — Wallmann,
Geschichte der Kirche St. Johannis zu Quedlinburg, Handschr. vom Jahre 1843
(Kirchenarchiv).
Im Südosten der Stadt Quedlinburg, jetzt fast mit ihr vereinigt, liegen die
Wohn- und Wirtschaftsgebäude der milden Stiftung um die alte Kirche herum;
neuerdings durch eine großartige Bauanlage und 1906 eine prunkvolle neue
Kirche vergrößert, seitdem das Stift St. Spiritus mit dem Johannisstifte vereint
ist (1898). Die älteste Kunde über diese Siedlung ist eine Sage, die aber nicht
unwahrscheinlich klingt. Danach hat das Gelände den Edlen von Donfuß gehört.
Hier sprang ein heilkräftiger Quell (der noch am Abhange des Bleicheberges
vorhanden und mineralhaltig ist), der einen .Grafen von Askanien und Ballen-
stedt vom Aussatz geheilt haben soll. Dieser kaufte nun den Platz und baute
sich eine Wohnung, um die Kur immer zu gebrauchen. Yor seinem Tode
stiftete er ein Hospital für 150 Kranke und stattete es mit 20 Hufen Landes aus.
Da nach der Quelle, aus der Kettner diese Nachricht geschöpft hat, einer alten
Quedlinburger Chronik 1101 noch die Edlen von Donfuß die Besitzer sind, so
müßte das Hospital um die Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet sein. Dazu
stimmen die Eormen der noch erhaltenen Kapelle (s. u.). Drkundlich erwähnt
wird das Hospital erst 1229, wo die Äbtissin Bertradis einen Vertrag bestätigt,
wonach der Priester Sygehard als procurator domus leprosorum in Quidelinge-
burch 2 Hufen in Groß-Sallersleben gegen 2 Hufen in Quarmbeck und 12 Mark
1 Vierdung halberstädtisch austauscht; für letztere aber ein Grundstück jenseits
der Steinbrücke zu dauerndem Genuß des „Hauses der Aussätzigen“ gekauft hat.
Diese Bezeichnung bleibt bis 1287. Das hängt natürlich zusammen mit dem
Erlöschen des Aussatzes und des sog. heiligen oder St.-Antonius-Eeuers, einer
ansteckenden Hautkrankheit. Daß die Urkunde von 1298 ein Siegel trägt mit
dem Bilde des heiligen Antonius und des heiligen Johannes des Täufers, ist eine
Bestätigung dieses Zusammenhanges. Letzterer steht als Täufer mit dem Heil-
quell in Verbindung. Bis 1338 heißen die Insassen dann Sieche, vereinzelt auch
noch bis 1486. Von 1339 ab heißen sie Arme, 1457 Kranke.. Das Siechenhaus
ward also eine Versorgungsanstalt für Kranke jeder Art und überhaupt für alte
und gebrechliche Leute. Den neuzeitlichen Verhältnissen wird die Anstalt, die
durch ein Waisenhaus vergrößert wurde, durch das „Erneuerte Statut“ vom
19. Januar 1889 angepaßt. — Der Name ist aber erst 1330 für diese Stiftung
nachzuweisen, der sonst häufig mit Bezug auf Johanniskirche und -hospital im
Westendorfe genannt wird, zuletzt 1379. Daß der Name dann auf unser Hospital
übertragen wurde, ist nicht notwendig anzunehmen; das Siegel der Stiftungs-
körperschaft von 1298 hat den Namen schon neben dem des Antonius, 1239 bis
Kreis Stadt Quedlinburg.
XII. Die Hospitäler
St. Johannis, St. Spiritus und St. Annae.
Das St.-Johannis -Hospital.
Regesten den S. Johanneshol vor Quedlinburg betreffend (HZS. 27, S. 633 ff.).
— 0. Brecht, Erneuertes Statut für die St.-Johannis-Stiftung zu Quedlinburg
vom 17. Dezember 1888. Quedlinburg 1889. — Eritsch I, 340 ff. — Wallmann,
Geschichte der Kirche St. Johannis zu Quedlinburg, Handschr. vom Jahre 1843
(Kirchenarchiv).
Im Südosten der Stadt Quedlinburg, jetzt fast mit ihr vereinigt, liegen die
Wohn- und Wirtschaftsgebäude der milden Stiftung um die alte Kirche herum;
neuerdings durch eine großartige Bauanlage und 1906 eine prunkvolle neue
Kirche vergrößert, seitdem das Stift St. Spiritus mit dem Johannisstifte vereint
ist (1898). Die älteste Kunde über diese Siedlung ist eine Sage, die aber nicht
unwahrscheinlich klingt. Danach hat das Gelände den Edlen von Donfuß gehört.
Hier sprang ein heilkräftiger Quell (der noch am Abhange des Bleicheberges
vorhanden und mineralhaltig ist), der einen .Grafen von Askanien und Ballen-
stedt vom Aussatz geheilt haben soll. Dieser kaufte nun den Platz und baute
sich eine Wohnung, um die Kur immer zu gebrauchen. Yor seinem Tode
stiftete er ein Hospital für 150 Kranke und stattete es mit 20 Hufen Landes aus.
Da nach der Quelle, aus der Kettner diese Nachricht geschöpft hat, einer alten
Quedlinburger Chronik 1101 noch die Edlen von Donfuß die Besitzer sind, so
müßte das Hospital um die Mitte des 12. Jahrhunderts gegründet sein. Dazu
stimmen die Eormen der noch erhaltenen Kapelle (s. u.). Drkundlich erwähnt
wird das Hospital erst 1229, wo die Äbtissin Bertradis einen Vertrag bestätigt,
wonach der Priester Sygehard als procurator domus leprosorum in Quidelinge-
burch 2 Hufen in Groß-Sallersleben gegen 2 Hufen in Quarmbeck und 12 Mark
1 Vierdung halberstädtisch austauscht; für letztere aber ein Grundstück jenseits
der Steinbrücke zu dauerndem Genuß des „Hauses der Aussätzigen“ gekauft hat.
Diese Bezeichnung bleibt bis 1287. Das hängt natürlich zusammen mit dem
Erlöschen des Aussatzes und des sog. heiligen oder St.-Antonius-Eeuers, einer
ansteckenden Hautkrankheit. Daß die Urkunde von 1298 ein Siegel trägt mit
dem Bilde des heiligen Antonius und des heiligen Johannes des Täufers, ist eine
Bestätigung dieses Zusammenhanges. Letzterer steht als Täufer mit dem Heil-
quell in Verbindung. Bis 1338 heißen die Insassen dann Sieche, vereinzelt auch
noch bis 1486. Von 1339 ab heißen sie Arme, 1457 Kranke.. Das Siechenhaus
ward also eine Versorgungsanstalt für Kranke jeder Art und überhaupt für alte
und gebrechliche Leute. Den neuzeitlichen Verhältnissen wird die Anstalt, die
durch ein Waisenhaus vergrößert wurde, durch das „Erneuerte Statut“ vom
19. Januar 1889 angepaßt. — Der Name ist aber erst 1330 für diese Stiftung
nachzuweisen, der sonst häufig mit Bezug auf Johanniskirche und -hospital im
Westendorfe genannt wird, zuletzt 1379. Daß der Name dann auf unser Hospital
übertragen wurde, ist nicht notwendig anzunehmen; das Siegel der Stiftungs-
körperschaft von 1298 hat den Namen schon neben dem des Antonius, 1239 bis