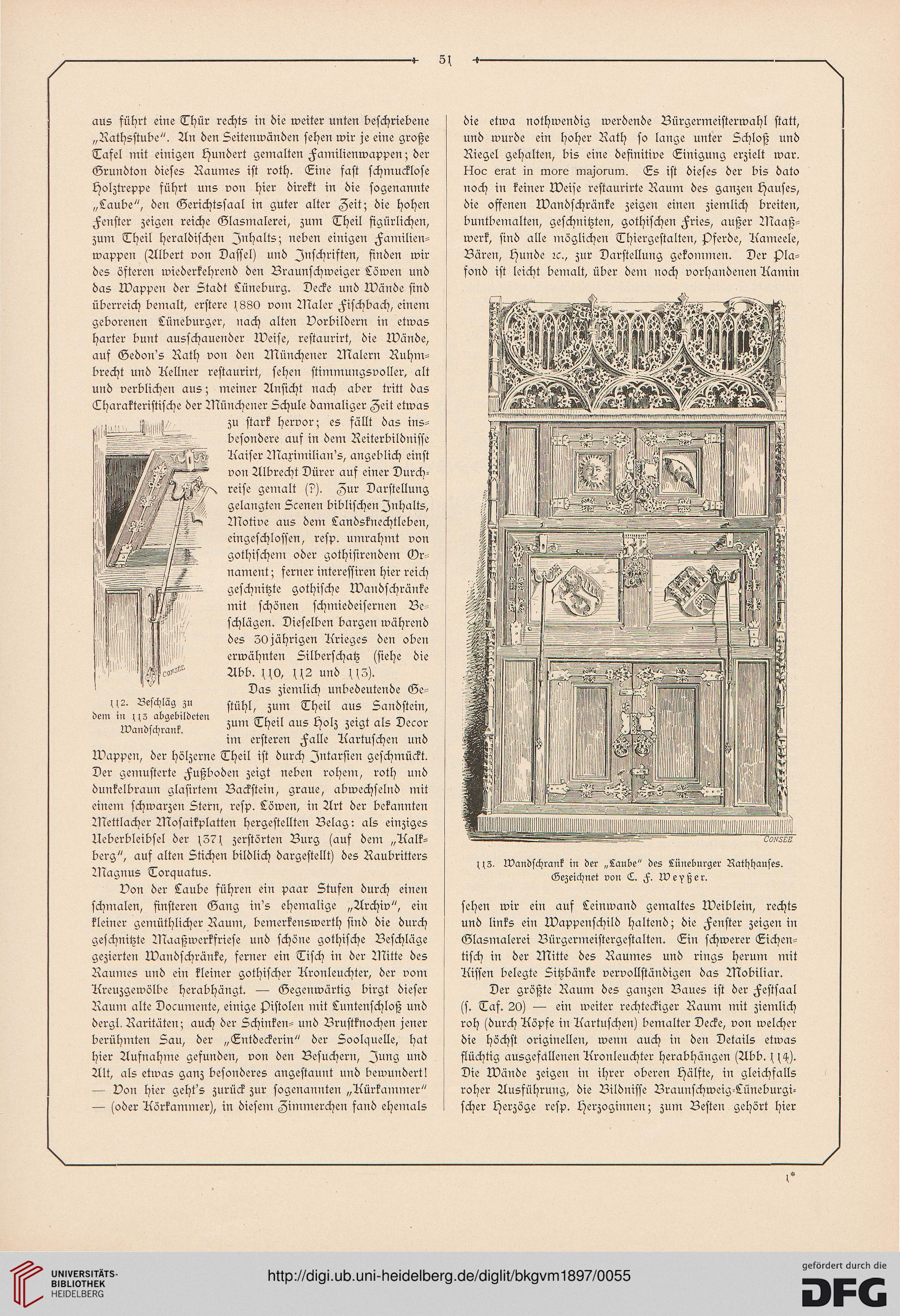aus führt eine Thür rechts in die weiter unten beschriebene
„Rathsstube". An den Leitenwänden sehen wir je eine große
Tafel mit einigen hundert gemalten Familienwappen; der
Grundton dieses Raumes ist roth. Tine fast schmucklose
Polztreppe führt uns von hier direkt in die sogenannte
„Laube", den Gerichtssaal in guter alter Zeit; die hohen
Fenster zeigen reiche Glasmalerei, zuin Theil figürlichen,
zum Theil heraldischen Inhalts; neben einigen Familien-
wappen (Albert von Dassel) und Inschriften, finden wir
des öfteren wiederkehrend den Braunschweiger Löwen und
das Wappen der Stadt Lüneburg. Decke und Wände sind
überreich bemalt, erstere 1^880 vom Maler Fischbach, einem
geborenen Lüneburger, nach alten Borbildern in etwas
harter bunt ausschauender Weise, restaurirt, die Wände,
auf Gedon's Rath von den Münchener Malern Ruhm-
brecht und Aellner restaurirt, sehen stimmungsvoller, alt
und verblichen aus; meiner Ansicht nach aber tritt das
Tharakteristische der Münchener Schule damaliger Zeit etwas
zu stark hervor; es fällt das ins-
besondere auf in dem Reiterbildnisse
Aaiser Maximilian's, angeblich einst
von Albrecht Dürer auf einer Durch-
reise gemalt (?). Zur Darstellung
gelangten Scenen biblischen Inhalts,
Motive aus dem Landsknechtleben,
eingeschlossen, resp. umrahmt von
gothischem oder gothisirendem Or-
nament; ferner interessiren hier reich
geschnitzte gothische Wandschränke
mit schönen schmiedeisernen Be-
schlägen. Dieselben bargen während
des 30 jährigen Arieges den oben
erwähnten Silberschatz (siehe die
Abb. P0, \\2 und P3).
Das ziemlich unbedeutende Ge-
stühl, zuin Theil aus Sandstein,
zum Theil aus polz zeigt als Dccor
im srsteren Falle Aartuschen und
Wappen, der hölzerne Theil ist durch Intarsien geschmückt.
Der gemusterte Fußboden zeigt neben rohem, roth und
dunkelbraun glasirtem Backstein, graue, abwechselnd mit
einem schwarzen Stern, resp. Löwen, in Art der bekannten
Mettlacher Mosaikplatten hergestellten Belag: als einziges
Ueberbleibsel der ^37)[ zerstörten Burg (auf dem „Aalk-
berg", auf alten Stichen bildlich dargestellt) des Raubritters
Magnus Torquatus.
Bon der Laube führen ein paar Stufen durch einen
schmalen, finsteren Gang in's eheinalige „Archiv", ein
kleiner gemüthlicher Raum, bemerkenswerth sind die durch
geschnitzte Maaßwcrksriese und schöne gothische Beschläge
gezierten Wandschränke, ferner ein Tisch in der Mitte des
Raumes und ein kleiner gothischer Aronleuchter, der vom
Areuzgewölbe herabhängt. — Gegenwärtig birgt dieser
Raum alte Documente, einige Pistolen mit Luntenschloß und
dergl. Raritäten; auch der Schinken- und Brustknochen jener
berühmten 5au, der „Tntdeckerin" der Soolquelle, hat
hier Aufnahme gefunden, von den Besuchern, Jung und
Alt, als etwas ganz besonderes angestauut und bewundert!
Bon hier geht's zurück zur sogenannten „Aürkammer"
— (oder Aörkammer), in diesem Zimmerchen fand ehemals
die etwa nothwendig werdende Bürgermeisterwahl statt,
und wurde ein hoher Rath so lange unter Schloß und
Riegel gehalten, bis eine definitive Tinigung erzielt war.
Hoc erat in more majorum. Ts ist dieses der bis dato
noch in keiner Weise restaurirte Raum des ganzen paufes,
die offenen Wandschränke zeigen einen ziemlich breiten,
buntbemalten, geschnitzten, gothischen Fries, außer Maaß-
werk, sind alle möglichen Thiergestalten, Pferde, Aameele,
Bären, punde rc., zur Darstellung gekommen. Der Pla-
fond ist leicht bemalt, über dem noch vorhandenen Aamin
;;3. Wandschrank in der „Laube" des Lüneburger Rathhauses.
Gezeichnet von <£. F. Weyßer.
sehen wir ein auf Leinwand gemaltes Weiblein, rechts
und links ein Wappenschild haltend; die Fenster zeigen in
Glasmalerei Bürgermeistergestalten. Tin schwerer Tichen
tisch in der Mitte des Raumes und rings herum mit
Aiffen belegte Sitzbänke vervollständigen das Mobiliar.
Der größte Raum des ganzen Baues ist der Festsaal
(s. Taf. 20) — ein weiter rechteckiger Raum mit ziemlich
roh (durch Aöpfe in Aartuschen) bemalter Decke, von welcher
die höchst originellen, wenn auch in den Details etwas
flüchtig ausgefallenen Aronleuchter herabhängen (Abb. f \ >{).
Die Wände zeigen in ihrer oberen pälfte, in gleichfalls
roher Ausführung, die Bildnisse Braunschweig-Lüneburgi-
scher perzöge resp. Herzoginnen; zum Besten gehört hier
;;2. Beschläg zu
dem in abgebildeteu
Wandschrank.
„Rathsstube". An den Leitenwänden sehen wir je eine große
Tafel mit einigen hundert gemalten Familienwappen; der
Grundton dieses Raumes ist roth. Tine fast schmucklose
Polztreppe führt uns von hier direkt in die sogenannte
„Laube", den Gerichtssaal in guter alter Zeit; die hohen
Fenster zeigen reiche Glasmalerei, zuin Theil figürlichen,
zum Theil heraldischen Inhalts; neben einigen Familien-
wappen (Albert von Dassel) und Inschriften, finden wir
des öfteren wiederkehrend den Braunschweiger Löwen und
das Wappen der Stadt Lüneburg. Decke und Wände sind
überreich bemalt, erstere 1^880 vom Maler Fischbach, einem
geborenen Lüneburger, nach alten Borbildern in etwas
harter bunt ausschauender Weise, restaurirt, die Wände,
auf Gedon's Rath von den Münchener Malern Ruhm-
brecht und Aellner restaurirt, sehen stimmungsvoller, alt
und verblichen aus; meiner Ansicht nach aber tritt das
Tharakteristische der Münchener Schule damaliger Zeit etwas
zu stark hervor; es fällt das ins-
besondere auf in dem Reiterbildnisse
Aaiser Maximilian's, angeblich einst
von Albrecht Dürer auf einer Durch-
reise gemalt (?). Zur Darstellung
gelangten Scenen biblischen Inhalts,
Motive aus dem Landsknechtleben,
eingeschlossen, resp. umrahmt von
gothischem oder gothisirendem Or-
nament; ferner interessiren hier reich
geschnitzte gothische Wandschränke
mit schönen schmiedeisernen Be-
schlägen. Dieselben bargen während
des 30 jährigen Arieges den oben
erwähnten Silberschatz (siehe die
Abb. P0, \\2 und P3).
Das ziemlich unbedeutende Ge-
stühl, zuin Theil aus Sandstein,
zum Theil aus polz zeigt als Dccor
im srsteren Falle Aartuschen und
Wappen, der hölzerne Theil ist durch Intarsien geschmückt.
Der gemusterte Fußboden zeigt neben rohem, roth und
dunkelbraun glasirtem Backstein, graue, abwechselnd mit
einem schwarzen Stern, resp. Löwen, in Art der bekannten
Mettlacher Mosaikplatten hergestellten Belag: als einziges
Ueberbleibsel der ^37)[ zerstörten Burg (auf dem „Aalk-
berg", auf alten Stichen bildlich dargestellt) des Raubritters
Magnus Torquatus.
Bon der Laube führen ein paar Stufen durch einen
schmalen, finsteren Gang in's eheinalige „Archiv", ein
kleiner gemüthlicher Raum, bemerkenswerth sind die durch
geschnitzte Maaßwcrksriese und schöne gothische Beschläge
gezierten Wandschränke, ferner ein Tisch in der Mitte des
Raumes und ein kleiner gothischer Aronleuchter, der vom
Areuzgewölbe herabhängt. — Gegenwärtig birgt dieser
Raum alte Documente, einige Pistolen mit Luntenschloß und
dergl. Raritäten; auch der Schinken- und Brustknochen jener
berühmten 5au, der „Tntdeckerin" der Soolquelle, hat
hier Aufnahme gefunden, von den Besuchern, Jung und
Alt, als etwas ganz besonderes angestauut und bewundert!
Bon hier geht's zurück zur sogenannten „Aürkammer"
— (oder Aörkammer), in diesem Zimmerchen fand ehemals
die etwa nothwendig werdende Bürgermeisterwahl statt,
und wurde ein hoher Rath so lange unter Schloß und
Riegel gehalten, bis eine definitive Tinigung erzielt war.
Hoc erat in more majorum. Ts ist dieses der bis dato
noch in keiner Weise restaurirte Raum des ganzen paufes,
die offenen Wandschränke zeigen einen ziemlich breiten,
buntbemalten, geschnitzten, gothischen Fries, außer Maaß-
werk, sind alle möglichen Thiergestalten, Pferde, Aameele,
Bären, punde rc., zur Darstellung gekommen. Der Pla-
fond ist leicht bemalt, über dem noch vorhandenen Aamin
;;3. Wandschrank in der „Laube" des Lüneburger Rathhauses.
Gezeichnet von <£. F. Weyßer.
sehen wir ein auf Leinwand gemaltes Weiblein, rechts
und links ein Wappenschild haltend; die Fenster zeigen in
Glasmalerei Bürgermeistergestalten. Tin schwerer Tichen
tisch in der Mitte des Raumes und rings herum mit
Aiffen belegte Sitzbänke vervollständigen das Mobiliar.
Der größte Raum des ganzen Baues ist der Festsaal
(s. Taf. 20) — ein weiter rechteckiger Raum mit ziemlich
roh (durch Aöpfe in Aartuschen) bemalter Decke, von welcher
die höchst originellen, wenn auch in den Details etwas
flüchtig ausgefallenen Aronleuchter herabhängen (Abb. f \ >{).
Die Wände zeigen in ihrer oberen pälfte, in gleichfalls
roher Ausführung, die Bildnisse Braunschweig-Lüneburgi-
scher perzöge resp. Herzoginnen; zum Besten gehört hier
;;2. Beschläg zu
dem in abgebildeteu
Wandschrank.