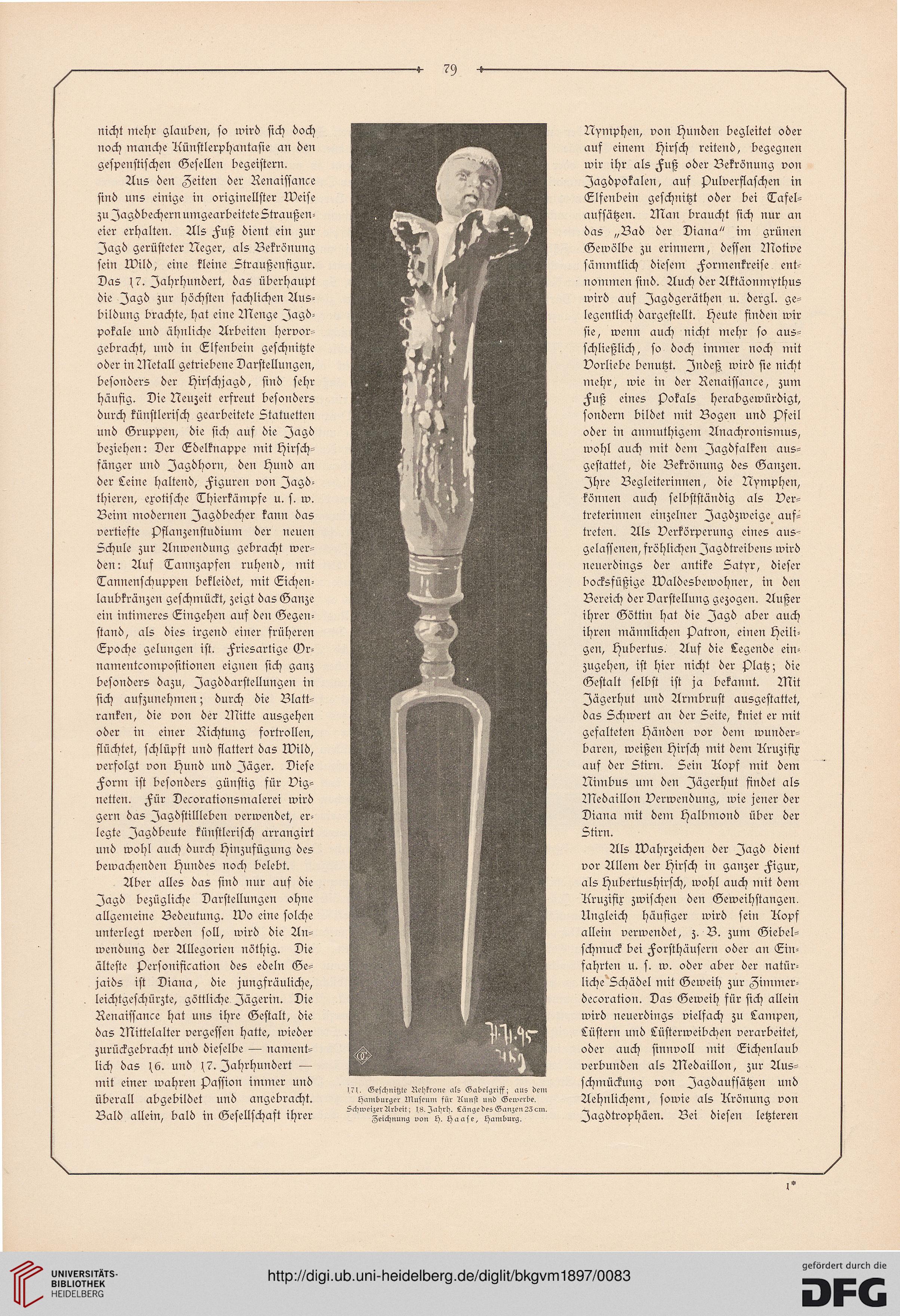■+• 79 ■+
/
\
nicht mehr glauben, so wird sich doch
noch manche Künstlerphantasie an den
gespenstischen Gesellen begeistern.
Aus den Zeiten der Renaissance
sind uns einige in originellster Meise
zu Jagdbechern umgearbeitcte Straußen-
eier erhalten. Als Fuß dient ein zur
Jagd gerüsteter Neger, als Bekrönung
sein Wild, eine kleine Straußenfigur.
Das \7. Jahrhundert, das überhaupt
die Jagd zur höchsten fachlichen Aus-
bildung brachte, hat eine Menge Jagd-
pokale und ähnliche Arbeiten hervor-
gebracht, und in Elfenbein geschnitzte
oder in Metall getriebene Darstellungen,
besonders der Hirschjagd, sind sehr-
häufig. Die Neuzeit erfreut besonders
durch künstlerisch gearbeitete Statuetten
und Gruppen, die sich auf die Jagd
beziehen: Der Edelknappe mit Hirsch-
fänger und Jagdhorn, den Hund an
der Leine haltend, Figuren von Jagd-
thieren, exotische Thierkämpfe u. s. w.
Beim modernen Jagdbecher kann das
vertiefte Pflanzenstudium der neuen
Schule zur Anwendung gebracht wer-
den: Auf Tannzapfen ruhend, mit
Tannenschuppen bekleidet, mit Eichen-
laubkränzen geschmückt, zeigt das Ganze
ein intimeres Eingehen auf den Gegen-
stand, als dies irgend einer früheren
Epoche gelungen ist. Friesarlige Or-
namentcompositionen eignen sich ganz
besonders dazu, Jagddarstellungen in
sich aufzunehmen; durch die Blatt-
ranken, die von der Mitte ausgehen
oder in einer Richtung fortrollen,
flüchtet, schlüpft und flattert das Wild,
verfolgt von Hund und Jäger. Diese
Form ist besonders günstig für Vig-
netten. Für Decorationsmalerei wird
gern das Jagdstillleben verwendet, er-
legte Jagdbeute künstlerisch arrangirt
und wohl auch durch hinzusügung des
bewachenden Hundes noch belebt.
Aber alles das sind nur auf die
Jagd bezügliche Darstellungen ohne
allgeineine Bedeutung. Wo eine solche
unterlegt werden soll, wird die An-
wendung der Allegorien nöthig. Die
älteste personification des edeln Ge-
jaids ist Diana, die jungfräuliche,
leichtgeschürzte, göttliche Jägerin. Die
Renaissance hat uns ihre Gestalt, die
das Mittelalter vergessen hatte, wieder
zurückgebracht und dieselbe — nament-
lich das f6. und f7. Jahrhundert —
mit einer wahren Passion immer und
überall abgebildet und angebracht.
Bald allein, bald in Gesellschaft ihrer
Geschnitzte Rehkrone als Gabelgriff; aus dem
Hamburger Museum für Aunst und Gewerbe.
Schweizer Arbeit; ^8.Iahrh. Länge des Ganzen 23 cm.
Zeichnung von £). Haafe, Hamburg.
Nymphen, von Hunden begleitet oder
auf einem Hirsch reitend, begegnen
wir ihr als Fuß oder Bekrönung von
Jagdpokalen, auf Pulverflaschen in
Elfenbein geschnitzt oder bei Tafel-
aufsätzen. Man braucht sich nur an
das „Bad der Diana" im grünen
Gewölbe zu erinnern, dessen Motive
sämmtlich diesem Formenkreise ent-
nommen sind. Auch der Aktäonmythus
wird auf Jagdgeräthen u. dergl. ge-
legentlich dargestellt, heute finden wir
sie, wenn auch nicht mehr so aus-
schließlich, so doch immer noch mit
Vorliebe benutzt. Indeß wird sie nicht
mehr, wie in der Renaissance, zum
Fuß eines Pokals herabgewürdigt,
sondern bildet mit Bogen und Pfeil
oder in anmuthigem Anachronismus,
wohl auch mit dem Jagdfalken aus-
gestattet, die Bekrönung des Ganzen.
Ihre Begleiterinnen, die Nymphen,
können auch selbstständig als Ver-
treterinnen einzelner Jagdzweige auf-
treten. Als Verkörperung eines aus-
gelassenen, fröhlichen Jagdtreibens wird
neuerdings der antike Satyr, dieser
bocksfüßige Waldesbewohner, in den
Bereich der Darstellung gezogen. Außer
ihrer Göttin hat die Jagd aber auch
ihren männlichen Patron, einen heili-
gen, Hubertus. Auf die Legende ein-
zugehen, ist hier nicht der Platz; die
Gestalt selbst ist ja bekannt. Mit
Jägerhut und Armbrust ausgestattet,
das Schwert an der Seite, kniet er mit
gefalteten Händen vor dem wunder-
baren, weißen Hirsch mit dem Kruzifix
aus der Stirn. Sein Kopf mit dem
Nimbus um den Jägerhut findet als
Medaillon Verwendung, wie jener der
Diana mit dem Halbmond über der
Stirn.
Als Wahrzeichen der Jagd dient
vor Allem der Hirsch in ganzer Figur,
als Hubertushirsch, wohl auch mit dem
Kruzifix zwischen den Geweihstangen.
Ungleich häufiger wird sein Kops
allein verwendet, z. B. zum Giebel-
schmuck bei Forsthäusern oder an Ein-
fahrten u. s. w. oder aber der natür-
liche Schädel mit Geweih zur Zimmer-
decoration. Das Geweih für sich allein
wird neuerdings vielfach zu Lampen,
Lüstern und Lüsterweibchen verarbeitet,
oder auch sinnvoll mit Eichenlaub
verbunden als Medaillon, zur Aus-
schmückung von Jagdaufsätzen und
Aehnlichem, sowie als Krönung von
Jagdtrophäen. Bei diesen letzteren
i
/
/
\
nicht mehr glauben, so wird sich doch
noch manche Künstlerphantasie an den
gespenstischen Gesellen begeistern.
Aus den Zeiten der Renaissance
sind uns einige in originellster Meise
zu Jagdbechern umgearbeitcte Straußen-
eier erhalten. Als Fuß dient ein zur
Jagd gerüsteter Neger, als Bekrönung
sein Wild, eine kleine Straußenfigur.
Das \7. Jahrhundert, das überhaupt
die Jagd zur höchsten fachlichen Aus-
bildung brachte, hat eine Menge Jagd-
pokale und ähnliche Arbeiten hervor-
gebracht, und in Elfenbein geschnitzte
oder in Metall getriebene Darstellungen,
besonders der Hirschjagd, sind sehr-
häufig. Die Neuzeit erfreut besonders
durch künstlerisch gearbeitete Statuetten
und Gruppen, die sich auf die Jagd
beziehen: Der Edelknappe mit Hirsch-
fänger und Jagdhorn, den Hund an
der Leine haltend, Figuren von Jagd-
thieren, exotische Thierkämpfe u. s. w.
Beim modernen Jagdbecher kann das
vertiefte Pflanzenstudium der neuen
Schule zur Anwendung gebracht wer-
den: Auf Tannzapfen ruhend, mit
Tannenschuppen bekleidet, mit Eichen-
laubkränzen geschmückt, zeigt das Ganze
ein intimeres Eingehen auf den Gegen-
stand, als dies irgend einer früheren
Epoche gelungen ist. Friesarlige Or-
namentcompositionen eignen sich ganz
besonders dazu, Jagddarstellungen in
sich aufzunehmen; durch die Blatt-
ranken, die von der Mitte ausgehen
oder in einer Richtung fortrollen,
flüchtet, schlüpft und flattert das Wild,
verfolgt von Hund und Jäger. Diese
Form ist besonders günstig für Vig-
netten. Für Decorationsmalerei wird
gern das Jagdstillleben verwendet, er-
legte Jagdbeute künstlerisch arrangirt
und wohl auch durch hinzusügung des
bewachenden Hundes noch belebt.
Aber alles das sind nur auf die
Jagd bezügliche Darstellungen ohne
allgeineine Bedeutung. Wo eine solche
unterlegt werden soll, wird die An-
wendung der Allegorien nöthig. Die
älteste personification des edeln Ge-
jaids ist Diana, die jungfräuliche,
leichtgeschürzte, göttliche Jägerin. Die
Renaissance hat uns ihre Gestalt, die
das Mittelalter vergessen hatte, wieder
zurückgebracht und dieselbe — nament-
lich das f6. und f7. Jahrhundert —
mit einer wahren Passion immer und
überall abgebildet und angebracht.
Bald allein, bald in Gesellschaft ihrer
Geschnitzte Rehkrone als Gabelgriff; aus dem
Hamburger Museum für Aunst und Gewerbe.
Schweizer Arbeit; ^8.Iahrh. Länge des Ganzen 23 cm.
Zeichnung von £). Haafe, Hamburg.
Nymphen, von Hunden begleitet oder
auf einem Hirsch reitend, begegnen
wir ihr als Fuß oder Bekrönung von
Jagdpokalen, auf Pulverflaschen in
Elfenbein geschnitzt oder bei Tafel-
aufsätzen. Man braucht sich nur an
das „Bad der Diana" im grünen
Gewölbe zu erinnern, dessen Motive
sämmtlich diesem Formenkreise ent-
nommen sind. Auch der Aktäonmythus
wird auf Jagdgeräthen u. dergl. ge-
legentlich dargestellt, heute finden wir
sie, wenn auch nicht mehr so aus-
schließlich, so doch immer noch mit
Vorliebe benutzt. Indeß wird sie nicht
mehr, wie in der Renaissance, zum
Fuß eines Pokals herabgewürdigt,
sondern bildet mit Bogen und Pfeil
oder in anmuthigem Anachronismus,
wohl auch mit dem Jagdfalken aus-
gestattet, die Bekrönung des Ganzen.
Ihre Begleiterinnen, die Nymphen,
können auch selbstständig als Ver-
treterinnen einzelner Jagdzweige auf-
treten. Als Verkörperung eines aus-
gelassenen, fröhlichen Jagdtreibens wird
neuerdings der antike Satyr, dieser
bocksfüßige Waldesbewohner, in den
Bereich der Darstellung gezogen. Außer
ihrer Göttin hat die Jagd aber auch
ihren männlichen Patron, einen heili-
gen, Hubertus. Auf die Legende ein-
zugehen, ist hier nicht der Platz; die
Gestalt selbst ist ja bekannt. Mit
Jägerhut und Armbrust ausgestattet,
das Schwert an der Seite, kniet er mit
gefalteten Händen vor dem wunder-
baren, weißen Hirsch mit dem Kruzifix
aus der Stirn. Sein Kopf mit dem
Nimbus um den Jägerhut findet als
Medaillon Verwendung, wie jener der
Diana mit dem Halbmond über der
Stirn.
Als Wahrzeichen der Jagd dient
vor Allem der Hirsch in ganzer Figur,
als Hubertushirsch, wohl auch mit dem
Kruzifix zwischen den Geweihstangen.
Ungleich häufiger wird sein Kops
allein verwendet, z. B. zum Giebel-
schmuck bei Forsthäusern oder an Ein-
fahrten u. s. w. oder aber der natür-
liche Schädel mit Geweih zur Zimmer-
decoration. Das Geweih für sich allein
wird neuerdings vielfach zu Lampen,
Lüstern und Lüsterweibchen verarbeitet,
oder auch sinnvoll mit Eichenlaub
verbunden als Medaillon, zur Aus-
schmückung von Jagdaufsätzen und
Aehnlichem, sowie als Krönung von
Jagdtrophäen. Bei diesen letzteren
i
/