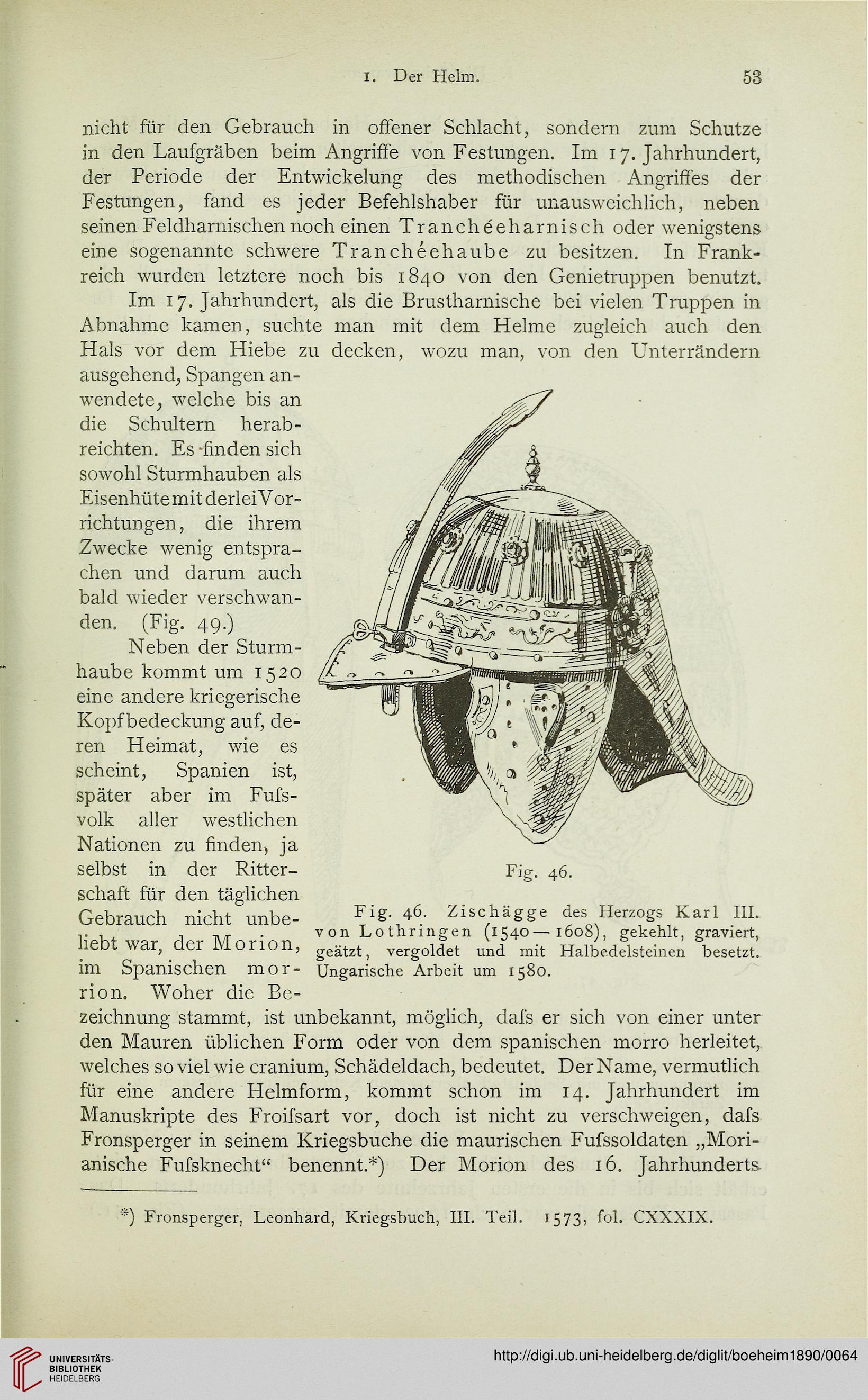i. Der Helm.
53
nicht für den Gebrauch in offener Schlacht, sondern zum Schutze
in den Laufgräben beim Angriffe von Festungen. Im 17. Jahrhundert,
der Periode der Entwicklung des methodischen Angriffes der
Festungen, fand es jeder Befehlshaber für unausweichlich, neben
seinen Feldharnischen noch einen Trancheeharnisch oder wenigstens
eine sogenannte schwere Trancheehaube zu besitzen. In Frank-
reich wurden letztere noch bis 1840 von den Genietruppen benutzt.
Im 17. Jahrhundert, als die Brustharnische bei vielen Truppen in
Abnahme kamen, suchte man mit dem Helme zugleich auch den
Hals vor dem Hiebe zu decken, wozu man, von den Unterrändern
ausgehend, Spangen an-
wendete, welche bis an
die Schultern herab-
reichten. Es -finden sich
sowohl Sturmhauben als
Eisenhüte mit derlei Vor-
richtungen , die ihrem
Zwecke wenig entspra-
chen und darum auch
bald wieder verschwan-
den. (Fig. 49.)
Neben der Sturm-
haube kommt um 1520
eine andere kriegerische
Kopfbedeckung auf, de-
ren Heimat, wie es
scheint, Spanien ist,
später aber im Fufs-
volk aller westlichen
Nationen zu finden, ja
selbst in der Ritter- Fig. 46.
Schaft für den täglichen
Gebrauch nicht unbe- ^.46. Zischägge des Herzogs Karl III.
Kphtwsr rWMnn-n-n von Lothringen (1540-1608), gekehlt, graviert,
lieDt war, der MOrion, geätzt) vergoldet und mit Halbedelsteinen besetzt,
im Spanischen mor- Ungarische Arbeit um 1580.
rion. Woher die Be-
zeichnung stammt, ist unbekannt, möglich, dafs er sich von einer unter
den Mauren üblichen Form oder von dem spanischen morro herleitet,
welches so viel wie cranium, Schädeldach, bedeutet. Der Name, vermutlich
für eine andere Helmform, kommt schon im 14. Jahrhundert im
Manuskripte des Froifsart vor, doch ist nicht zu verschweigen, dafs
Fronsperger in seinem Kriegsbuche die maurischen Fufssoldaten „Mori-
anische Fufsknecht" benennt.*) Der Morion des 16. Jahrhunderts-
*) Fronsperger, Leonhard, Kriegsbuch, III. Teil. 1573, CXXXIX.
53
nicht für den Gebrauch in offener Schlacht, sondern zum Schutze
in den Laufgräben beim Angriffe von Festungen. Im 17. Jahrhundert,
der Periode der Entwicklung des methodischen Angriffes der
Festungen, fand es jeder Befehlshaber für unausweichlich, neben
seinen Feldharnischen noch einen Trancheeharnisch oder wenigstens
eine sogenannte schwere Trancheehaube zu besitzen. In Frank-
reich wurden letztere noch bis 1840 von den Genietruppen benutzt.
Im 17. Jahrhundert, als die Brustharnische bei vielen Truppen in
Abnahme kamen, suchte man mit dem Helme zugleich auch den
Hals vor dem Hiebe zu decken, wozu man, von den Unterrändern
ausgehend, Spangen an-
wendete, welche bis an
die Schultern herab-
reichten. Es -finden sich
sowohl Sturmhauben als
Eisenhüte mit derlei Vor-
richtungen , die ihrem
Zwecke wenig entspra-
chen und darum auch
bald wieder verschwan-
den. (Fig. 49.)
Neben der Sturm-
haube kommt um 1520
eine andere kriegerische
Kopfbedeckung auf, de-
ren Heimat, wie es
scheint, Spanien ist,
später aber im Fufs-
volk aller westlichen
Nationen zu finden, ja
selbst in der Ritter- Fig. 46.
Schaft für den täglichen
Gebrauch nicht unbe- ^.46. Zischägge des Herzogs Karl III.
Kphtwsr rWMnn-n-n von Lothringen (1540-1608), gekehlt, graviert,
lieDt war, der MOrion, geätzt) vergoldet und mit Halbedelsteinen besetzt,
im Spanischen mor- Ungarische Arbeit um 1580.
rion. Woher die Be-
zeichnung stammt, ist unbekannt, möglich, dafs er sich von einer unter
den Mauren üblichen Form oder von dem spanischen morro herleitet,
welches so viel wie cranium, Schädeldach, bedeutet. Der Name, vermutlich
für eine andere Helmform, kommt schon im 14. Jahrhundert im
Manuskripte des Froifsart vor, doch ist nicht zu verschweigen, dafs
Fronsperger in seinem Kriegsbuche die maurischen Fufssoldaten „Mori-
anische Fufsknecht" benennt.*) Der Morion des 16. Jahrhunderts-
*) Fronsperger, Leonhard, Kriegsbuch, III. Teil. 1573, CXXXIX.