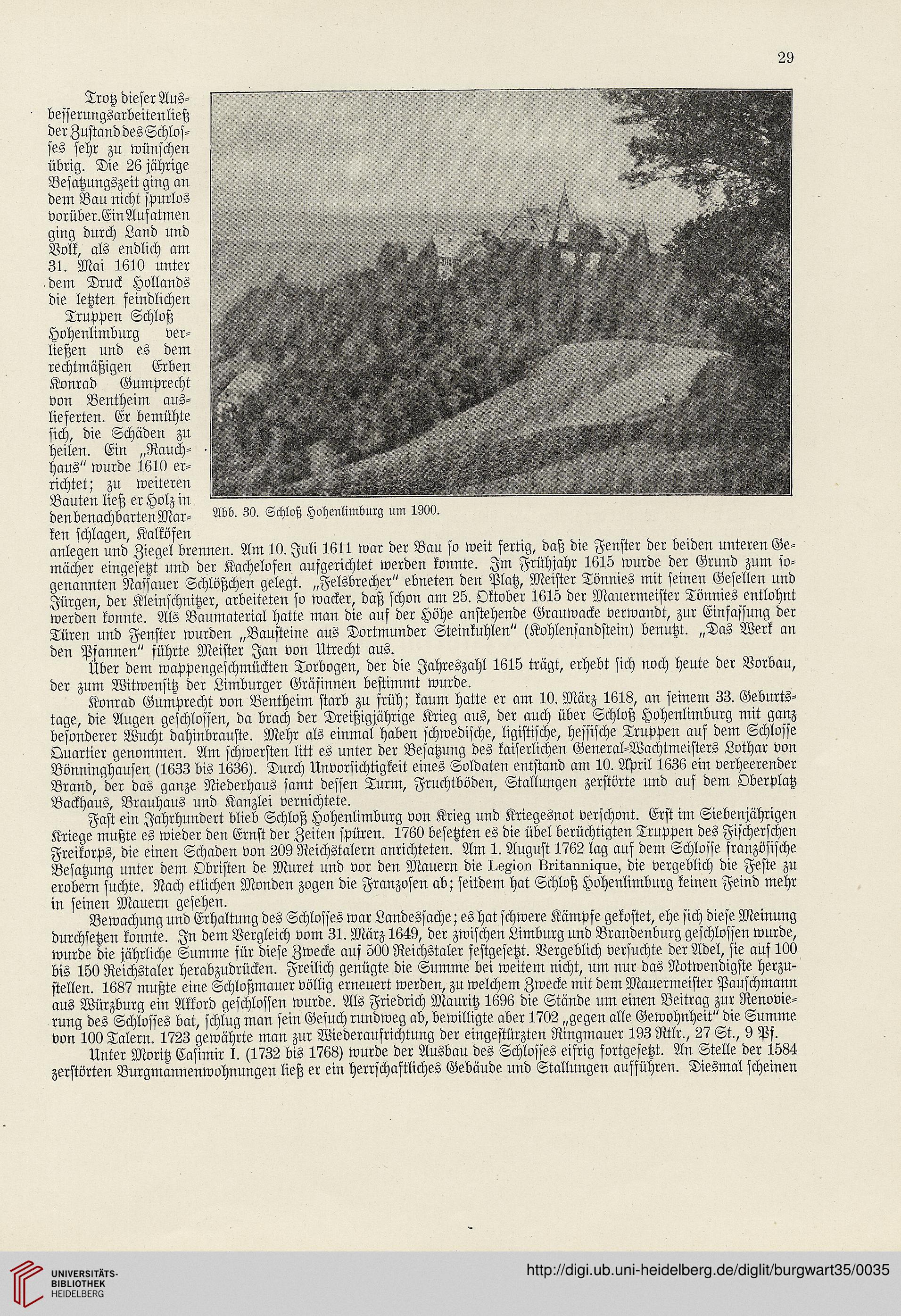29
Trotz dieser Aus-
besserungsarbeitenließ
der Zustand des Schlos-
ses sehr zu wünschen
übrig. Die 26 jährige
Besatzungszeit ging an
dem Bari nicht spurlos
vorüber.EinAufatmen
ging durch Land und
Volk, als endlich am
31. Mai 1610 unter
dem Druck Hollands
die letzten feindlichen
Truppen Schloß
Hohenlimburg ver-
ließen und es dem
rechtmäßigen Erben
Konrad Gumprecht
von Bentheim aus-
lieferten. Er bemühte
sich, die Schäden zu
heilen. Ein „Rauch-
haus" wurde 1610 er-
richtet; zu weiteren
Bauten ließ er Holz in
denbenachbarten Mar-
ken schlagen, Kalköfen
anlegen und Ziegel brennen. Am 10. Juli 1611 war der Bau so weit fertig, daß die Fenster der beiden unteren Ge-
mächer eingesetzt und der Kachelofen aufgerichtet werden konnte. Im Frühjahr 1615 wurde der Grund zum so-
genannten Nassauer Schlößchen gelegt. „Felsbrecher" ebneten den Platz, Meister Tönnies mit seinen Gesellen und
Jürgen, der Kleinschnitzer, arbeiteten so wacker, daß schon am 25. Oktober 1615 der Mauermeister Tönnies entlohnt
werden konnte. Als Baumaterial hatte man die auf der Höhe anstehende Grauwacke verwandt, zur Einfassung der
Türen und Fenster wurden „Bausteine aus Dortmunder Steinkuhlen" (Kohlensandstein) benutzt. „Das Werk an
den Pfannen" führte Meister Jan von Utrecht aus.
Über dem wappengeschmückten Torbogen, der die Jahreszahl 1615 trägt, erhebt sich noch heute der Vorbau,
der zum Witwensitz der Limburger Gräfinnen bestimmt wurde.
Konrad Gumprecht von Bentheim starb zu früh; kaum hatte er am 10. März 1618, an seinem 33. Geburts-
tage, die Augen geschlossen, da brach der Dreißigjährige Krieg aus, der auch über Schloß Hohenlimburg mit ganz
besonderer Wucht dahinbrauste. Mehr als einmal haben schwedische, ligistische, hessische Truppen aus dem Schlosse
Quartier genommen. Am schwersten litt es unter der Besatzung des kaiserlichen General-Wachtmeisters Lothar von
Bönninghausen (1633 bis 1636). Durch Unvorsichtigkeit eines Soldaten entstand am 10. Ahril 1636 ein verheerender
Brand, der das ganze Niederhaus samt dessen Turm, Fruchtböden, Stallungen zerstörte und auf dem Oberplatz
Backhaus, Brauhaus und Kanzlei vernichtete.
Fast ein Jahrhundert blieb Schloß Hohenlimburg von Krieg und Kriegesnot verschont. Erst inr Siebenjährigen
Kriege mußte es wieder den Ernst der Zeiten spüren. 1760 besetzten es die übel berüchtigten Truppen des Fischerschen
Freikorps, die einen Schaden von 209 Reichstalern anrichteten. Am 1. August 1762 lag auf dem Schlosse französische
Besatzung unter dem Obristen de Muret und vor den Mauern die UsZion Lritannigne, die vergeblich die Feste zu
erobern suchte. Nach etlichen Monden zogen die Franzosen ab; seitdem hat Schloß Hohenlimburg keinen Feind mehr
in seinen Mauern gesehen.
Bewachung und Erhaltung des Schlosses war Landessache; es hat schwere Kämpfe gekostet, ehe sich diese Meinung
durchsetzen konnte. In dem Vergleich vom 31. März 1649, der zwischen Limburg und Brandenburg geschlossen wurde,
wurde die jährliche Summe für diese Zwecke aus 500 Reichstaler festgesetzt. Vergeblich versuchte der Adel, sie auf 100
bis 150 Reichstaler herabzudrücken. Freilich genügte die Summe bei weitem nicht, um nur das Notwendigste herzu-
stellen. 1687 mußte eine Schloßmauer völlig erneuert werden, zu welchem Zwecke mit dem Mauermeister Pauschmann
aus Würzburg ein Akkord geschlossen wurde. Als Friedrich Mauritz 1696 die Stände um einen Beitrag zur Renovie-
rung des Schlosses bat, schlug man sein Gesuch rundweg ab, bewilligte aber 1702 „gegen alle Gewohnheit" die Summe
von 100 Talern. 1723 gewährte man zur Wiederaufrichtung der eingestürzten Ringmauer 193 Rtlr., 27 St., 9 Pf.
Unter Moritz Casimir I. (1732 bis 1768) wurde der Ausbau des Schlosses eifrig fortgesetzt. An Stelle der 1584
zerstörten Burgmannenwohnungen ließ er ein herrschaftliches Gebäude und Stallungen aufführen. Diesmal scheinen
Trotz dieser Aus-
besserungsarbeitenließ
der Zustand des Schlos-
ses sehr zu wünschen
übrig. Die 26 jährige
Besatzungszeit ging an
dem Bari nicht spurlos
vorüber.EinAufatmen
ging durch Land und
Volk, als endlich am
31. Mai 1610 unter
dem Druck Hollands
die letzten feindlichen
Truppen Schloß
Hohenlimburg ver-
ließen und es dem
rechtmäßigen Erben
Konrad Gumprecht
von Bentheim aus-
lieferten. Er bemühte
sich, die Schäden zu
heilen. Ein „Rauch-
haus" wurde 1610 er-
richtet; zu weiteren
Bauten ließ er Holz in
denbenachbarten Mar-
ken schlagen, Kalköfen
anlegen und Ziegel brennen. Am 10. Juli 1611 war der Bau so weit fertig, daß die Fenster der beiden unteren Ge-
mächer eingesetzt und der Kachelofen aufgerichtet werden konnte. Im Frühjahr 1615 wurde der Grund zum so-
genannten Nassauer Schlößchen gelegt. „Felsbrecher" ebneten den Platz, Meister Tönnies mit seinen Gesellen und
Jürgen, der Kleinschnitzer, arbeiteten so wacker, daß schon am 25. Oktober 1615 der Mauermeister Tönnies entlohnt
werden konnte. Als Baumaterial hatte man die auf der Höhe anstehende Grauwacke verwandt, zur Einfassung der
Türen und Fenster wurden „Bausteine aus Dortmunder Steinkuhlen" (Kohlensandstein) benutzt. „Das Werk an
den Pfannen" führte Meister Jan von Utrecht aus.
Über dem wappengeschmückten Torbogen, der die Jahreszahl 1615 trägt, erhebt sich noch heute der Vorbau,
der zum Witwensitz der Limburger Gräfinnen bestimmt wurde.
Konrad Gumprecht von Bentheim starb zu früh; kaum hatte er am 10. März 1618, an seinem 33. Geburts-
tage, die Augen geschlossen, da brach der Dreißigjährige Krieg aus, der auch über Schloß Hohenlimburg mit ganz
besonderer Wucht dahinbrauste. Mehr als einmal haben schwedische, ligistische, hessische Truppen aus dem Schlosse
Quartier genommen. Am schwersten litt es unter der Besatzung des kaiserlichen General-Wachtmeisters Lothar von
Bönninghausen (1633 bis 1636). Durch Unvorsichtigkeit eines Soldaten entstand am 10. Ahril 1636 ein verheerender
Brand, der das ganze Niederhaus samt dessen Turm, Fruchtböden, Stallungen zerstörte und auf dem Oberplatz
Backhaus, Brauhaus und Kanzlei vernichtete.
Fast ein Jahrhundert blieb Schloß Hohenlimburg von Krieg und Kriegesnot verschont. Erst inr Siebenjährigen
Kriege mußte es wieder den Ernst der Zeiten spüren. 1760 besetzten es die übel berüchtigten Truppen des Fischerschen
Freikorps, die einen Schaden von 209 Reichstalern anrichteten. Am 1. August 1762 lag auf dem Schlosse französische
Besatzung unter dem Obristen de Muret und vor den Mauern die UsZion Lritannigne, die vergeblich die Feste zu
erobern suchte. Nach etlichen Monden zogen die Franzosen ab; seitdem hat Schloß Hohenlimburg keinen Feind mehr
in seinen Mauern gesehen.
Bewachung und Erhaltung des Schlosses war Landessache; es hat schwere Kämpfe gekostet, ehe sich diese Meinung
durchsetzen konnte. In dem Vergleich vom 31. März 1649, der zwischen Limburg und Brandenburg geschlossen wurde,
wurde die jährliche Summe für diese Zwecke aus 500 Reichstaler festgesetzt. Vergeblich versuchte der Adel, sie auf 100
bis 150 Reichstaler herabzudrücken. Freilich genügte die Summe bei weitem nicht, um nur das Notwendigste herzu-
stellen. 1687 mußte eine Schloßmauer völlig erneuert werden, zu welchem Zwecke mit dem Mauermeister Pauschmann
aus Würzburg ein Akkord geschlossen wurde. Als Friedrich Mauritz 1696 die Stände um einen Beitrag zur Renovie-
rung des Schlosses bat, schlug man sein Gesuch rundweg ab, bewilligte aber 1702 „gegen alle Gewohnheit" die Summe
von 100 Talern. 1723 gewährte man zur Wiederaufrichtung der eingestürzten Ringmauer 193 Rtlr., 27 St., 9 Pf.
Unter Moritz Casimir I. (1732 bis 1768) wurde der Ausbau des Schlosses eifrig fortgesetzt. An Stelle der 1584
zerstörten Burgmannenwohnungen ließ er ein herrschaftliches Gebäude und Stallungen aufführen. Diesmal scheinen