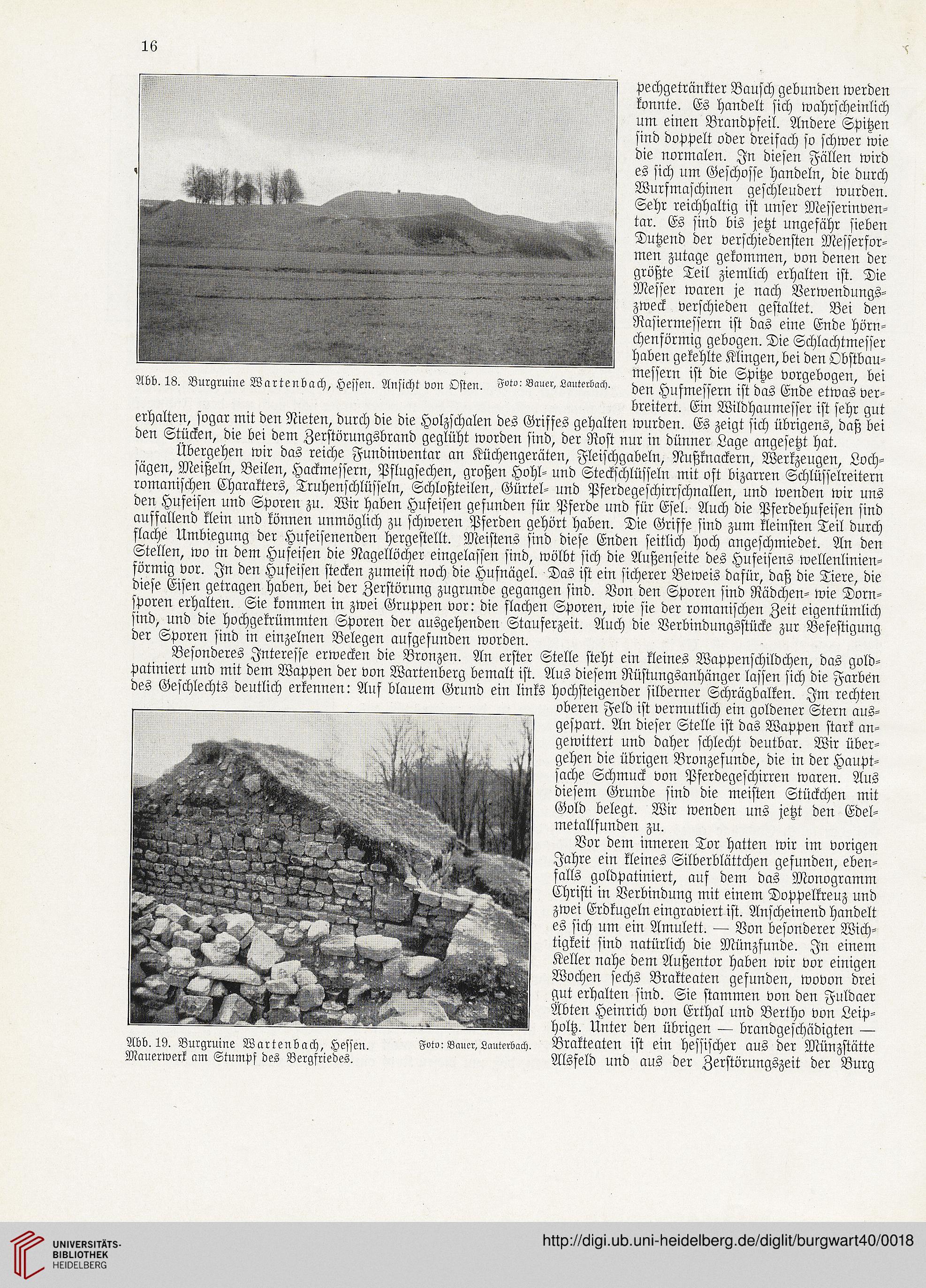16
pechgetränkter Bausch gebunden werden
konnte. Es handelt sich wahrscheinlich
um einen Brandpfeil. Andere Spitzen
sind doppelt oder dreifach so schwer wie
die normalen. In diesen Fällen wird
es sich um Geschosse handeln, die durch
Wurfmaschinen geschleudert wurden.
Sehr reichhaltig ist unser Messerinven-
tar. Es sind bis jetzt ungefähr sieben
Dutzend der verschiedensten Messerfor-
men zutage gekommen, von denen der
größte Teil ziemlich erhalten ist. Die
Messer waren je nach Verwendungs-
zweck verschieden gestaltet. Bei den
Rasiermessern ist das eine Ende hörn-
chensörmig gebogen. Die Schlachtmesser
haben gekehlte Klingen, bei den Obstbau-
messern ist die Spitze vorgebogen, bei
den Hufmessern ist das Ende etwas ver-
breitert. Ein Wildhaumesser ist sehr gut
erhalten, sogar mit den Nieten, durch die die Holzschalen des Griffes gehalten wurden. Es zeigt sich übrigens, daß bei
den Stücken, die bei dem Zerstörungsbrand geglüht worden sind, der Rost nur in dünner Lage angesetzt hat.
Übergehen wir das reiche Fundinventar an Küchengeräten, Fleischgabeln, Nußknackern, Werkzeugen, Loch-
sägen, Meißeln, Beilen, Hackmessern, Pflugsechen, großen Hohl- und Steckschlüsseln mit oft bizarren Schlüsselreitern
romanischen Charakters, Truhenschlüsseln, Schloßteilen, Gürtel- und Pferdegeschirrschnallen, und wenden wir uns
den Hufeisen und Sporen zu. Wir haben Hufeisen gefunden für Pferde und für Esel. Auch die Pferdehufeisen sind
auffallend klein und können unmöglich zu schweren Pferden gehört haben. Die Griffe sind zum kleinsten Teil durch
flache Umbiegung der Hufeisenenden hergestellt. Meistens sind diese Enden seitlich hoch angeschmiedet. An den
Stellen, wo in dem Hufeisen die Nagellöcher eingelassen sind, wölbt sich die Außenseite des Hufeisens wellenlinien-
förmig vor. In den Hufeisen stecken zumeist noch die Hufnägel. Das ist ein sicherer Beweis dafür, daß die Tiere, die
diese Eisen getragen haben, bei der Zerstörung zugrunde gegangen sind. Von den Sporen sind Rädchen- wie Dorn-
sporen erhalten. Sie kommen in zwei Gruppen vor: die flachen Sporen, wie sie der romanischen Zeit eigentümlich
sind, und die hochgekrümmten Sporen der ausgehenden Stauferzeit. Auch die Verbindungsstücke zur Befestigung
der Sporen sind in einzelnen Belegen aufgefunden worden.
Besonderes Interesse erwecken die Bronzen. An erster Stelle steht ein kleines Wappenschildchen, das gold-
patiniert und mit dem Wappen der von Wartenberg bemalt ist. Aus diesem Rüstungsanhänger lassen sich die Farben
des Geschlechts deutlich erkennen: Auf blauem Grund ein links hochsteigender silberner Schrägbalken. Im rechten
oberen Feld ist vermutlich ein goldener Stern aus-
gespart. An dieser Stelle ist das Wappen stark an-
gewittert und daher schlecht deutbar. Wir über-
gehen die übrigen Bronzefunde, die in der Haupt-
sache Schmuck von Pferdegeschirren waren. Aus
diesem Grunde sind die meisten Stückchen mit
Gold belegt. Wir wenden uns jetzt den Edel-
metallfunden zu.
Vor dem inneren Tor hatten wir im vorigen
Jahre ein kleines Silberblättchen gefunden, eben-
falls goldpatiniert, auf dem das Monogramm
Christi in Verbindung mit einem Doppelkreuz und
zwei Erdkugeln eingraviert ist. Anscheinend handelt
es sich um ein Amulett. — Von besonderer Wich-
tigkeit sind natürlich die Münzfunde. In einem
Keller nahe dem Außentor haben wir vor einigen
Wochen sechs Brakteaten gefunden, wovon drei
gut erhalten sind. Sie stammen von den Fuldaer
Äbten Heinrich von Erthal und Bertho von Leip-
holtz. Unter den übrigen - - brandgeschädigten —
Abb. 19. Burgruine Wartenbach, Hessen. Foto:Bauer,Lauterbach. Brakteaten ist ein hessischer aus der Münzstätte
Mauerwerk am Stumpf des Bergfriedes. Alsfeld und aus der Zerstörungszeit der Burg
Abb. 18. Burgruine Wartenbach, Hessen. Ansicht von Osten. Foto: Bauer, Lauterbach.
pechgetränkter Bausch gebunden werden
konnte. Es handelt sich wahrscheinlich
um einen Brandpfeil. Andere Spitzen
sind doppelt oder dreifach so schwer wie
die normalen. In diesen Fällen wird
es sich um Geschosse handeln, die durch
Wurfmaschinen geschleudert wurden.
Sehr reichhaltig ist unser Messerinven-
tar. Es sind bis jetzt ungefähr sieben
Dutzend der verschiedensten Messerfor-
men zutage gekommen, von denen der
größte Teil ziemlich erhalten ist. Die
Messer waren je nach Verwendungs-
zweck verschieden gestaltet. Bei den
Rasiermessern ist das eine Ende hörn-
chensörmig gebogen. Die Schlachtmesser
haben gekehlte Klingen, bei den Obstbau-
messern ist die Spitze vorgebogen, bei
den Hufmessern ist das Ende etwas ver-
breitert. Ein Wildhaumesser ist sehr gut
erhalten, sogar mit den Nieten, durch die die Holzschalen des Griffes gehalten wurden. Es zeigt sich übrigens, daß bei
den Stücken, die bei dem Zerstörungsbrand geglüht worden sind, der Rost nur in dünner Lage angesetzt hat.
Übergehen wir das reiche Fundinventar an Küchengeräten, Fleischgabeln, Nußknackern, Werkzeugen, Loch-
sägen, Meißeln, Beilen, Hackmessern, Pflugsechen, großen Hohl- und Steckschlüsseln mit oft bizarren Schlüsselreitern
romanischen Charakters, Truhenschlüsseln, Schloßteilen, Gürtel- und Pferdegeschirrschnallen, und wenden wir uns
den Hufeisen und Sporen zu. Wir haben Hufeisen gefunden für Pferde und für Esel. Auch die Pferdehufeisen sind
auffallend klein und können unmöglich zu schweren Pferden gehört haben. Die Griffe sind zum kleinsten Teil durch
flache Umbiegung der Hufeisenenden hergestellt. Meistens sind diese Enden seitlich hoch angeschmiedet. An den
Stellen, wo in dem Hufeisen die Nagellöcher eingelassen sind, wölbt sich die Außenseite des Hufeisens wellenlinien-
förmig vor. In den Hufeisen stecken zumeist noch die Hufnägel. Das ist ein sicherer Beweis dafür, daß die Tiere, die
diese Eisen getragen haben, bei der Zerstörung zugrunde gegangen sind. Von den Sporen sind Rädchen- wie Dorn-
sporen erhalten. Sie kommen in zwei Gruppen vor: die flachen Sporen, wie sie der romanischen Zeit eigentümlich
sind, und die hochgekrümmten Sporen der ausgehenden Stauferzeit. Auch die Verbindungsstücke zur Befestigung
der Sporen sind in einzelnen Belegen aufgefunden worden.
Besonderes Interesse erwecken die Bronzen. An erster Stelle steht ein kleines Wappenschildchen, das gold-
patiniert und mit dem Wappen der von Wartenberg bemalt ist. Aus diesem Rüstungsanhänger lassen sich die Farben
des Geschlechts deutlich erkennen: Auf blauem Grund ein links hochsteigender silberner Schrägbalken. Im rechten
oberen Feld ist vermutlich ein goldener Stern aus-
gespart. An dieser Stelle ist das Wappen stark an-
gewittert und daher schlecht deutbar. Wir über-
gehen die übrigen Bronzefunde, die in der Haupt-
sache Schmuck von Pferdegeschirren waren. Aus
diesem Grunde sind die meisten Stückchen mit
Gold belegt. Wir wenden uns jetzt den Edel-
metallfunden zu.
Vor dem inneren Tor hatten wir im vorigen
Jahre ein kleines Silberblättchen gefunden, eben-
falls goldpatiniert, auf dem das Monogramm
Christi in Verbindung mit einem Doppelkreuz und
zwei Erdkugeln eingraviert ist. Anscheinend handelt
es sich um ein Amulett. — Von besonderer Wich-
tigkeit sind natürlich die Münzfunde. In einem
Keller nahe dem Außentor haben wir vor einigen
Wochen sechs Brakteaten gefunden, wovon drei
gut erhalten sind. Sie stammen von den Fuldaer
Äbten Heinrich von Erthal und Bertho von Leip-
holtz. Unter den übrigen - - brandgeschädigten —
Abb. 19. Burgruine Wartenbach, Hessen. Foto:Bauer,Lauterbach. Brakteaten ist ein hessischer aus der Münzstätte
Mauerwerk am Stumpf des Bergfriedes. Alsfeld und aus der Zerstörungszeit der Burg
Abb. 18. Burgruine Wartenbach, Hessen. Ansicht von Osten. Foto: Bauer, Lauterbach.