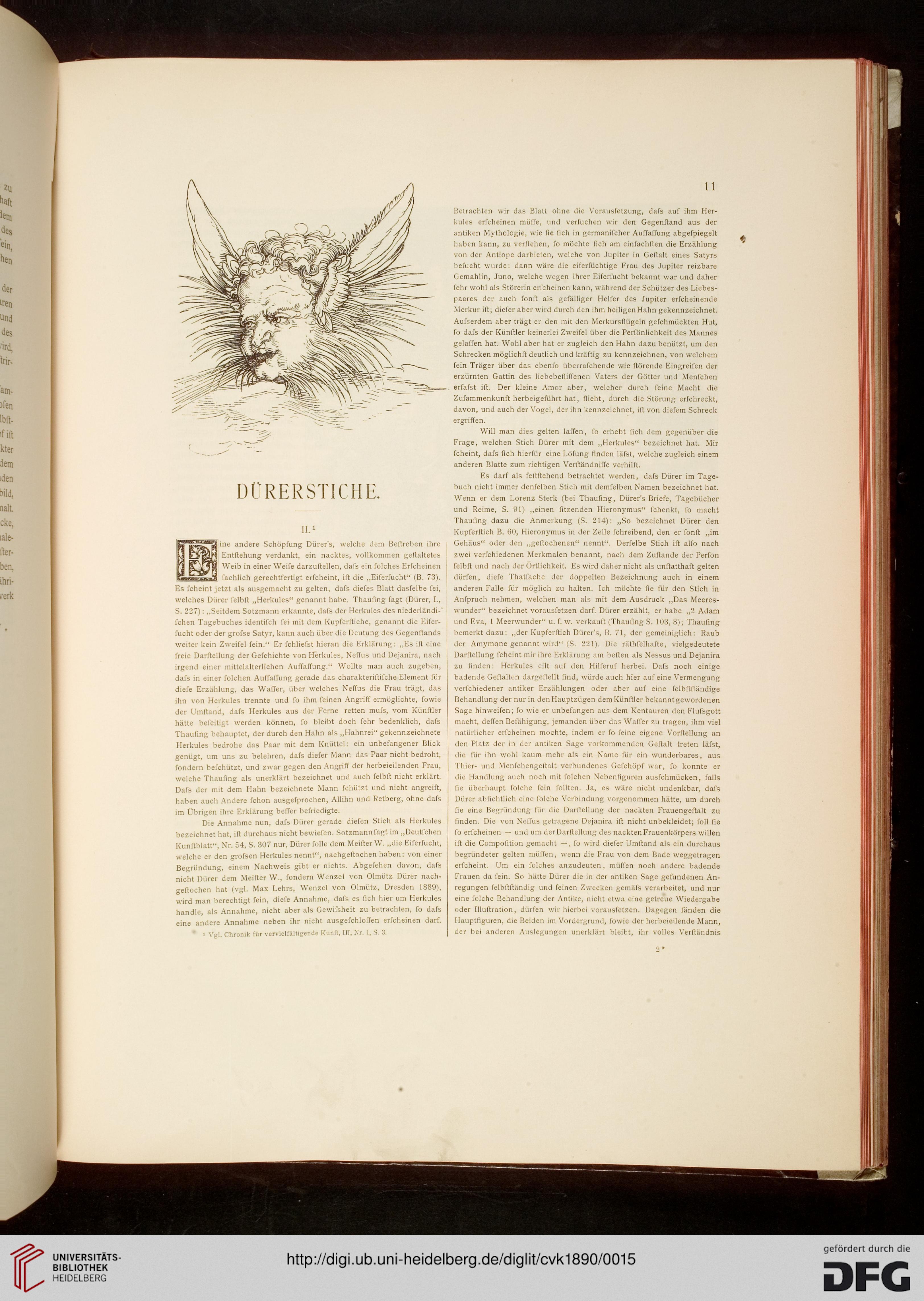DÜRERSTICHE.
n.1
ine andere Schöpsung Dürer's, welche dem Bestreben ihre
Entstehung verdankt, ein nacktes, vollkommen gestaltetes
Weib in einer Weise darzultellen, dass ein solches Erscheinen
ä sachlich gerechtsertigt erscheint, ist die „Eisersucht" (B. 73).
Es scheint jetzt als ausgemacht zu gelten, dass dieses Blatt dasselbe sei,
welches Durer selbst „Herkules" genannt habe. Thausing sagt (Dürer, I.,
S. 227): „Seitdem Sotzmann erkannte, dass der Herkules des niederländi-'
schen Tagebuches identisch sei mit dem Kupserstiche, genannt die Eifer-
sucht oder der grosse Satyr, kann auch über die Deutung des Gegenstands
weiter kein Zweisel sein." Er schliesst hieran die Erklärung: „Es ist eine
sreie Darsteilung der Geschichte von Herkules, Nessus und Dejanira, nach
irgend einer mittelalterlichen Aussadung." Wollte man auch zugeben,
dass in einer solchen Aussassung gerade das charakteristische Element für
diese Erzählung, das Wasser, über welches Nessus die Frau trägt, das
ihn von Herkules trennte und so ihm seinen Angriff ermöglichte, sowie
der Umstand, dass Herkules aus der Ferne retten muss, vom Künstler
hätte beseitigt werden können, so bleibt doch sehr bedenklich, dass
Thausing behauptet, der durch den Hahn als „Hahnrei" gekennzeichnete
Herkules bedrohe das Paar mit dem Knüttel: ein unbefangener Blick
genügt, um uns zu belehren, dass dieser Mann das Paar nicht bedroht,
sondern beschutzt, und zwar gegen den Angriff der herbeieilenden Frau,
welche Thausing als unerklärt bezeichnet und auch selbst nicht erklärt.
Dass der mit dem Hahn bezeichnete Mann schiitzt und nicht angreist,
haben auch Andere schon ausgesprochen, Allihn und Retberg, ohne dass
im Übrigen ihre Erklärung besrer besriedigte.
Die Annahme nun, dass Dürer gerade diesen Stich als Herkules
bezeichnet hat, ist durchaus nicht bewiesen. Sotzmannsagt im „Deutschen
Kunstblatt", Nr. 54, S. 307 nur, Dürer solle dem Meister W. „die Eifersucht,
welche er den grossen Herkules nennt", nachgestochen haben: von einer
Begründung, einem Nachweis gibt er nichts. Abgesehen davon, dass
nicht Dürer dem Meister W., sondern Wenzel von Olmiitz Durer nach-
gestochen hat (vgl. Max Lehrs, Wenzel von Olmiitz, Dresden 1889),
wird man berechtigt sein, diese Annahme, dass es sich hier um Herkules
handle, als Annahme, nicht aber als Gewissheit zu betrachten, so dass
eine andere Annahme neben ihr nicht ausgeschlossen erscheinen darf.
' ' Vgl. Chronik sür vervielsältigende Kunll, III, Xr 1, s ::
11
Betrachten wir das Blatt ohne die Voraussetzung, dass auf ihm Her-
kules erscheinen musse, und versuchen wir den Gegenstand aus der
antiken Mythologie, wie sie sich in germaniseber Aussassung abgespiegelt
haben kann, zu vergehen, so möchte sich am einfachsien die Erzählung
von der Antiope darbielen, welche von Jupiter in Gestalt eines Satyrs
besucht wurde: dann wäre die eisersüchtige Frau des Jupiter reizbare
Gemahlin, Juno, welche wegen ihrer Eisersucht bekannt war und daher
sehr wohl als Störerin erscheinen kann, während der Schützer des Liebes-
paares der auch sonst als gefälliger Helser des Jupiter erscheinende
Merkur ist; dieser aber wird durch den ihm heiligen Hahn gekennzeichnet.
Ausserdem aber trägt er den mit den Merkursslügeln geschmuckten Hut,
so dass der Künstler keinerlei Zweisel über die Personlichkeit des Mannes
gclassen hat. Wohl aber hat er zugleich den Hahn dazu benützt, um den
Schrecken mögliebst deutlich und kräftig zu kennzeichnen, von welchem
sein Träger über das ebenso uberraschende wie Hörende Eingreisen der
erzürnten Gattin des liebebeflissenen Vaters der Götter und Menschen
erfasst ist. Der kleine Amor aber, welcher durch seine Macht die
Zusamrnenkunft herbeigeführt hat, slieht, durch die Störung erschreckt,
davon, und auch der Vogel, der ihn kennzeichnet, ist von diesem Schreck
ergriffen.
Will man dies gelten lassen, so erhebt sich dem gegenüber die
Frage, welchen Stich Dürer mit dem „Herkules" bezeichnet hat. Mir
scheint, dass sich hierfür eine Lösung rinden lässt, welche zugleich einem
anderen Blatte zum richtigen Verständnisse verhilst.
Es dars als feststehend betrachtet werden, dass Dürer im Tage-
buch nicht immer denselben Stich mit demselben Namen bezeichnet hat.
Wenn er dem Lorenz Sterk (bei Thausing, Dürer's Briefe, Tagebücher
und Reime, S. 91) „einen sitzenden Hieronymus" schenkt, so macht
Thausing dazu die Anmerkung (S. 214): „So bezeichnet Dürer den
Kupserstich B. 60, Hieronymus in der Zelle schreibend, den er sonst „im
Gehaus" oder den „gestochenen" nennt". Derselbe Stich ist also nach
zwei verschiedenen Merkmalen benannt, nach dem Zustande der Persön
selbst und nach der Örtlichkeit. Es wird daher nicht als unstatthast gelten
dürfen, diese Thatsache der doppelten Bezeichnung auch in einem
anderen Falle sür möglich zu halten. Ich möchte sie sür den Stich in
Anspruch nehmen, welchen man als mit dem Ausdruck „Das Meeres-
wunder" bezeichnet voraussetzen darf. Dürer erzählt, er habe „2 Adam
und Eva, 1 Meerwunder" u. s. w. verkaust (Thausing S. 103, 8); Thausing
bemerkt dazu: „der Kupferstich Dürer's, B. 71, der gemeiniglich: Raub
der Amymone genannt wird" (S. 221). Die räthselhafte, vielgedeutete
DarstclUmg scheint mir ihre Erklärung am besten als Nessus und Dejanira
zu finden: Herkules eilt auf den Hilferuf herbei. Dass noch einige
badende Gestalten dargestellt sind, würde auch hier auf eine Vermengung
versebiedener antiker Erzählungen oder aber auf eine selbstständige
Behandlung der nur in denHauptzugen dem Künstler bekanntgewordenen
Sage hinweisen; so wie er unbefangen aus dem Kentauren den Flussgott
macht, dessen Besähigung, jemanden über das Wasser zu tragen, ihm viel
natürlicher erscheinen mochte, indem er so seine eigene Vorltellung an
den Platz der in der antiken Sage vorkommenden Gestalt treten lässt,
die sür ihn wohl kaum mehr als ein Name sür ein wunderbares, aus
Thier- und Mensehengestalt verbundenes Geschöpf war, so konnte er
die Handlung auch noch mit solchen Nebenfiguren aussehmücken, salls
sie überhaupt solche sein süllten. Ja, es wäre nicht undenkbar, dass
Dürer absichtlich eine solche Verbindung vorgenommen hätte, um durch
sie eine Begründung für die Darltellung der nackten Frauengestalt zu
linden. Die von Nessus getragene Dejanira ist nicht unbekleidet; soll sie
so erscheinen — und um derDarstcllung des nacktenFrauenkörpers willen
ist die Composition gemacht —, so wird dieser Umstand als ein durchaus
begründeter gelten mussen, wenn die Frau von dem Bade weggetragen
erscheint. Um ein solches anzudeuten, mussen noch andere badende
Frauen da sein. So hätte Dürer die in der antiken Sage gefundenen An-
regungen selbstständig und seinen Zwecken gemass verarbeitet, und nur
eine solche Behandlung der Antike, nicht etwa eine getreue Wiedergabe
oder Illustration, dürsen wir hierbei voraussetzen. Dagegen sänden die
Hauptfiguren, die Beiden im Vordergrund, sowie der herbeieilende Mann,
der bei anderen Auslegungen unerklärt bleibt, ihr volles Verständnis