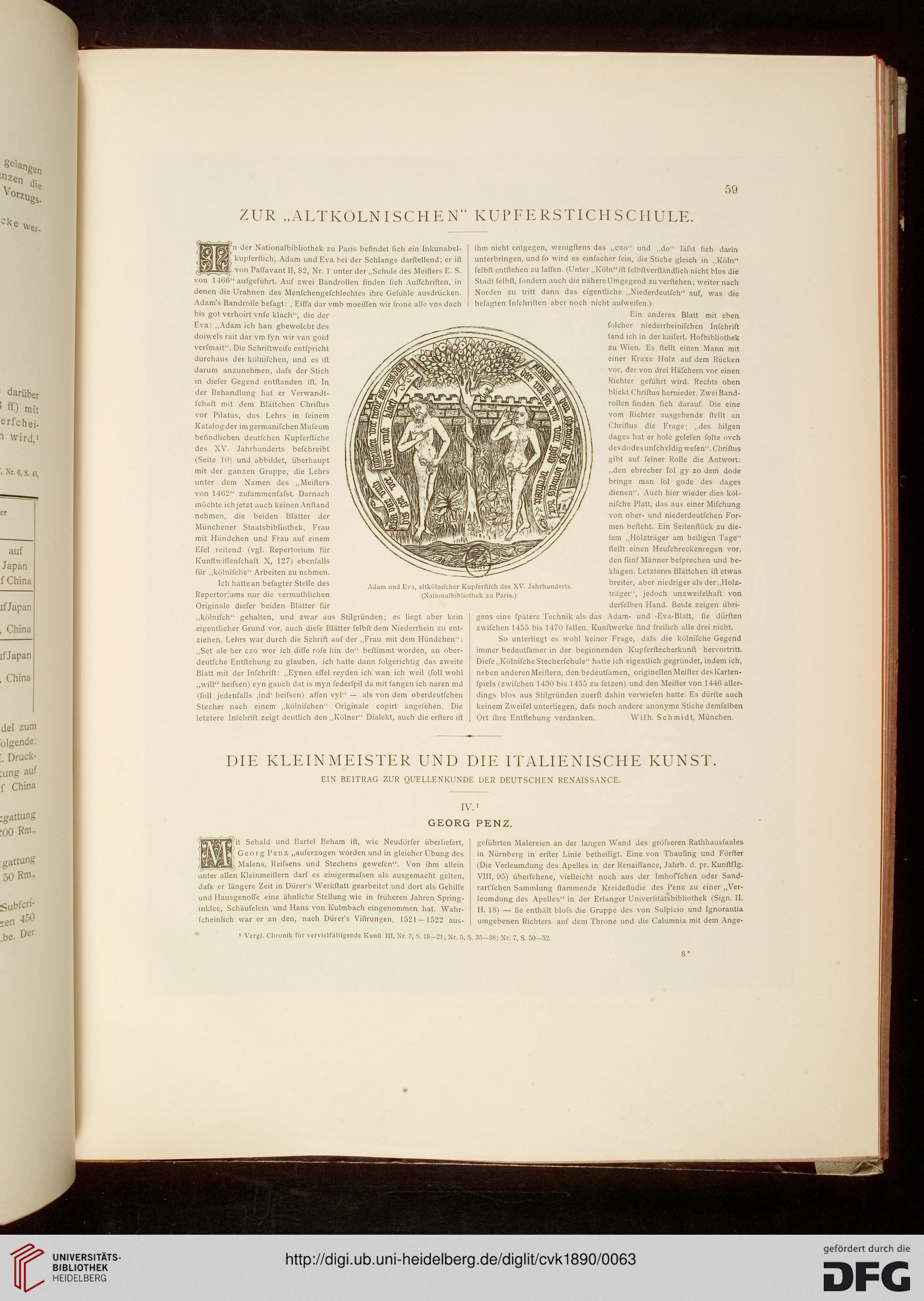■n
■HM
■I
■I
59
ZUR „ALTKOLNISCHEN" KUPFERSTICHSCHULE.
n der Nationalbibliothek zu Paris befindet (ich ein Inkunabel-
( kupferstich, Adam und Eva bei der Schlange darftellend; er ist
. von Passavant II, 82, Nr. 1 unter der „Schule des Meiaers E. S.
von 1466" ausgesührt. Aus zwei Bandrollen finden (ich Ausschnsten, in
denen die Urahnen des Menschengeschlechtes ihre Gesühle ausdrücken.
Adam's Bandrolle besagt: , Eifsa dar vmb moeissen wir srone alle vns dach
bis got verhoirt vnse klach", die der
Eva: „Adam ich han ghewolcht des
doiwels rait dar vm syn wir van goid
versmait". Die Schristweise entspricht
durchaus der kölnischen, und es ist
darum anzunehmen, dass der Stich
in dieser Gegend entstanden ist. In
der Behandlung hat er Verwandt-
schast mit dem Blättchen Christus
vor Pilatus, das Lehrs in seinem
Katalog der im germanischen Museum
befindlichen deutsehen Kupserstiche
des XV. Jahrhunderts beschreibt
(Seite 10) und abbildet, überhaupt
mit der ganzen Gruppe, die Lehrs
unter dem Namen des „Meisters
von 1462" zusammenfasst. Darnach
möchte ich jetzt auch keinen Anstand
nehmen, die beiden Blätter der
Münchener Staatsbibliothek, Frau
mit Hündchen und Frau aus einem
Esel reitend (vgl. Repertorium für
Kunstwissenschaft X, 127) ebensalls
für „kölnische" Arbeiten zu nehmen.
Ich hatte an besagter Stelle des
Repertoriums nur die vermuthlichen
Originale dieser beiden Blätter für
„kölnisch" gehalten, und zwar aus Stilgründen; es liegt aber kein
eigentlicher Grund vor, auch diese Blätter selbst dem Niederrhein zu ent-
ziehen. Lehrs war durch die Schrift auf der ,,Frau mit dem Hündchen":
„Set ale her czo wor ich disse rose hin do" bestimmt worden, an ober-
deutsehe Entstehung zu glauben, ich hatte dann solgerichtig das zweite
Blatt mit der Inschrist: „Eynen essel reyden ich wan ich weil (soll wohl
„will" heissen) eyn gauch dat is myn federspil da mit sangen ich naren md
(soll jedensalls ,ind' heissen) äsfen vyl" — als von dem oberdeutsehen
Stecher nach einem „kölnischen" Originale copirt angesehen. Die
letztere Inschrist zeigt deutlich den „Kölner11 Dialekt, auch die ersterc ist
Adam und Eva, altkülmscher Kupserstich des XV. Jahrhunderts.
(Nationalbibliothek zu Paris.)
ihm nicht entgegen, wenigstens das „czo" und „do" lässt sich darin
unterbringen, und so wird es einfacher sein, die Stiche gleich in „Köln"
selbst entstehen zu lassen. (Unter ,,Köln"ist selbstverständlich nicht blos die
Stadt selbst, sondern auch die nähere Umgegend zuverstehen; weiter nach
Norden zu tritt dann das eigentliche „Niederdeutsch" auf, was die
betagten Inschristen aber noch nicht ausweisen.)
Ein anderes Blatt mit eben
solcher niederrheinischen Inschrist
land ich in derkaiserl. Hosbibliothek
zu Wien. Es stellt einen Mann mit
einer Kraxe Holz aus dem Rucken
vor, der von drei Häschern vor einen
Richter gesührt wird. Rechts oben
blickt Christus hernieder. Zwei Band-
rollen finden sich darauf. Die eine
vom Richter ausgehende stellt an
Christus die Frage; „des hilgen
dages hat er hole gelesen solte oveh
des dodesunschvldigwesen". Christus
gibt aus seiner Rolle die Antwort:
„den ebrecher sol gy zo dem dode
bringe man sol gode des dages
dienen". Auch hier wieder dies köl-
nische Platt, das aus einer Mischung
von ober- und niederdeutsehen For-
men besteht. Ein Seitenstück zu die-
lem „Holzträger am heiligen Tage"
stellt einen Heuschreckenregen vor,
den süns Männer besprechen und be-
klagen. Letzteres Blättchen ist etwas
breiter, aber niedriger als der,,Holz-
träger11, jedoch unzweifelhast von
derselben Hand. Beide zeigen übri-
gens eine spätere Technik als das Adam- und -Eva-Blatt, sie dürsten
zwischen 1455 bis 1470 fallen. Kunstwerke sind sreilich alle drei nicht.
So unterliegt es wohl keiner Frage, dass die kölnische Gegend
immer bedeutsamer in der beginnenden Kupserstecherkunst hervortritt.
Diese, tKolnische Stecherschule" hatte ich eigentlich gegründet, indem ich,
neben anderenMeistern, den bedeutsamen, originellenMeister desKarten-
spiels (zwischen 1430 bis 1455 zu setzen) und den Meister von 1446 aller-
dings blos aus Stilgründen zuerst dahin verwiesen hatte. Es dürfte auch
keinem Zweisel unterliegen, dass noch andere anonyme Stiche demselben
Ort ihre Entstehung verdanken. Wilh, Schmidt, München.
DIE KLEINMEISTER UND DIE ITALIENISCHE KUNST.
EIN BEITRAG ZUR QUELLENKUNDE DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.
IV.1
GEORG PENZ.
[sit Sebald und Bartel Beham ist, wie Neudörser überliesert,
Georg Penz „auserzogen worden und in gleicher Übung des
äj. Malens, Reissens und Stechens gewesen". Von ihm allein
unter allen Kleinmeistern darf es einigermassen als ausgemacht gelten,
dass er längere Zeit in Dürer's Werkstatt gearbeitet und dort als Gehilse
und Hausgenosse eine ähnliche Stellung wie in srüheren Jahren Spring-
inklee, Schäuselein und Hans von Kulmbach eingenommen hat. Wahr-
scheinlich war er an den, nach Dürer's Visirungen., 1521—1522 aus-
gesührten Malereien an der langen Wand des grösseren Rathhaussaales
in Nürnberg in erster Linie betheiligt. Eine von Thausing und Förster
(Die Verleumdung des Apelles in der Renaissance, Jahrb. d. pr. Kunstslg.
VIII, 95) übersehene, vielleicht noch aus der Imhofschen oder Sand-
rart'schen Sammlung stammende Krcidestudie des Penz zu einer „Ver-
leumdung des Apelles" in der Erlanger Univcrsitütsbibliothek (Sign. II.
H. 18) — sie enthält bloss die Gruppe des von Suspicio und Ignorantia
umgebenen Richters auf dem Throne und die Calumnia mit dem Ange-
Vergl. Chronik sür vervielfältigende Kunst III, N'r. 3, S. IS—21; Nr. 5, S. 35—381 Nr. 7 S ."0—52
'ja*
am
■HM
■I
■I
59
ZUR „ALTKOLNISCHEN" KUPFERSTICHSCHULE.
n der Nationalbibliothek zu Paris befindet (ich ein Inkunabel-
( kupferstich, Adam und Eva bei der Schlange darftellend; er ist
. von Passavant II, 82, Nr. 1 unter der „Schule des Meiaers E. S.
von 1466" ausgesührt. Aus zwei Bandrollen finden (ich Ausschnsten, in
denen die Urahnen des Menschengeschlechtes ihre Gesühle ausdrücken.
Adam's Bandrolle besagt: , Eifsa dar vmb moeissen wir srone alle vns dach
bis got verhoirt vnse klach", die der
Eva: „Adam ich han ghewolcht des
doiwels rait dar vm syn wir van goid
versmait". Die Schristweise entspricht
durchaus der kölnischen, und es ist
darum anzunehmen, dass der Stich
in dieser Gegend entstanden ist. In
der Behandlung hat er Verwandt-
schast mit dem Blättchen Christus
vor Pilatus, das Lehrs in seinem
Katalog der im germanischen Museum
befindlichen deutsehen Kupserstiche
des XV. Jahrhunderts beschreibt
(Seite 10) und abbildet, überhaupt
mit der ganzen Gruppe, die Lehrs
unter dem Namen des „Meisters
von 1462" zusammenfasst. Darnach
möchte ich jetzt auch keinen Anstand
nehmen, die beiden Blätter der
Münchener Staatsbibliothek, Frau
mit Hündchen und Frau aus einem
Esel reitend (vgl. Repertorium für
Kunstwissenschaft X, 127) ebensalls
für „kölnische" Arbeiten zu nehmen.
Ich hatte an besagter Stelle des
Repertoriums nur die vermuthlichen
Originale dieser beiden Blätter für
„kölnisch" gehalten, und zwar aus Stilgründen; es liegt aber kein
eigentlicher Grund vor, auch diese Blätter selbst dem Niederrhein zu ent-
ziehen. Lehrs war durch die Schrift auf der ,,Frau mit dem Hündchen":
„Set ale her czo wor ich disse rose hin do" bestimmt worden, an ober-
deutsehe Entstehung zu glauben, ich hatte dann solgerichtig das zweite
Blatt mit der Inschrist: „Eynen essel reyden ich wan ich weil (soll wohl
„will" heissen) eyn gauch dat is myn federspil da mit sangen ich naren md
(soll jedensalls ,ind' heissen) äsfen vyl" — als von dem oberdeutsehen
Stecher nach einem „kölnischen" Originale copirt angesehen. Die
letztere Inschrist zeigt deutlich den „Kölner11 Dialekt, auch die ersterc ist
Adam und Eva, altkülmscher Kupserstich des XV. Jahrhunderts.
(Nationalbibliothek zu Paris.)
ihm nicht entgegen, wenigstens das „czo" und „do" lässt sich darin
unterbringen, und so wird es einfacher sein, die Stiche gleich in „Köln"
selbst entstehen zu lassen. (Unter ,,Köln"ist selbstverständlich nicht blos die
Stadt selbst, sondern auch die nähere Umgegend zuverstehen; weiter nach
Norden zu tritt dann das eigentliche „Niederdeutsch" auf, was die
betagten Inschristen aber noch nicht ausweisen.)
Ein anderes Blatt mit eben
solcher niederrheinischen Inschrist
land ich in derkaiserl. Hosbibliothek
zu Wien. Es stellt einen Mann mit
einer Kraxe Holz aus dem Rucken
vor, der von drei Häschern vor einen
Richter gesührt wird. Rechts oben
blickt Christus hernieder. Zwei Band-
rollen finden sich darauf. Die eine
vom Richter ausgehende stellt an
Christus die Frage; „des hilgen
dages hat er hole gelesen solte oveh
des dodesunschvldigwesen". Christus
gibt aus seiner Rolle die Antwort:
„den ebrecher sol gy zo dem dode
bringe man sol gode des dages
dienen". Auch hier wieder dies köl-
nische Platt, das aus einer Mischung
von ober- und niederdeutsehen For-
men besteht. Ein Seitenstück zu die-
lem „Holzträger am heiligen Tage"
stellt einen Heuschreckenregen vor,
den süns Männer besprechen und be-
klagen. Letzteres Blättchen ist etwas
breiter, aber niedriger als der,,Holz-
träger11, jedoch unzweifelhast von
derselben Hand. Beide zeigen übri-
gens eine spätere Technik als das Adam- und -Eva-Blatt, sie dürsten
zwischen 1455 bis 1470 fallen. Kunstwerke sind sreilich alle drei nicht.
So unterliegt es wohl keiner Frage, dass die kölnische Gegend
immer bedeutsamer in der beginnenden Kupserstecherkunst hervortritt.
Diese, tKolnische Stecherschule" hatte ich eigentlich gegründet, indem ich,
neben anderenMeistern, den bedeutsamen, originellenMeister desKarten-
spiels (zwischen 1430 bis 1455 zu setzen) und den Meister von 1446 aller-
dings blos aus Stilgründen zuerst dahin verwiesen hatte. Es dürfte auch
keinem Zweisel unterliegen, dass noch andere anonyme Stiche demselben
Ort ihre Entstehung verdanken. Wilh, Schmidt, München.
DIE KLEINMEISTER UND DIE ITALIENISCHE KUNST.
EIN BEITRAG ZUR QUELLENKUNDE DER DEUTSCHEN RENAISSANCE.
IV.1
GEORG PENZ.
[sit Sebald und Bartel Beham ist, wie Neudörser überliesert,
Georg Penz „auserzogen worden und in gleicher Übung des
äj. Malens, Reissens und Stechens gewesen". Von ihm allein
unter allen Kleinmeistern darf es einigermassen als ausgemacht gelten,
dass er längere Zeit in Dürer's Werkstatt gearbeitet und dort als Gehilse
und Hausgenosse eine ähnliche Stellung wie in srüheren Jahren Spring-
inklee, Schäuselein und Hans von Kulmbach eingenommen hat. Wahr-
scheinlich war er an den, nach Dürer's Visirungen., 1521—1522 aus-
gesührten Malereien an der langen Wand des grösseren Rathhaussaales
in Nürnberg in erster Linie betheiligt. Eine von Thausing und Förster
(Die Verleumdung des Apelles in der Renaissance, Jahrb. d. pr. Kunstslg.
VIII, 95) übersehene, vielleicht noch aus der Imhofschen oder Sand-
rart'schen Sammlung stammende Krcidestudie des Penz zu einer „Ver-
leumdung des Apelles" in der Erlanger Univcrsitütsbibliothek (Sign. II.
H. 18) — sie enthält bloss die Gruppe des von Suspicio und Ignorantia
umgebenen Richters auf dem Throne und die Calumnia mit dem Ange-
Vergl. Chronik sür vervielfältigende Kunst III, N'r. 3, S. IS—21; Nr. 5, S. 35—381 Nr. 7 S ."0—52
'ja*
am