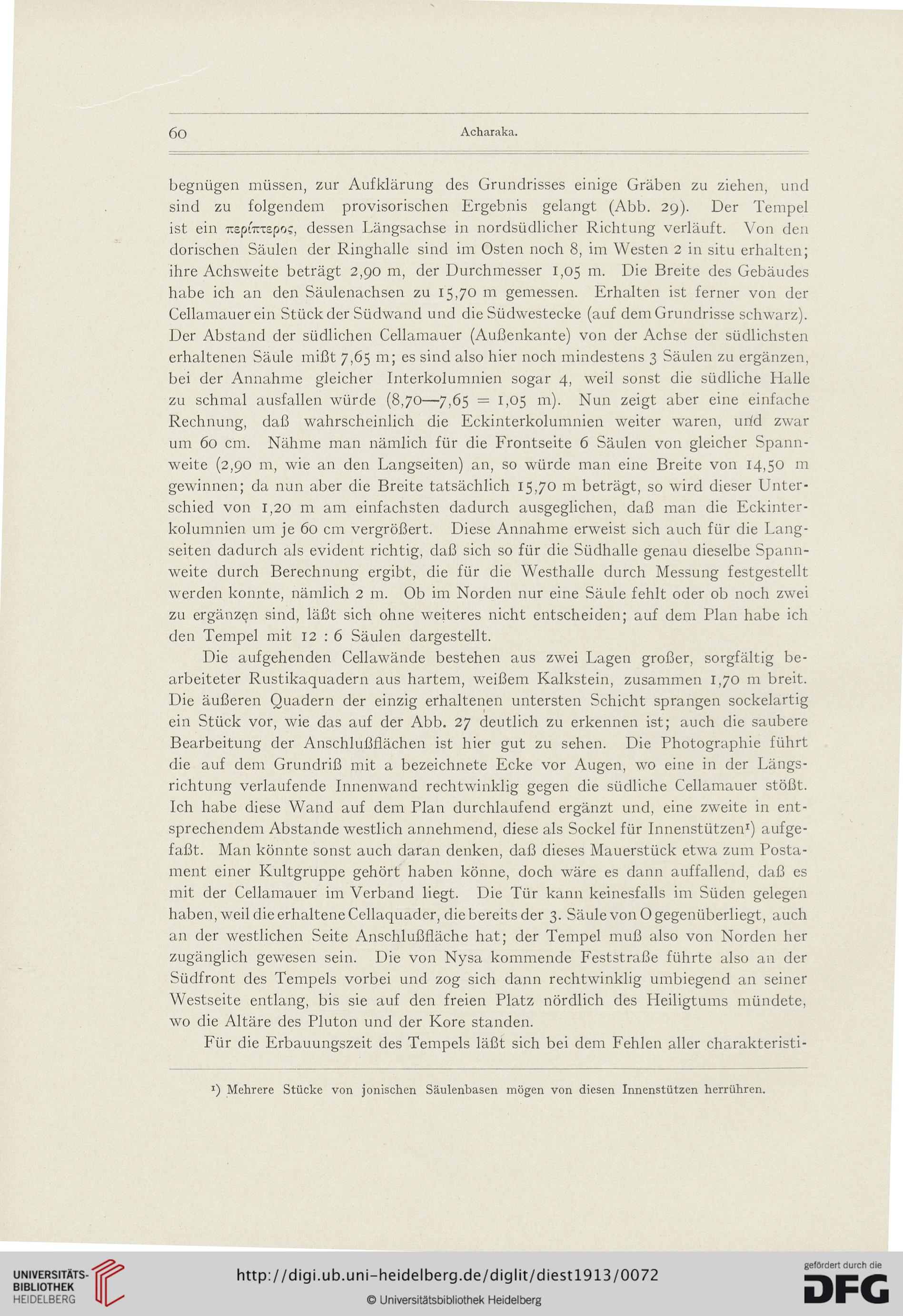Acharaka.
6o
begnügen müssen, zur Aufklärung des Grundrisses einige Gräben zu ziehen, und
sind zu folgendem provisorischen Ergebnis gelangt (Abb. 29). Der Tempel
ist ein irepwrcepos, dessen Längsachse in nordsüdlicher Richtung verläuft. Von den
dorischen Säulen der Ringhalle sind im Osten noch 8, im Westen 2 in situ erhalten;
ihre Achsweite beträgt 2,90 m, der Durchmesser 1,05 m. Die Breite des Gebäudes
habe ich an den Säulenachsen zu 15,70 m gemessen. Erhalten ist ferner von der
Cellamauer ein Stück der Südwand und die Südwestecke (auf dem Grundrisse schwarz).
Der Abstand der südlichen Cellamauer (Außenkante) von der Achse der südlichsten
erhaltenen Säule mißt 7,65 m; es sind also hier noch mindestens 3 Säulen zu ergänzen,
bei der Annahme gleicher Interkolumnien sogar 4, weil sonst die südliche Halle
zu schmal ausfallen würde (8,70—7,65 = 1,05 m). Nun zeigt aber eine einfache
Rechnung, daß wahrscheinlich die Eckinterkolumnien weiter waren, un!d zwar
um 60 cm. Nähme man nämlich für die Frontseite 6 Säulen von gleicher Spann-
weite (2,90 m, wie an den Langseiten) an, so würde man eine Breite von 14,50 m
gewinnen; da nun aber die Breite tatsächlich 15,70 m beträgt, so wird dieser Unter-
schied von 1,20 m am einfachsten dadurch ausgeglichen, daß man die Eckinter-
kolumnien um je 60 cm vergrößert. Diese Annahme erweist sich auch für die Lang-
seiten dadurch als evident richtig, daß sich so für die Südhalle genau dieselbe Spann-
weite durch Berechnung ergibt, die für die Westhalle durch Messung festgestellt
werden konnte, nämlich 2 m. Ob im Norden nur eine Säule fehlt oder ob noch zwei
zu ergänzen sind, läßt sich ohne weheres nicht entscheiden; auf dem Plan habe ich
den Tempel mit 12:6 Säulen dargestellt.
Die aufgehenden Cellawände bestehen aus zwei Lagen großer, sorgfältig be-
arbeiteter Rustikaquadern aus hartem, weißem Kalkstein, zusammen 1,70 m breit.
Die äußeren Quadern der einzig erhaltenen untersten Schicht sprangen sockelartig
ein Stück vor, wie das auf der Abb. 27 deutlich zu erkennen ist; auch die saubere
Bearbeitung der Anschlußflächen ist hier gut zu sehen. Die Photographie führt
die auf dem Grundriß mit a bezeichnete Ecke vor Augen, wo eine in der Längs-
richtung verlaufende Innenwand rechtwinklig gegen die südliche Cellamauer stößt.
Ich habe diese Wand auf dem Plan durchlaufend ergänzt und, eine zweite in ent-
sprechendem Abstande westlich annehmend, diese als Sockel für Innenstützen1) aufge-
faßt. Man könnte sonst auch daran denken, daß dieses Mauerstück etwa zum Posta-
ment einer Kultgruppe gehört haben könne, doch wäre es dann auffallend, daß es
mit der Cellamauer im Verband liegt. Die Tür kann keinesfalls im Süden gelegen
haben, weil die erhaltene Cellaquader, die bereits der 3. Säule von 0 gegenüberliegt, auch
an der westlichen Seite Anschlußfläche hat; der Tempel muß also von Norden her
zugänglich gewesen sein. Die von Nysa kommende Feststraße führte also an der
Südfront des Tempels vorbei und zog sich dann rechtwinklig umbiegend an seiner
Westseite entlang, bis sie auf den freien Platz nördlich des Heiligtums mündete,
wo die Altäre des Pluton und der Kore standen.
Für die Erbauungszeit des Tempels läßt sich bei dem Fehlen aller charakteristi-
[) Mehrere Stücke von jonischen Säulenhasen mögen von diesen Innenstützen herrühren.
6o
begnügen müssen, zur Aufklärung des Grundrisses einige Gräben zu ziehen, und
sind zu folgendem provisorischen Ergebnis gelangt (Abb. 29). Der Tempel
ist ein irepwrcepos, dessen Längsachse in nordsüdlicher Richtung verläuft. Von den
dorischen Säulen der Ringhalle sind im Osten noch 8, im Westen 2 in situ erhalten;
ihre Achsweite beträgt 2,90 m, der Durchmesser 1,05 m. Die Breite des Gebäudes
habe ich an den Säulenachsen zu 15,70 m gemessen. Erhalten ist ferner von der
Cellamauer ein Stück der Südwand und die Südwestecke (auf dem Grundrisse schwarz).
Der Abstand der südlichen Cellamauer (Außenkante) von der Achse der südlichsten
erhaltenen Säule mißt 7,65 m; es sind also hier noch mindestens 3 Säulen zu ergänzen,
bei der Annahme gleicher Interkolumnien sogar 4, weil sonst die südliche Halle
zu schmal ausfallen würde (8,70—7,65 = 1,05 m). Nun zeigt aber eine einfache
Rechnung, daß wahrscheinlich die Eckinterkolumnien weiter waren, un!d zwar
um 60 cm. Nähme man nämlich für die Frontseite 6 Säulen von gleicher Spann-
weite (2,90 m, wie an den Langseiten) an, so würde man eine Breite von 14,50 m
gewinnen; da nun aber die Breite tatsächlich 15,70 m beträgt, so wird dieser Unter-
schied von 1,20 m am einfachsten dadurch ausgeglichen, daß man die Eckinter-
kolumnien um je 60 cm vergrößert. Diese Annahme erweist sich auch für die Lang-
seiten dadurch als evident richtig, daß sich so für die Südhalle genau dieselbe Spann-
weite durch Berechnung ergibt, die für die Westhalle durch Messung festgestellt
werden konnte, nämlich 2 m. Ob im Norden nur eine Säule fehlt oder ob noch zwei
zu ergänzen sind, läßt sich ohne weheres nicht entscheiden; auf dem Plan habe ich
den Tempel mit 12:6 Säulen dargestellt.
Die aufgehenden Cellawände bestehen aus zwei Lagen großer, sorgfältig be-
arbeiteter Rustikaquadern aus hartem, weißem Kalkstein, zusammen 1,70 m breit.
Die äußeren Quadern der einzig erhaltenen untersten Schicht sprangen sockelartig
ein Stück vor, wie das auf der Abb. 27 deutlich zu erkennen ist; auch die saubere
Bearbeitung der Anschlußflächen ist hier gut zu sehen. Die Photographie führt
die auf dem Grundriß mit a bezeichnete Ecke vor Augen, wo eine in der Längs-
richtung verlaufende Innenwand rechtwinklig gegen die südliche Cellamauer stößt.
Ich habe diese Wand auf dem Plan durchlaufend ergänzt und, eine zweite in ent-
sprechendem Abstande westlich annehmend, diese als Sockel für Innenstützen1) aufge-
faßt. Man könnte sonst auch daran denken, daß dieses Mauerstück etwa zum Posta-
ment einer Kultgruppe gehört haben könne, doch wäre es dann auffallend, daß es
mit der Cellamauer im Verband liegt. Die Tür kann keinesfalls im Süden gelegen
haben, weil die erhaltene Cellaquader, die bereits der 3. Säule von 0 gegenüberliegt, auch
an der westlichen Seite Anschlußfläche hat; der Tempel muß also von Norden her
zugänglich gewesen sein. Die von Nysa kommende Feststraße führte also an der
Südfront des Tempels vorbei und zog sich dann rechtwinklig umbiegend an seiner
Westseite entlang, bis sie auf den freien Platz nördlich des Heiligtums mündete,
wo die Altäre des Pluton und der Kore standen.
Für die Erbauungszeit des Tempels läßt sich bei dem Fehlen aller charakteristi-
[) Mehrere Stücke von jonischen Säulenhasen mögen von diesen Innenstützen herrühren.