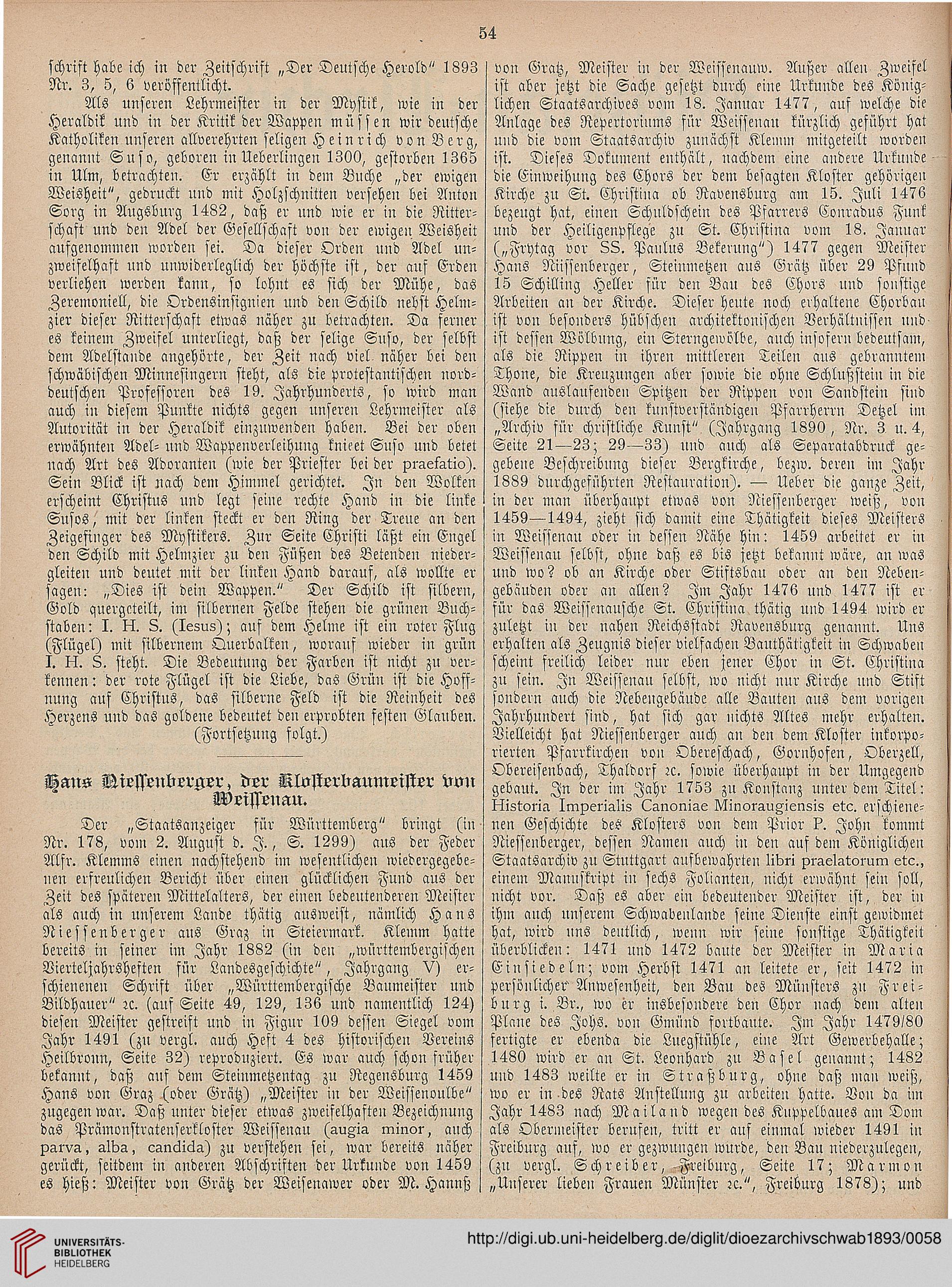54
schrift habe ich in der Zeitschrift „Der Deutsche Herold" 1893
Nr. 3, 5, 6 veröffentlicht.
Als unseren Lehrmeister in der Mystik, wie in der
Heraldik und in der Kritik der Wappen müssen wir deutsche
Katholiken unseren allverehrten seligen Heinrich vonBerg,
genannt Suso, geboren in Ueberlingen 1300, gestorben 1365
in Ulm, betrachten. Er erzählt in dem Buche „der ewigen
Weisheit", gedruckt uud mit Holzschnitten versehen bei Anton
Sorg in Augsburg 1482, daß er und wie er in die Ritter-
schaft und den Adel der Gesellschaft von der ewigen Weisheit
ausgenommen worden sei. Da dieser Orden und Adel un-
zweifelhaft und unwiderleglich der höchste ist, der auf Erden
verliehen werden kann, so lohnt es sich der Mühe, das
Zeremoniell, die Ordensinsignien und den Schild nebst Helm-
zier dieser Ritterschaft etwas näher zu betrachten. Da ferner-
es keinem Zweifel unterliegt, daß der selige Suso, der selbst
dem Adelstande angehörte, der Zeit nach viel, näher bei den
schwäbischen Minnesingern steht, als die protestantischen nord-
deutschen Professoren des 19. Jahrhunderts, so wird man
auch in diesem Punkte nichts gegen unseren Lehrmeister als
Autorität in der Heraldik einzuwenden haben. Bei der oben
erwähnten Adel- und Wappenverleihung knieet Suso und betet
nach Art des Adoranten (wie der Priester bei der pruetutio).
Sein Blick ist nach dem Himmel gerichtet. In den Wolken
erscheint Christus und legt seine rechte Hand in die linke
Susos, mit der linken steckt er den Ring der Treue an den
Zeigefinger des Mystikers. Zur Seite Christi läßt ein Engel
den Schild mit Helmzier zu den Füßen des Betenden nieder-
gleiten und deutet mit der linken Hand daraus, als wollte er
sagen: „Dies ist dein Wappen." Der Schild ist silbern,
Gold quergcteilt, im silbernen Felde stehen die grünen Buch-
staben: I. 14. 3. (lesns); auf dem Helme ist ein roter Flug
(Flügel) mit silbernem Querbalken, worauf wieder in grün
I. H. 3. steht. Die Bedeutung der Farben ist nicht zu ver-
kennen : der rote Flügel ist die Liebe, das Grün ist die Hoff-
nung auf Christus, das silberne Feld ist die Reinheit des
Herzens und das goldene bedeutet den erprobten festen Glauben.
(Fortsetzung folgt.)
Hans Nirffenberger, der Wlosterbamneister von
Weissenau.
Der „Staatsanzeiger für Württemberg" bringt (in
Nr. 178, vom 2. August d. I., S. 1299) aus der Feder
Alfr. Klemms einen nachstehend im wesentlichen wiedergegebe-
uen erfreulichen Bericht über einen glücklichen Fund aus der
Zeit des späteren Mittelalters, der einen bedeutenderen Meister
als auch in unserem Laude thätig ausweist, nämlich Hans
Ni essender ger aus Graz in Steiermark. Klemm hatte
bereits in seiner im Jahr 1882 (in den „württembergischen
Vierteljahrsheften für Landesgeschichte", Jahrgang V) er-
schienenen Schrift über „Württembergische Baumeister und
Bildhauer" rc. (auf Seite 49, 129, 136 und namentlich 124)
diesen Meister gestreift und in Figur 109 dessen Siegel vom
Jahr 1491 (zu vergl. auch Heft 4 des historischen Vereins
Heilbronn, Seite 32) reproduziert. Es war auch schon früher
bekannt, daß auf dem Steinmetzentag zu Regensburg 1459
Hans von Graz (oder Grätz) „Meister in der Weissenoulbe"
zugegen war. Daß unter dieser etwas zweifelhaften Bezeichnung
das Prämonstratenserkloster Weissenan (auAin minor, auch
parva, aiba, canciicia) zu verstehen sei, war bereits näher
gerückt, seitdem in anderen Abschriften der Urkunde von 1459
es hieß: Meister von Grätz der Weisenawer oder M. Hannß
von Gratz, Meister in der Weissenauw. Außer allen Zweifel
ist aber jetzt die Sache gesetzt durch eine Urkunde des König-
lichen Staatsarchives vom 18. Januar 1477, auf welche die
Anlage des Repertoriums für Weissenan kürzlich geführt hat
und die vom Staatsarchiv zunächst Klemm mitgeteilt worden
ist. Dieses Dokument enthalt, nachdem eine andere Urkunde
die Einweihung des Chors der dem besagten Kloster gehörigen
Kirche zu St. Christiua ob Ravensburg am 15. Juli 1476
bezeugt hat, einen Schuldschein des Pfarrers Couradus Funk
uud der Heiligenpflege zu St. Christina vom 18. Januar
(„Frytag vor 33. Paulus Bekernng") 1477 gegen Meister
Hans Niissenberger, Steinmetzen aus Grätz über 29 Pfund
15 Schilling Heller für den Bau des Chors und sonstige
Arbeiten an der Kirche. Dieser heute noch erhaltene Chorbau
ist von besonders hübschen architektonischen Verhältnissen und
ist dessen Wölbung, ein Sterngewölbe, auch insofern bedeutsam,
als die Rippen in ihren mittleren Teilen aus gebranntem
Thone, die Kreuzungen aber sowie die ohne Schlußstein in die
Wand auslaufendeu Spitzen der Rippen von Sandstein sind
(siehe die durch den kunstverständigen Pfarrherrn Detzel im
„Archiv für christliche Kunst" (Jahrgang 1890, Nr. 3 u. 4,
Seite 21—23; 29—33) und auch als Separatabdruck ge-
gebene Beschreibung dieser Bergkirche, bezw. deren im Jahr
1889 durchgeführten Restauration). — lieber die ganze Zeit,
in der man überhaupt etwas von Niesfeuberger weiß, von
1469—1494, zieht sich damit eine Thätigkeit dieses Meisters
in Weissenan oder in dessen Nähe hin: 1459 arbeitet er in
Weissenan selbst, ohne daß es bis jetzt bekannt wäre, an was
und wo? ob an Kirche oder Stiftsbau oder an den Neben-
gebäuden oder an allen? Im Jahr 1476 und 1477 ist er
für das Weisfenausche St. Christiua thätig und 1494 wird er
zuletzt in der nahen Reichsstadt Ravensburg genannt. Uns
erhalten als Zeugnis dieser vielfachen Bauthätigkeit in Schwaben
scheint freilich leider nur eben jener Chor in St. Christina
zu sein. In Weissenan selbst, wo nicht nur Kirche und Stift
sondern auch die Nebengebäude alle Bauten aus dem vorigen
Jahrhundert sind, hat sich gar nichts Altes mehr erhalten.
Vielleicht hat Niessenberger auch an den dem Kloster inkorpo-
rierten Pfarrkirchen von Obereschach, Gornhofen, Oberzell,
Obereisenbach, Thaldorf rc. sowie überhaupt in der Umgegend
gebaut. In der im Jahr 1753 zu Konstanz unter dem Titel:
Ülistoria Irnperialis Lanoniae MnorauAiensis etc. erschiene-
nen Geschichte des Klosters von dem Prior ?. John kommt
Niessenberger, dessen Namen auch in den auf dem Königlichen
Staatsarchiv zu Stuttgart aufbewahrten libri praclatorum etc.,
einem Manuskript in sechs Folianten, nicht erwähnt sein soll,
nicht vor. Daß es aber ein bedeutender Meister ist, der in
ihm auch unserem Schwabenlande seine Dienste einst gewidmet
hat, wird uns deutlich, wenn wir seine sonstige Thätigkeit
überblicken: 1471 und 1472 baute der Meister in Maria
Einsiedeln; vom Herbst 1471 an leitete er, seit 1472 in
persönlicher-Anwesenheit, den Vau des Münsters zu Frei-
burg i. Br., wo er insbesondere den Chor nach dem alten
Plane des Johs. von Gmünd fortbaute. Im Jahr 1479/80
fertigte er ebenda die Luegstühle, eine Art Gewerbehalle;
1480 wird er an St. Leonhard zu Basel genannt; 1482
und 1483 weilte er in Straß bürg, ohne daß mau weiß,
wo er in des Rats Anstellung zu arbeiten hatte. Von da im
Jahr 1483 nach Mailand wegen des Kuppelbaues am Dom
als Obermeister berufen, tritt er auf einmal wieder 1491 in
Freiburg auf, wo er gezwungen wurde, den Bau niederzulegen,
(zu vergl. Schreiber, Freiburg, Seite 17; Marmon
„Unserer lieben Frauen Münster rc.", Freiburg 1878); und
schrift habe ich in der Zeitschrift „Der Deutsche Herold" 1893
Nr. 3, 5, 6 veröffentlicht.
Als unseren Lehrmeister in der Mystik, wie in der
Heraldik und in der Kritik der Wappen müssen wir deutsche
Katholiken unseren allverehrten seligen Heinrich vonBerg,
genannt Suso, geboren in Ueberlingen 1300, gestorben 1365
in Ulm, betrachten. Er erzählt in dem Buche „der ewigen
Weisheit", gedruckt uud mit Holzschnitten versehen bei Anton
Sorg in Augsburg 1482, daß er und wie er in die Ritter-
schaft und den Adel der Gesellschaft von der ewigen Weisheit
ausgenommen worden sei. Da dieser Orden und Adel un-
zweifelhaft und unwiderleglich der höchste ist, der auf Erden
verliehen werden kann, so lohnt es sich der Mühe, das
Zeremoniell, die Ordensinsignien und den Schild nebst Helm-
zier dieser Ritterschaft etwas näher zu betrachten. Da ferner-
es keinem Zweifel unterliegt, daß der selige Suso, der selbst
dem Adelstande angehörte, der Zeit nach viel, näher bei den
schwäbischen Minnesingern steht, als die protestantischen nord-
deutschen Professoren des 19. Jahrhunderts, so wird man
auch in diesem Punkte nichts gegen unseren Lehrmeister als
Autorität in der Heraldik einzuwenden haben. Bei der oben
erwähnten Adel- und Wappenverleihung knieet Suso und betet
nach Art des Adoranten (wie der Priester bei der pruetutio).
Sein Blick ist nach dem Himmel gerichtet. In den Wolken
erscheint Christus und legt seine rechte Hand in die linke
Susos, mit der linken steckt er den Ring der Treue an den
Zeigefinger des Mystikers. Zur Seite Christi läßt ein Engel
den Schild mit Helmzier zu den Füßen des Betenden nieder-
gleiten und deutet mit der linken Hand daraus, als wollte er
sagen: „Dies ist dein Wappen." Der Schild ist silbern,
Gold quergcteilt, im silbernen Felde stehen die grünen Buch-
staben: I. 14. 3. (lesns); auf dem Helme ist ein roter Flug
(Flügel) mit silbernem Querbalken, worauf wieder in grün
I. H. 3. steht. Die Bedeutung der Farben ist nicht zu ver-
kennen : der rote Flügel ist die Liebe, das Grün ist die Hoff-
nung auf Christus, das silberne Feld ist die Reinheit des
Herzens und das goldene bedeutet den erprobten festen Glauben.
(Fortsetzung folgt.)
Hans Nirffenberger, der Wlosterbamneister von
Weissenau.
Der „Staatsanzeiger für Württemberg" bringt (in
Nr. 178, vom 2. August d. I., S. 1299) aus der Feder
Alfr. Klemms einen nachstehend im wesentlichen wiedergegebe-
uen erfreulichen Bericht über einen glücklichen Fund aus der
Zeit des späteren Mittelalters, der einen bedeutenderen Meister
als auch in unserem Laude thätig ausweist, nämlich Hans
Ni essender ger aus Graz in Steiermark. Klemm hatte
bereits in seiner im Jahr 1882 (in den „württembergischen
Vierteljahrsheften für Landesgeschichte", Jahrgang V) er-
schienenen Schrift über „Württembergische Baumeister und
Bildhauer" rc. (auf Seite 49, 129, 136 und namentlich 124)
diesen Meister gestreift und in Figur 109 dessen Siegel vom
Jahr 1491 (zu vergl. auch Heft 4 des historischen Vereins
Heilbronn, Seite 32) reproduziert. Es war auch schon früher
bekannt, daß auf dem Steinmetzentag zu Regensburg 1459
Hans von Graz (oder Grätz) „Meister in der Weissenoulbe"
zugegen war. Daß unter dieser etwas zweifelhaften Bezeichnung
das Prämonstratenserkloster Weissenan (auAin minor, auch
parva, aiba, canciicia) zu verstehen sei, war bereits näher
gerückt, seitdem in anderen Abschriften der Urkunde von 1459
es hieß: Meister von Grätz der Weisenawer oder M. Hannß
von Gratz, Meister in der Weissenauw. Außer allen Zweifel
ist aber jetzt die Sache gesetzt durch eine Urkunde des König-
lichen Staatsarchives vom 18. Januar 1477, auf welche die
Anlage des Repertoriums für Weissenan kürzlich geführt hat
und die vom Staatsarchiv zunächst Klemm mitgeteilt worden
ist. Dieses Dokument enthalt, nachdem eine andere Urkunde
die Einweihung des Chors der dem besagten Kloster gehörigen
Kirche zu St. Christiua ob Ravensburg am 15. Juli 1476
bezeugt hat, einen Schuldschein des Pfarrers Couradus Funk
uud der Heiligenpflege zu St. Christina vom 18. Januar
(„Frytag vor 33. Paulus Bekernng") 1477 gegen Meister
Hans Niissenberger, Steinmetzen aus Grätz über 29 Pfund
15 Schilling Heller für den Bau des Chors und sonstige
Arbeiten an der Kirche. Dieser heute noch erhaltene Chorbau
ist von besonders hübschen architektonischen Verhältnissen und
ist dessen Wölbung, ein Sterngewölbe, auch insofern bedeutsam,
als die Rippen in ihren mittleren Teilen aus gebranntem
Thone, die Kreuzungen aber sowie die ohne Schlußstein in die
Wand auslaufendeu Spitzen der Rippen von Sandstein sind
(siehe die durch den kunstverständigen Pfarrherrn Detzel im
„Archiv für christliche Kunst" (Jahrgang 1890, Nr. 3 u. 4,
Seite 21—23; 29—33) und auch als Separatabdruck ge-
gebene Beschreibung dieser Bergkirche, bezw. deren im Jahr
1889 durchgeführten Restauration). — lieber die ganze Zeit,
in der man überhaupt etwas von Niesfeuberger weiß, von
1469—1494, zieht sich damit eine Thätigkeit dieses Meisters
in Weissenan oder in dessen Nähe hin: 1459 arbeitet er in
Weissenan selbst, ohne daß es bis jetzt bekannt wäre, an was
und wo? ob an Kirche oder Stiftsbau oder an den Neben-
gebäuden oder an allen? Im Jahr 1476 und 1477 ist er
für das Weisfenausche St. Christiua thätig und 1494 wird er
zuletzt in der nahen Reichsstadt Ravensburg genannt. Uns
erhalten als Zeugnis dieser vielfachen Bauthätigkeit in Schwaben
scheint freilich leider nur eben jener Chor in St. Christina
zu sein. In Weissenan selbst, wo nicht nur Kirche und Stift
sondern auch die Nebengebäude alle Bauten aus dem vorigen
Jahrhundert sind, hat sich gar nichts Altes mehr erhalten.
Vielleicht hat Niessenberger auch an den dem Kloster inkorpo-
rierten Pfarrkirchen von Obereschach, Gornhofen, Oberzell,
Obereisenbach, Thaldorf rc. sowie überhaupt in der Umgegend
gebaut. In der im Jahr 1753 zu Konstanz unter dem Titel:
Ülistoria Irnperialis Lanoniae MnorauAiensis etc. erschiene-
nen Geschichte des Klosters von dem Prior ?. John kommt
Niessenberger, dessen Namen auch in den auf dem Königlichen
Staatsarchiv zu Stuttgart aufbewahrten libri praclatorum etc.,
einem Manuskript in sechs Folianten, nicht erwähnt sein soll,
nicht vor. Daß es aber ein bedeutender Meister ist, der in
ihm auch unserem Schwabenlande seine Dienste einst gewidmet
hat, wird uns deutlich, wenn wir seine sonstige Thätigkeit
überblicken: 1471 und 1472 baute der Meister in Maria
Einsiedeln; vom Herbst 1471 an leitete er, seit 1472 in
persönlicher-Anwesenheit, den Vau des Münsters zu Frei-
burg i. Br., wo er insbesondere den Chor nach dem alten
Plane des Johs. von Gmünd fortbaute. Im Jahr 1479/80
fertigte er ebenda die Luegstühle, eine Art Gewerbehalle;
1480 wird er an St. Leonhard zu Basel genannt; 1482
und 1483 weilte er in Straß bürg, ohne daß mau weiß,
wo er in des Rats Anstellung zu arbeiten hatte. Von da im
Jahr 1483 nach Mailand wegen des Kuppelbaues am Dom
als Obermeister berufen, tritt er auf einmal wieder 1491 in
Freiburg auf, wo er gezwungen wurde, den Bau niederzulegen,
(zu vergl. Schreiber, Freiburg, Seite 17; Marmon
„Unserer lieben Frauen Münster rc.", Freiburg 1878); und