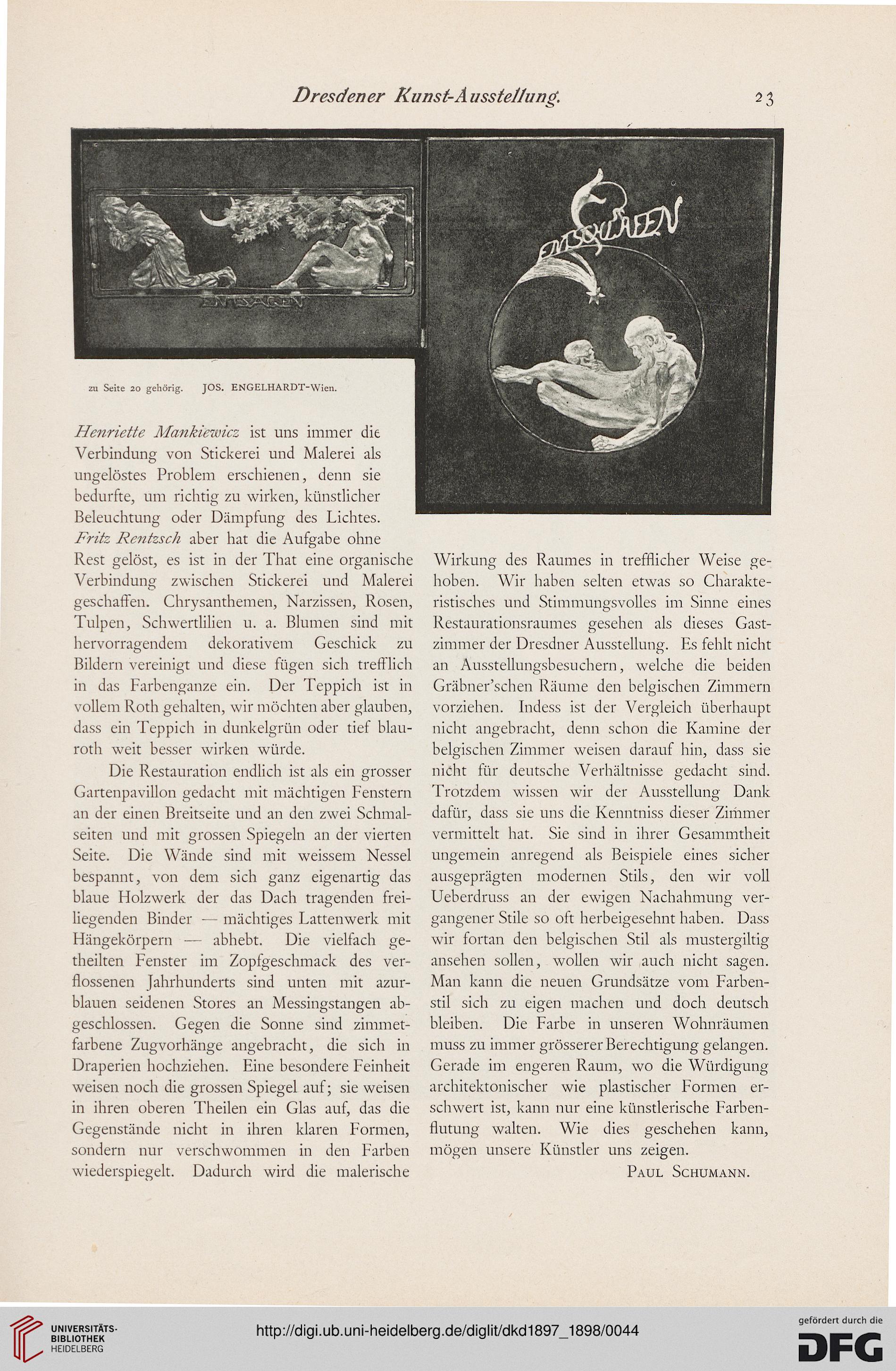Dresdener Kunst-Ausstellung.
23
zu Seite 20 gehö
Henriette Mankiewicz ist uns immer die
Verbindung von Stickerei und Malerei als
ungelöstes Problem erschienen, denn sie
bedurfte, um richtig zu wirken, künstlicher
Beleuchtung oder Dämpfung des Lichtes.
Fritz Rentzsch aber hat die Aufgabe ohne
Rest gelöst, es ist in der That eine organische
Verbindung zwischen Stickerei und Malerei
geschaffen. Chrysanthemen, Narzissen, Rosen,
Tulpen, Schwertlilien u. a. Blumen sind mit
hervorragendem dekorativem Geschick zu
Bildern vereinigt und diese fügen sich trefflich
in das Farbenganze ein. Der Teppich ist in
vollem Roth gehalten, wir möchten aber glauben,
dass ein Teppich in dunkelgrün oder tief blau-
roth weit besser wirken würde.
Die Restauration endlich ist als ein grosser
Gartenpavillon gedacht mit mächtigen Fenstern
an der einen Breitseite und an den zwei Schmal-
seiten und mit grossen Spiegeln an der vierten
Seite. Die Wände sind mit weissem Nessel
bespannt, von dem sich ganz eigenartig das
blaue Holzwerk der das Dach tragenden frei-
liegenden Binder — mächtiges Lattenwerk mit
Hängekörpern — abhebt. Die vielfach ge-
theilten Fenster im Zopfgeschmack des ver-
flossenen Jahrhunderts sind unten mit azur-
blauen seidenen Stores an Messingstangen ab-
geschlossen. Gegen die Sonne sind zimmet-
farbene Zugvorhänge angebracht, die sich in
Draperien hochziehen. Eine besondere Feinheit
weisen noch die grossen Spiegel auf; sie weisen
in ihren oberen Theilen ein Glas auf, das die
Gegenstände nicht in ihren klaren Formen,
sondern nur verschwommen in den Farben
wiederspiegelt. Dadurch wird die malerische
Wirkung des Raumes in trefflicher Weise ge-
hoben. Wir haben selten etwas so Charakte-
ristisches und Stimmungsvolles im Sinne eines
Restaurationsraumes gesehen als dieses Gast-
zimmer der Dresdner Ausstellung. Es fehlt nicht
an Ausstellungsbesuchern, welche die beiden
Gräbner'schen Räume den belgischen Zimmern
vorziehen. Indess ist der Vergleich überhaupt
nicht angebracht, denn schon die Kamine der
belgischen Zimmer weisen darauf hin, dass sie
nicht für deutsche Verhältnisse gedacht sind.
Trotzdem wissen wir der Ausstellung Dank
dafür, dass sie uns die Kenntniss dieser Zimmer
vermittelt hat. Sie sind in ihrer Gesammtheit
ungemein anregend als Beispiele eines sicher
ausgeprägten modernen Stils, den wir voll
Ueberdruss an der ewigen Nachahmung ver-
gangener Stile so oft herbeigesehnt haben. Dass
wir fortan den belgischen Stil als mustergiltig
ansehen sollen, wollen wir auch nicht sagen.
Man kann die neuen Grundsätze vom Farben-
stil sich zu eigen machen und doch deutsch
bleiben. Die Farbe in unseren Wohnräumen
muss zu immer grösserer Berechtigung gelangen.
Gerade im engeren Raum, wo die Würdigung
architektonischer wie plastischer Formen er-
schwert ist, kann nur eine künstlerische Farben-
flutung walten. Wie dies geschehen kann,
mögen unsere Künstler uns zeigen.
Paul Schumann.
23
zu Seite 20 gehö
Henriette Mankiewicz ist uns immer die
Verbindung von Stickerei und Malerei als
ungelöstes Problem erschienen, denn sie
bedurfte, um richtig zu wirken, künstlicher
Beleuchtung oder Dämpfung des Lichtes.
Fritz Rentzsch aber hat die Aufgabe ohne
Rest gelöst, es ist in der That eine organische
Verbindung zwischen Stickerei und Malerei
geschaffen. Chrysanthemen, Narzissen, Rosen,
Tulpen, Schwertlilien u. a. Blumen sind mit
hervorragendem dekorativem Geschick zu
Bildern vereinigt und diese fügen sich trefflich
in das Farbenganze ein. Der Teppich ist in
vollem Roth gehalten, wir möchten aber glauben,
dass ein Teppich in dunkelgrün oder tief blau-
roth weit besser wirken würde.
Die Restauration endlich ist als ein grosser
Gartenpavillon gedacht mit mächtigen Fenstern
an der einen Breitseite und an den zwei Schmal-
seiten und mit grossen Spiegeln an der vierten
Seite. Die Wände sind mit weissem Nessel
bespannt, von dem sich ganz eigenartig das
blaue Holzwerk der das Dach tragenden frei-
liegenden Binder — mächtiges Lattenwerk mit
Hängekörpern — abhebt. Die vielfach ge-
theilten Fenster im Zopfgeschmack des ver-
flossenen Jahrhunderts sind unten mit azur-
blauen seidenen Stores an Messingstangen ab-
geschlossen. Gegen die Sonne sind zimmet-
farbene Zugvorhänge angebracht, die sich in
Draperien hochziehen. Eine besondere Feinheit
weisen noch die grossen Spiegel auf; sie weisen
in ihren oberen Theilen ein Glas auf, das die
Gegenstände nicht in ihren klaren Formen,
sondern nur verschwommen in den Farben
wiederspiegelt. Dadurch wird die malerische
Wirkung des Raumes in trefflicher Weise ge-
hoben. Wir haben selten etwas so Charakte-
ristisches und Stimmungsvolles im Sinne eines
Restaurationsraumes gesehen als dieses Gast-
zimmer der Dresdner Ausstellung. Es fehlt nicht
an Ausstellungsbesuchern, welche die beiden
Gräbner'schen Räume den belgischen Zimmern
vorziehen. Indess ist der Vergleich überhaupt
nicht angebracht, denn schon die Kamine der
belgischen Zimmer weisen darauf hin, dass sie
nicht für deutsche Verhältnisse gedacht sind.
Trotzdem wissen wir der Ausstellung Dank
dafür, dass sie uns die Kenntniss dieser Zimmer
vermittelt hat. Sie sind in ihrer Gesammtheit
ungemein anregend als Beispiele eines sicher
ausgeprägten modernen Stils, den wir voll
Ueberdruss an der ewigen Nachahmung ver-
gangener Stile so oft herbeigesehnt haben. Dass
wir fortan den belgischen Stil als mustergiltig
ansehen sollen, wollen wir auch nicht sagen.
Man kann die neuen Grundsätze vom Farben-
stil sich zu eigen machen und doch deutsch
bleiben. Die Farbe in unseren Wohnräumen
muss zu immer grösserer Berechtigung gelangen.
Gerade im engeren Raum, wo die Würdigung
architektonischer wie plastischer Formen er-
schwert ist, kann nur eine künstlerische Farben-
flutung walten. Wie dies geschehen kann,
mögen unsere Künstler uns zeigen.
Paul Schumann.