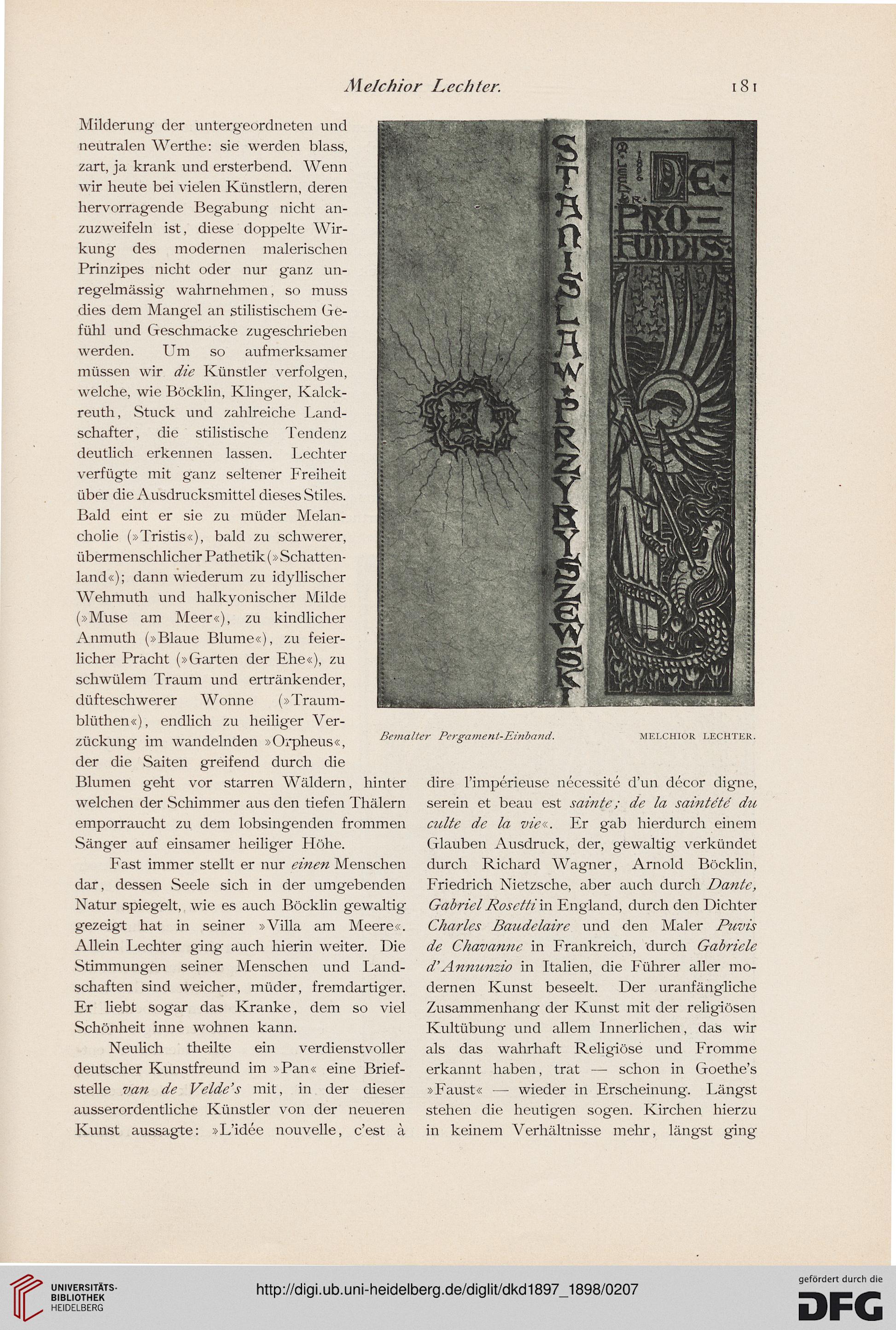Melchior Lechter.
181
Milderung der untergeordneten und
neutralen Werthe: sie werden blass,
zart, ja krank und ersterbend. Wenn
wir heute bei vielen Künstlern, deren
hervorragende Begabung nicht an-
zuzweifeln ist, diese doppelte Wir-
kung des modernen malerischen
Prinzipes nicht oder nur ganz un-
regelmässig wahrnehmen, so muss
dies dem Mangel an stilistischem Ge-
fühl und Geschmacke zugeschrieben
werden. Um so aufmerksamer
müssen wir die Künstler verfolgen,
welche, wie Böcklin, Klinger, Kalk-
reuth, Stuck und zahlreiche Land-
schafter, die stilistische Tendenz
deutlich erkennen lassen. Lechter
verfügte mit ganz seltener Freiheit
über die Ausdrucksmittel dieses Stiles.
Bald eint er sie zu müder Melan-
cholie (»Tristis«), bald zu schwerer,
übermenschlicher Pathetik(» Schatten-
land«); dann wiederum zu idyllischer
Wehmuth und halkyonischer Milde
(»Muse am Meer«), zu kindlicher
Anmuth (»Blaue Blume«), zu feier-
licher Pracht (»Garten der Ehe«), zu
schwülem Traum und ertränkender,
düfteschwerer Wonne (»Traum-
blüthen«), endlich zu heiliger Ver-
zückung im wandelnden »Orpheus«,
der die Saiten greifend durch die
Blumen geht vor starren Wäldern, hinter
welchen der Schimmer aus den tiefen Thälern
emporraucht zu dem lobsingenden frommen
Sänger auf einsamer heiliger Höhe.
Fast immer stellt er nur einen Menschen
dar, dessen Seele sich in der umgebenden
Natur spiegelt, wie es auch Böcklin gewaltig
gezeigt hat in seiner »Villa am Meere«.
Allein Lechter ging auch hierin weiter. Die
Stimmungen seiner Menschen und Land-
schaften sind weicher, müder, fremdartiger.
Er liebt sogar das Kranke, dem so viel
Schönheit inne wohnen kann.
Neulich theilte ein verdienstvoller
deutscher Kunstfreund im »Pan« eine Brief-
stelle van de Velde's mit, in der dieser
ausserordentliche Künstler von der neueren
Kunst aussagte: »L'idee nouvelle, c'est ä
Bemalter Pergament-Einband.
M Kl.CM l( IR I.KCMTKK.
dire l'imperieuse necessite d'un decor digne,
serein et beau est sainte; de la sainte'tc du
culte de la vie«. Er gab hierdurch einem
Glauben Ausdruck, der, gewaltig verkündet
durch Richard Wagner, Arnold Böcklin,
Friedrich Nietzsche, aber auch durch Dante,
GabrielRosctti'in England, durch den Dichter
Charles Baudelaire und den Maler Puvis
de Chavannc in Frankreich, durch Gabriele
d'Annunzio in Italien, die Führer aller mo-
dernen Kunst beseelt. Der uranfängliche
Zusammenhang der Kunst mit der religiösen
Kultübung und allem Innerlichen, das wir
als das wahrhaft Religiöse und Fromme
erkannt haben, trat — schon in Goethe's
»Faust« — wieder in Erscheinung. Längst
stehen die heutigen sogen. Kirchen hierzu
in keinem Verhältnisse mehr, längst ging
181
Milderung der untergeordneten und
neutralen Werthe: sie werden blass,
zart, ja krank und ersterbend. Wenn
wir heute bei vielen Künstlern, deren
hervorragende Begabung nicht an-
zuzweifeln ist, diese doppelte Wir-
kung des modernen malerischen
Prinzipes nicht oder nur ganz un-
regelmässig wahrnehmen, so muss
dies dem Mangel an stilistischem Ge-
fühl und Geschmacke zugeschrieben
werden. Um so aufmerksamer
müssen wir die Künstler verfolgen,
welche, wie Böcklin, Klinger, Kalk-
reuth, Stuck und zahlreiche Land-
schafter, die stilistische Tendenz
deutlich erkennen lassen. Lechter
verfügte mit ganz seltener Freiheit
über die Ausdrucksmittel dieses Stiles.
Bald eint er sie zu müder Melan-
cholie (»Tristis«), bald zu schwerer,
übermenschlicher Pathetik(» Schatten-
land«); dann wiederum zu idyllischer
Wehmuth und halkyonischer Milde
(»Muse am Meer«), zu kindlicher
Anmuth (»Blaue Blume«), zu feier-
licher Pracht (»Garten der Ehe«), zu
schwülem Traum und ertränkender,
düfteschwerer Wonne (»Traum-
blüthen«), endlich zu heiliger Ver-
zückung im wandelnden »Orpheus«,
der die Saiten greifend durch die
Blumen geht vor starren Wäldern, hinter
welchen der Schimmer aus den tiefen Thälern
emporraucht zu dem lobsingenden frommen
Sänger auf einsamer heiliger Höhe.
Fast immer stellt er nur einen Menschen
dar, dessen Seele sich in der umgebenden
Natur spiegelt, wie es auch Böcklin gewaltig
gezeigt hat in seiner »Villa am Meere«.
Allein Lechter ging auch hierin weiter. Die
Stimmungen seiner Menschen und Land-
schaften sind weicher, müder, fremdartiger.
Er liebt sogar das Kranke, dem so viel
Schönheit inne wohnen kann.
Neulich theilte ein verdienstvoller
deutscher Kunstfreund im »Pan« eine Brief-
stelle van de Velde's mit, in der dieser
ausserordentliche Künstler von der neueren
Kunst aussagte: »L'idee nouvelle, c'est ä
Bemalter Pergament-Einband.
M Kl.CM l( IR I.KCMTKK.
dire l'imperieuse necessite d'un decor digne,
serein et beau est sainte; de la sainte'tc du
culte de la vie«. Er gab hierdurch einem
Glauben Ausdruck, der, gewaltig verkündet
durch Richard Wagner, Arnold Böcklin,
Friedrich Nietzsche, aber auch durch Dante,
GabrielRosctti'in England, durch den Dichter
Charles Baudelaire und den Maler Puvis
de Chavannc in Frankreich, durch Gabriele
d'Annunzio in Italien, die Führer aller mo-
dernen Kunst beseelt. Der uranfängliche
Zusammenhang der Kunst mit der religiösen
Kultübung und allem Innerlichen, das wir
als das wahrhaft Religiöse und Fromme
erkannt haben, trat — schon in Goethe's
»Faust« — wieder in Erscheinung. Längst
stehen die heutigen sogen. Kirchen hierzu
in keinem Verhältnisse mehr, längst ging