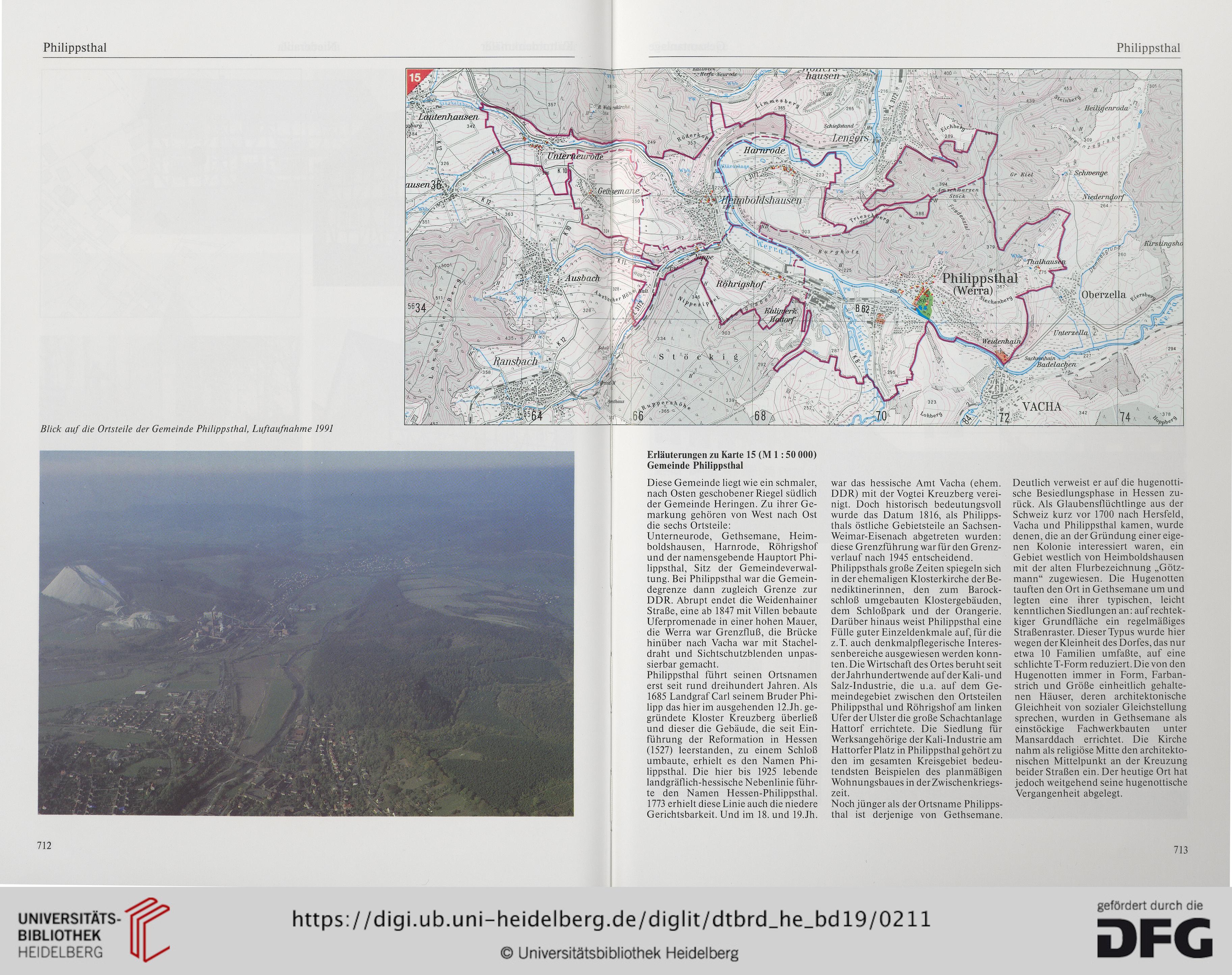Philippsthal
Philippsthal
Blick auf die Ortsteile der Gemeinde Philippsthal, Luftaufnahme 1991
Erläuterungen zu Karte 15 (M 1:50 000)
Gemeinde Philippsthal
Diese Gemeinde liegt wie ein schmaler,
nach Osten geschobener Riegel südlich
der Gemeinde Heringen. Zu ihrer Ge-
markung gehören von West nach Ost
die sechs Ortsteile:
Unterneurode, Gethsemane, Heim-
boldshausen, Harnrode, Röhrigshof
und der namensgebende Hauptort Phi-
lippsthal, Sitz der Gemeindeverwal-
tung. Bei Philippsthal war die Gemein-
degrenze dann zugleich Grenze zur
DDR. Abrupt endet die Weidenhainer
Straße, eine ab 1847 mit Villen bebaute
Uferpromenade in einer hohen Mauer,
die Werra war Grenzfluß, die Brücke
hinüber nach Vacha war mit Stachel-
draht und Sichtschutzblenden unpas-
sierbar gemacht.
Philippsthal führt seinen Ortsnamen
erst seit rund dreihundert Jahren. Als
1685 Landgraf Carl seinem Bruder Phi-
lipp das hier im ausgehenden 12.Jh. ge-
gründete Kloster Kreuzberg überließ
und dieser die Gebäude, die seit Ein-
führung der Reformation in Hessen
(1527) leerstanden, zu einem Schloß
umbaute, erhielt es den Namen Phi-
lippsthal. Die hier bis 1925 lebende
landgräflich-hessische Nebenlinie führ-
te den Namen Hessen-Philippsthal.
1773 erhielt diese Linie auch die niedere
Gerichtsbarkeit. Und im 18. und 19.Jh.
war das hessische Amt Vacha (ehern.
DDR) mit der Vogtei Kreuzberg verei-
nigt. Doch historisch bedeutungsvoll
wurde das Datum 1816, als Philipps-
thals östliche Gebietsteile an Sachsen-
Weimar-Eisenach abgetreten wurden:
diese Grenzführung war für den Grenz-
verlauf nach 1945 entscheidend.
Philippsthals große Zeiten spiegeln sich
in der ehemaligen Klosterkirche der Be-
nediktinerinnen, den zum Barock-
schloß umgebauten Klostergebäuden,
dem Schloßpark und der Orangerie.
Darüber hinaus weist Philippsthal eine
Fülle guter Einzeldenkmale auf, für die
z.T. auch denkmalpflegerische Interes-
senbereiche ausgewiesen werden konn-
ten. Die Wirtschaft des Ortes beruht seit
der Jahrhundertwende auf der Kali-und
Salz-Industrie, die u.a. auf dem Ge-
meindegebiet zwischen den Ortsteilen
Philippsthal und Röhrigshof am linken
Ufer der Ulster die große Schachtanlage
Hattorf errichtete. Die Siedlung für
Werksangehörige der Kali-Industrie am
Hattorfer Platz in Philippsthal gehört zu
den im gesamten Kreisgebiet bedeu-
tendsten Beispielen des planmäßigen
Wohnungsbaues in der Zwischenkriegs-
zeit.
Noch jünger als der Ortsname Philipps-
thal ist derjenige von Gethsemane.
Deutlich verweist er auf die hugenotti-
sche Besiedlungsphase in Hessen zu-
rück. Als Glaubensflüchtlinge aus der
Schweiz kurz vor 1700 nach Hersfeld,
Vacha und Philippsthal kamen, wurde
denen, die an der Gründung einer eige-
nen Kolonie interessiert waren, ein
Gebiet westlich von Heimboldshausen
mit der alten Flurbezeichnung „Götz-
mann“ zugewiesen. Die Hugenotten
tauften den Ort in Gethsemane um und
legten eine ihrer typischen, leicht
kenntlichen Siedlungen an: aufrechtek-
kiger Grundfläche ein regelmäßiges
Straßenraster. Dieser Typus wurde hier
wegen der Kleinheit des Dorfes, das nur
etwa 10 Familien umfaßte, auf eine
schlichte T-Form reduziert. Die von den
Hugenotten immer in Form, Farban-
strich und Größe einheitlich gehalte-
nen Häuser, deren architektonische
Gleichheit von sozialer Gleichstellung
sprechen, wurden in Gethsemane als
einstöckige Fachwerkbauten unter
Mansarddach errichtet. Die Kirche
nahm als religiöse Mitte den architekto-
nischen Mittelpunkt an der Kreuzung
beider Straßen ein. Der heutige Ort hat
jedoch weitgehend seine hugenottische
Vergangenheit abgelegt.
712
713
Philippsthal
Blick auf die Ortsteile der Gemeinde Philippsthal, Luftaufnahme 1991
Erläuterungen zu Karte 15 (M 1:50 000)
Gemeinde Philippsthal
Diese Gemeinde liegt wie ein schmaler,
nach Osten geschobener Riegel südlich
der Gemeinde Heringen. Zu ihrer Ge-
markung gehören von West nach Ost
die sechs Ortsteile:
Unterneurode, Gethsemane, Heim-
boldshausen, Harnrode, Röhrigshof
und der namensgebende Hauptort Phi-
lippsthal, Sitz der Gemeindeverwal-
tung. Bei Philippsthal war die Gemein-
degrenze dann zugleich Grenze zur
DDR. Abrupt endet die Weidenhainer
Straße, eine ab 1847 mit Villen bebaute
Uferpromenade in einer hohen Mauer,
die Werra war Grenzfluß, die Brücke
hinüber nach Vacha war mit Stachel-
draht und Sichtschutzblenden unpas-
sierbar gemacht.
Philippsthal führt seinen Ortsnamen
erst seit rund dreihundert Jahren. Als
1685 Landgraf Carl seinem Bruder Phi-
lipp das hier im ausgehenden 12.Jh. ge-
gründete Kloster Kreuzberg überließ
und dieser die Gebäude, die seit Ein-
führung der Reformation in Hessen
(1527) leerstanden, zu einem Schloß
umbaute, erhielt es den Namen Phi-
lippsthal. Die hier bis 1925 lebende
landgräflich-hessische Nebenlinie führ-
te den Namen Hessen-Philippsthal.
1773 erhielt diese Linie auch die niedere
Gerichtsbarkeit. Und im 18. und 19.Jh.
war das hessische Amt Vacha (ehern.
DDR) mit der Vogtei Kreuzberg verei-
nigt. Doch historisch bedeutungsvoll
wurde das Datum 1816, als Philipps-
thals östliche Gebietsteile an Sachsen-
Weimar-Eisenach abgetreten wurden:
diese Grenzführung war für den Grenz-
verlauf nach 1945 entscheidend.
Philippsthals große Zeiten spiegeln sich
in der ehemaligen Klosterkirche der Be-
nediktinerinnen, den zum Barock-
schloß umgebauten Klostergebäuden,
dem Schloßpark und der Orangerie.
Darüber hinaus weist Philippsthal eine
Fülle guter Einzeldenkmale auf, für die
z.T. auch denkmalpflegerische Interes-
senbereiche ausgewiesen werden konn-
ten. Die Wirtschaft des Ortes beruht seit
der Jahrhundertwende auf der Kali-und
Salz-Industrie, die u.a. auf dem Ge-
meindegebiet zwischen den Ortsteilen
Philippsthal und Röhrigshof am linken
Ufer der Ulster die große Schachtanlage
Hattorf errichtete. Die Siedlung für
Werksangehörige der Kali-Industrie am
Hattorfer Platz in Philippsthal gehört zu
den im gesamten Kreisgebiet bedeu-
tendsten Beispielen des planmäßigen
Wohnungsbaues in der Zwischenkriegs-
zeit.
Noch jünger als der Ortsname Philipps-
thal ist derjenige von Gethsemane.
Deutlich verweist er auf die hugenotti-
sche Besiedlungsphase in Hessen zu-
rück. Als Glaubensflüchtlinge aus der
Schweiz kurz vor 1700 nach Hersfeld,
Vacha und Philippsthal kamen, wurde
denen, die an der Gründung einer eige-
nen Kolonie interessiert waren, ein
Gebiet westlich von Heimboldshausen
mit der alten Flurbezeichnung „Götz-
mann“ zugewiesen. Die Hugenotten
tauften den Ort in Gethsemane um und
legten eine ihrer typischen, leicht
kenntlichen Siedlungen an: aufrechtek-
kiger Grundfläche ein regelmäßiges
Straßenraster. Dieser Typus wurde hier
wegen der Kleinheit des Dorfes, das nur
etwa 10 Familien umfaßte, auf eine
schlichte T-Form reduziert. Die von den
Hugenotten immer in Form, Farban-
strich und Größe einheitlich gehalte-
nen Häuser, deren architektonische
Gleichheit von sozialer Gleichstellung
sprechen, wurden in Gethsemane als
einstöckige Fachwerkbauten unter
Mansarddach errichtet. Die Kirche
nahm als religiöse Mitte den architekto-
nischen Mittelpunkt an der Kreuzung
beider Straßen ein. Der heutige Ort hat
jedoch weitgehend seine hugenottische
Vergangenheit abgelegt.
712
713