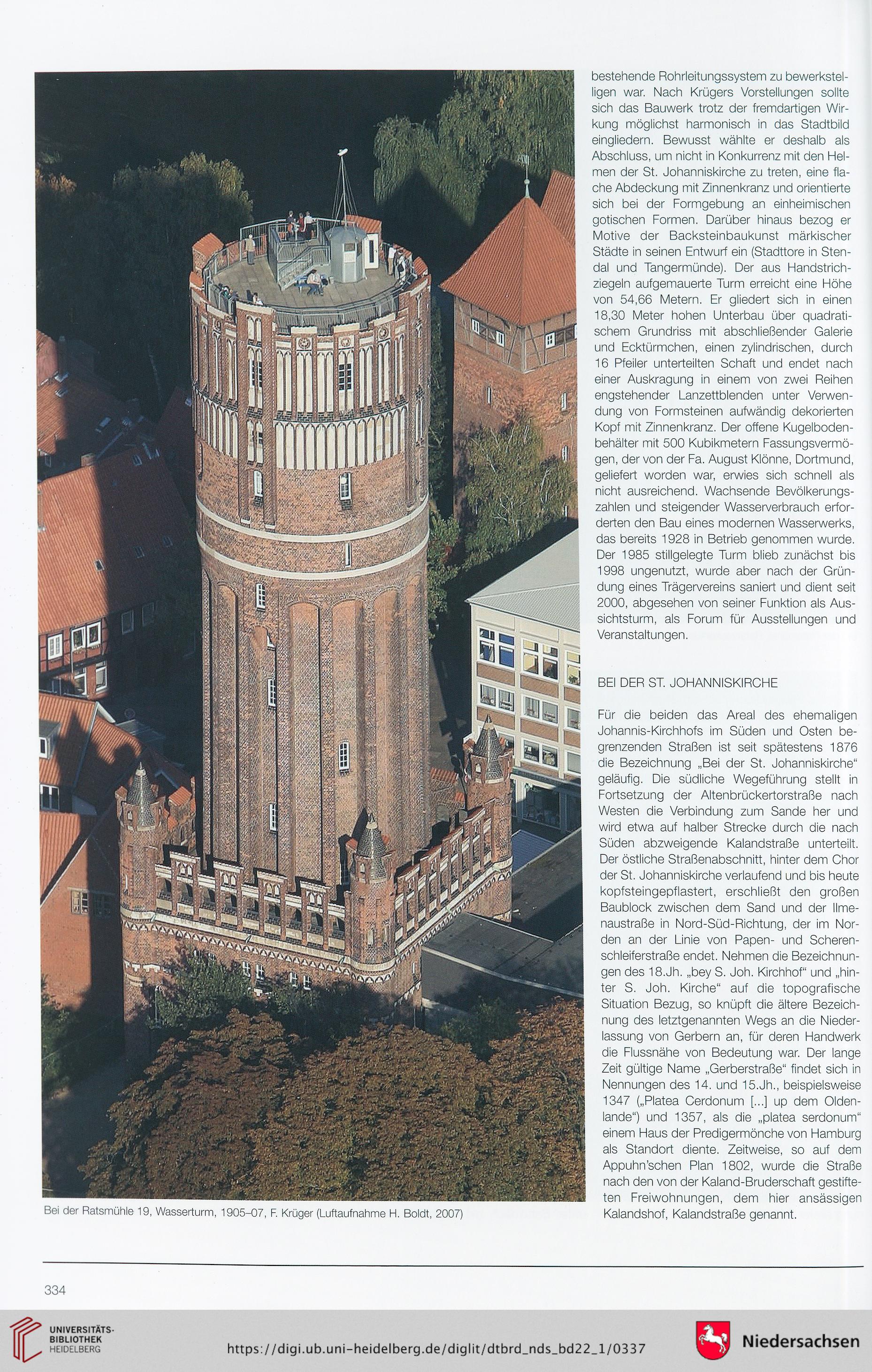Bei der Ratsmühle 19, Wasserturm, 1905-07, F. Krüger (Luftaufnahme H. Boldt, 2007)
bestehende Rohrleitungssystem zu bewerkstel-
ligen war. Nach Krügers Vorstellungen sollte
sich das Bauwerk trotz der fremdartigen Wir-
kung möglichst harmonisch in das Stadtbild
eingliedern. Bewusst wählte er deshalb als
Abschluss, um nicht in Konkurrenz mit den Hel-
men der St. Johanniskirche zu treten, eine fla-
che Abdeckung mit Zinnenkranz und orientierte
sich bei der Formgebung an einheimischen
gotischen Formen. Darüber hinaus bezog er
Motive der Backsteinbaukunst märkischer
Städte in seinen Entwurf ein (Stadttore in Sten-
dal und Tangermünde). Der aus Handstrich-
ziegeln aufgemauerte Turm erreicht eine Höhe
von 54,66 Metern. Er gliedert sich in einen
18,30 Meter hohen Unterbau über quadrati-
schem Grundriss mit abschließender Galerie
und Ecktürmchen, einen zylindrischen, durch
16 Pfeiler unterteilten Schaft und endet nach
einer Auskragung in einem von zwei Reihen
engstehender Lanzettblenden unter Verwen-
dung von Formsteinen aufwändig dekorierten
Kopf mit Zinnenkranz. Der offene Kugelboden-
behälter mit 500 Kubikmetern Fassungsvermö-
gen, der von der Fa. August Klönne, Dortmund,
geliefert worden war, erwies sich schnell als
nicht ausreichend. Wachsende Bevölkerungs-
zahlen und steigender Wasserverbrauch erfor-
derten den Bau eines modernen Wasserwerks,
das bereits 1928 in Betrieb genommen wurde.
Der 1985 stillgelegte Turm blieb zunächst bis
1998 ungenutzt, wurde aber nach der Grün-
dung eines Trägervereins saniert und dient seit
2000, abgesehen von seiner Funktion als Aus-
sichtsturm, als Forum für Ausstellungen und
Veranstaltungen.
BEI DER ST. JOHANNISKIRCHE
Für die beiden das Areal des ehemaligen
Johannis-Kirchhofs im Süden und Osten be-
grenzenden Straßen ist seit spätestens 1876
die Bezeichnung „Bei der St. Johanniskirche“
geläufig. Die südliche Wegeführung stellt in
Fortsetzung der Altenbrückertorstraße nach
Westen die Verbindung zum Sande her und
wird etwa auf halber Strecke durch die nach
Süden abzweigende Kalandstraße unterteilt.
Der östliche Straßenabschnitt, hinter dem Chor
der St. Johanniskirche verlaufend und bis heute
kopfsteingepflastert, erschließt den großen
Baublock zwischen dem Sand und der llme-
naustraße in Nord-Süd-Richtung, der im Nor-
den an der Linie von Papen- und Scheren-
schleiferstraße endet. Nehmen die Bezeichnun-
gen des 18.Jh. „bey S. Joh. Kirchhof“ und „hin-
ter S. Joh. Kirche“ auf die topografische
Situation Bezug, so knüpft die ältere Bezeich-
nung des letztgenannten Wegs an die Nieder-
lassung von Gerbern an, für deren Handwerk
die Flussnähe von Bedeutung war. Der lange
Zeit gültige Name „Gerberstraße“ findet sich in
Nennungen des 14. und 15.Jh., beispielsweise
1347 („Platea Cerdonum [...] up dem Olden-
lande“) und 1357, als die „platea serdonum“
einem Haus der Predigermönche von Hamburg
als Standort diente. Zeitweise, so auf dem
Appuhn’schen Plan 1802, wurde die Straße
nach den von der Kaland-Bruderschaft gestifte-
ten Freiwohnungen, dem hier ansässigen
Kalandshof, Kalandstraße genannt.
334
bestehende Rohrleitungssystem zu bewerkstel-
ligen war. Nach Krügers Vorstellungen sollte
sich das Bauwerk trotz der fremdartigen Wir-
kung möglichst harmonisch in das Stadtbild
eingliedern. Bewusst wählte er deshalb als
Abschluss, um nicht in Konkurrenz mit den Hel-
men der St. Johanniskirche zu treten, eine fla-
che Abdeckung mit Zinnenkranz und orientierte
sich bei der Formgebung an einheimischen
gotischen Formen. Darüber hinaus bezog er
Motive der Backsteinbaukunst märkischer
Städte in seinen Entwurf ein (Stadttore in Sten-
dal und Tangermünde). Der aus Handstrich-
ziegeln aufgemauerte Turm erreicht eine Höhe
von 54,66 Metern. Er gliedert sich in einen
18,30 Meter hohen Unterbau über quadrati-
schem Grundriss mit abschließender Galerie
und Ecktürmchen, einen zylindrischen, durch
16 Pfeiler unterteilten Schaft und endet nach
einer Auskragung in einem von zwei Reihen
engstehender Lanzettblenden unter Verwen-
dung von Formsteinen aufwändig dekorierten
Kopf mit Zinnenkranz. Der offene Kugelboden-
behälter mit 500 Kubikmetern Fassungsvermö-
gen, der von der Fa. August Klönne, Dortmund,
geliefert worden war, erwies sich schnell als
nicht ausreichend. Wachsende Bevölkerungs-
zahlen und steigender Wasserverbrauch erfor-
derten den Bau eines modernen Wasserwerks,
das bereits 1928 in Betrieb genommen wurde.
Der 1985 stillgelegte Turm blieb zunächst bis
1998 ungenutzt, wurde aber nach der Grün-
dung eines Trägervereins saniert und dient seit
2000, abgesehen von seiner Funktion als Aus-
sichtsturm, als Forum für Ausstellungen und
Veranstaltungen.
BEI DER ST. JOHANNISKIRCHE
Für die beiden das Areal des ehemaligen
Johannis-Kirchhofs im Süden und Osten be-
grenzenden Straßen ist seit spätestens 1876
die Bezeichnung „Bei der St. Johanniskirche“
geläufig. Die südliche Wegeführung stellt in
Fortsetzung der Altenbrückertorstraße nach
Westen die Verbindung zum Sande her und
wird etwa auf halber Strecke durch die nach
Süden abzweigende Kalandstraße unterteilt.
Der östliche Straßenabschnitt, hinter dem Chor
der St. Johanniskirche verlaufend und bis heute
kopfsteingepflastert, erschließt den großen
Baublock zwischen dem Sand und der llme-
naustraße in Nord-Süd-Richtung, der im Nor-
den an der Linie von Papen- und Scheren-
schleiferstraße endet. Nehmen die Bezeichnun-
gen des 18.Jh. „bey S. Joh. Kirchhof“ und „hin-
ter S. Joh. Kirche“ auf die topografische
Situation Bezug, so knüpft die ältere Bezeich-
nung des letztgenannten Wegs an die Nieder-
lassung von Gerbern an, für deren Handwerk
die Flussnähe von Bedeutung war. Der lange
Zeit gültige Name „Gerberstraße“ findet sich in
Nennungen des 14. und 15.Jh., beispielsweise
1347 („Platea Cerdonum [...] up dem Olden-
lande“) und 1357, als die „platea serdonum“
einem Haus der Predigermönche von Hamburg
als Standort diente. Zeitweise, so auf dem
Appuhn’schen Plan 1802, wurde die Straße
nach den von der Kaland-Bruderschaft gestifte-
ten Freiwohnungen, dem hier ansässigen
Kalandshof, Kalandstraße genannt.
334