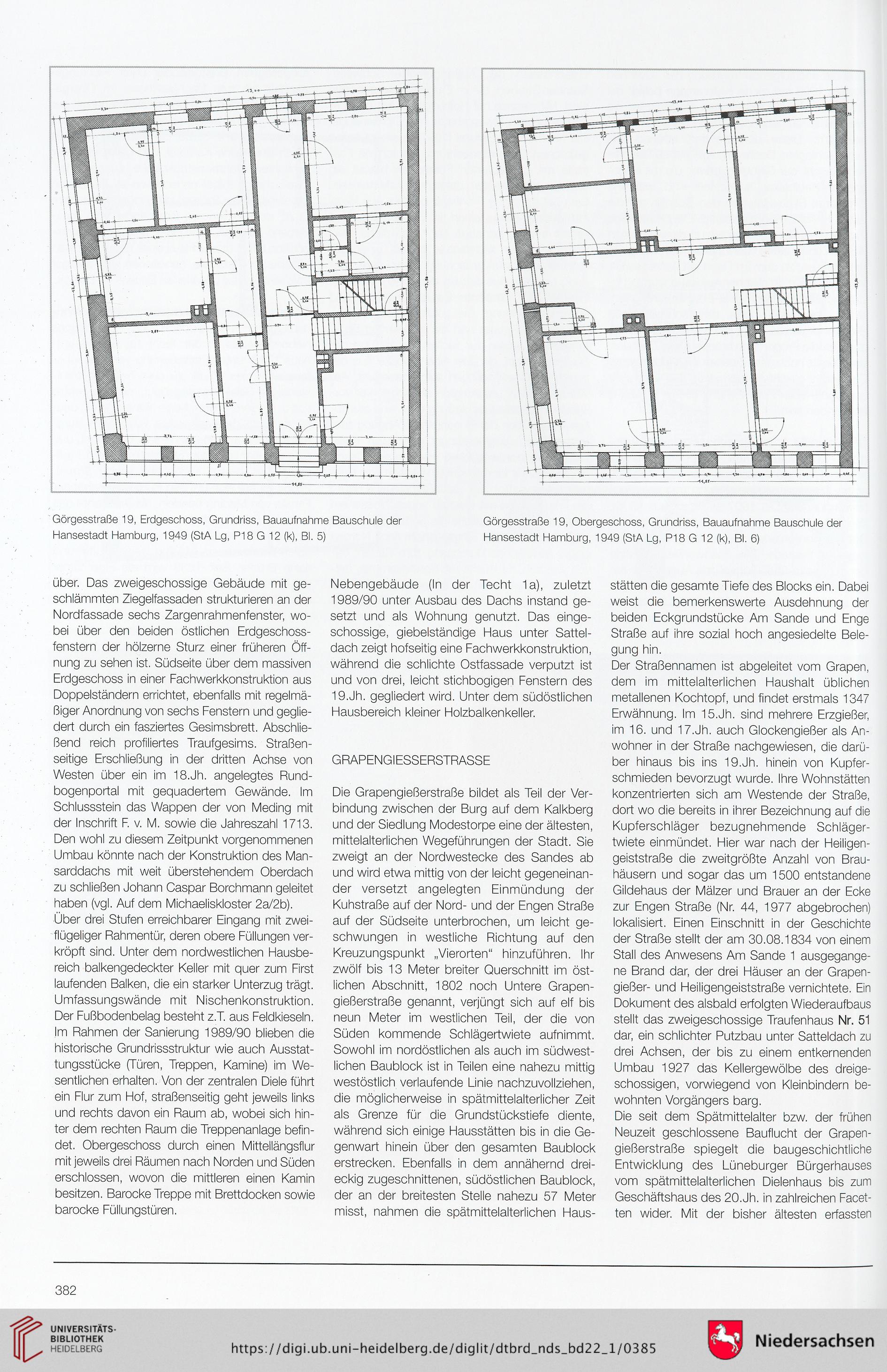Görgesstraße 19, Erdgeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der
Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 5)
"l,.| .! I...| 1 |f|
1 T—!-T|
.. .J .' Tj
-4H|£S-
Görgesstraße 19, Obergeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der
Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 6)
über. Das zweigeschossige Gebäude mit ge-
schlämmten Ziegelfassaden strukturieren an der
Nordfassade sechs Zargenrahmenfenster, wo-
bei über den beiden östlichen Erdgeschoss-
fenstern der hölzerne Sturz einer früheren Öff-
nung zu sehen ist. Südseite über dem massiven
Erdgeschoss in einer Fachwerkkonstruktion aus
Doppelständern errichtet, ebenfalls mit regelmä-
ßiger Anordnung von sechs Fenstern und geglie-
dert durch ein fasziertes Gesimsbrett. Abschlie-
ßend reich profiliertes Traufgesims. Straßen-
seitige Erschließung in der dritten Achse von
Westen über ein im 18.Jh. angelegtes Rund-
bogenportal mit gequadertem Gewände. Im
Schlussstein das Wappen der von Meding mit
der Inschrift F. v. M. sowie die Jahreszahl 1713.
Den wohl zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen
Umbau könnte nach der Konstruktion des Man-
sarddachs mit weit überstehendem Oberdach
zu schließen Johann Caspar Borchmann geleitet
haben (vgl. Auf dem Michaeliskloster 2a/2b).
Über drei Stufen erreichbarer Eingang mit zwei-
flügeliger Rahmentür, deren obere Füllungen ver-
kröpft sind. Unter dem nordwestlichen Hausbe-
reich balkengedeckter Keller mit quer zum First
laufenden Balken, die ein starker Unterzug trägt.
Umfassungswände mit Nischenkonstruktion.
Der Fußbodenbelag besteht z.T. aus Feldkieseln.
Im Rahmen der Sanierung 1989/90 blieben die
historische Grundrissstruktur wie auch Ausstat-
tungsstücke (Türen, Treppen, Kamine) im We-
sentlichen erhalten. Von der zentralen Diele führt
ein Flur zum Hof, straßenseitig geht jeweils links
und rechts davon ein Raum ab, wobei sich hin-
ter dem rechten Raum die Treppenanlage befin-
det. Obergeschoss durch einen Mittellängsflur
mit jeweils drei Räumen nach Norden und Süden
erschlossen, wovon die mittleren einen Kamin
besitzen. Barocke Treppe mit Brettdocken sowie
barocke Füllungstüren.
Nebengebäude (In der Techt la), zuletzt
1989/90 unter Ausbau des Dachs instand ge-
setzt und als Wohnung genutzt. Das einge-
schossige, giebelständige Haus unter Sattel-
dach zeigt hofseitig eine Fachwerkkonstruktion,
während die schlichte Ostfassade verputzt ist
und von drei, leicht stichbogigen Fenstern des
19.Jh. gegliedert wird. Unter dem südöstlichen
Hausbereich kleiner Holzbalkenkeller.
GRAPENGIESSERSTRASSE
Die Grapengießerstraße bildet als Teil der Ver-
bindung zwischen der Burg auf dem Kalkberg
und der Siedlung Modestorpe eine der ältesten,
mittelalterlichen Wegeführungen der Stadt. Sie
zweigt an der Nordwestecke des Sandes ab
und wird etwa mittig von der leicht gegeneinan-
der versetzt angelegten Einmündung der
Kuhstraße auf der Nord- und der Engen Straße
auf der Südseite unterbrochen, um leicht ge-
schwungen in westliche Richtung auf den
Kreuzungspunkt „Vierorten“ hinzuführen. Ihr
zwölf bis 13 Meter breiter Querschnitt im öst-
lichen Abschnitt, 1802 noch Untere Grapen-
gießerstraße genannt, verjüngt sich auf elf bis
neun Meter im westlichen Teil, der die von
Süden kommende Schlägertwiete aufnimmt.
Sowohl im nordöstlichen als auch im südwest-
lichen Baublock ist in Teilen eine nahezu mittig
westöstlich verlaufende Linie nachzuvollziehen,
die möglicherweise in spätmittelalterlicher Zeit
als Grenze für die Grundstückstiefe diente,
während sich einige Hausstätten bis in die Ge-
genwart hinein über den gesamten Baublock
erstrecken. Ebenfalls in dem annähernd drei-
eckig zugeschnittenen, südöstlichen Baublock,
der an der breitesten Stelle nahezu 57 Meter
misst, nahmen die spätmittelalterlichen Haus-
stätten die gesamte Tiefe des Blocks ein. Dabei
weist die bemerkenswerte Ausdehnung der
beiden Eckgrundstücke Am Sande und Enge
Straße auf ihre sozial hoch angesiedelte Bele-
gung hin.
Der Straßennamen ist abgeleitet vom Grapen,
dem im mittelalterlichen Haushalt üblichen
metallenen Kochtopf, und findet erstmals 1347
Erwähnung. Im 15.Jh. sind mehrere Erzgießer,
im 16. und 17.Jh. auch Glockengießer als An-
wohner in der Straße nachgewiesen, die darü-
ber hinaus bis ins 19.Jh. hinein von Kupfer-
schmieden bevorzugt wurde. Ihre Wohnstätten
konzentrierten sich am Westende der Straße,
dort wo die bereits in ihrer Bezeichnung auf die
Kupferschläger bezugnehmende Schläger-
twiete einmündet. Hier war nach der Heiligen-
geiststraße die zweitgrößte Anzahl von Brau-
häusern und sogar das um 1500 entstandene
Gildehaus der Mälzer und Brauer an der Ecke
zur Engen Straße (Nr. 44, 1977 abgebrochen)
lokalisiert. Einen Einschnitt in der Geschichte
der Straße stellt der am 30.08.1834 von einem
Stall des Anwesens Am Sande 1 ausgegange-
ne Brand dar, der drei Häuser an der Grapen-
gießer- und Heiligengeiststraße vernichtete. Ein
Dokument des alsbald erfolgten Wiederaufbaus
stellt das zweigeschossige Traufenhaus Nr. 51
dar, ein schlichter Putzbau unter Satteldach zu
drei Achsen, der bis zu einem entkernenden
Umbau 1927 das Kellergewölbe des dreige-
schossigen, vorwiegend von Kleinbindern be-
wohnten Vorgängers barg.
Die seit dem Spätmittelalter bzw. der frühen
Neuzeit geschlossene Bauflucht der Grapen-
gießerstraße spiegelt die baugeschichtliche
Entwicklung des Lüneburger Bürgerhauses
vom spätmittelalterlichen Dielenhaus bis zum
Geschäftshaus des 20.Jh. in zahlreichen Facet-
ten wider. Mit der bisher ältesten erfassten
382
Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 5)
"l,.| .! I...| 1 |f|
1 T—!-T|
.. .J .' Tj
-4H|£S-
Görgesstraße 19, Obergeschoss, Grundriss, Bauaufnahme Bauschule der
Hansestadt Hamburg, 1949 (StA Lg, P18 G 12 (k), BI. 6)
über. Das zweigeschossige Gebäude mit ge-
schlämmten Ziegelfassaden strukturieren an der
Nordfassade sechs Zargenrahmenfenster, wo-
bei über den beiden östlichen Erdgeschoss-
fenstern der hölzerne Sturz einer früheren Öff-
nung zu sehen ist. Südseite über dem massiven
Erdgeschoss in einer Fachwerkkonstruktion aus
Doppelständern errichtet, ebenfalls mit regelmä-
ßiger Anordnung von sechs Fenstern und geglie-
dert durch ein fasziertes Gesimsbrett. Abschlie-
ßend reich profiliertes Traufgesims. Straßen-
seitige Erschließung in der dritten Achse von
Westen über ein im 18.Jh. angelegtes Rund-
bogenportal mit gequadertem Gewände. Im
Schlussstein das Wappen der von Meding mit
der Inschrift F. v. M. sowie die Jahreszahl 1713.
Den wohl zu diesem Zeitpunkt vorgenommenen
Umbau könnte nach der Konstruktion des Man-
sarddachs mit weit überstehendem Oberdach
zu schließen Johann Caspar Borchmann geleitet
haben (vgl. Auf dem Michaeliskloster 2a/2b).
Über drei Stufen erreichbarer Eingang mit zwei-
flügeliger Rahmentür, deren obere Füllungen ver-
kröpft sind. Unter dem nordwestlichen Hausbe-
reich balkengedeckter Keller mit quer zum First
laufenden Balken, die ein starker Unterzug trägt.
Umfassungswände mit Nischenkonstruktion.
Der Fußbodenbelag besteht z.T. aus Feldkieseln.
Im Rahmen der Sanierung 1989/90 blieben die
historische Grundrissstruktur wie auch Ausstat-
tungsstücke (Türen, Treppen, Kamine) im We-
sentlichen erhalten. Von der zentralen Diele führt
ein Flur zum Hof, straßenseitig geht jeweils links
und rechts davon ein Raum ab, wobei sich hin-
ter dem rechten Raum die Treppenanlage befin-
det. Obergeschoss durch einen Mittellängsflur
mit jeweils drei Räumen nach Norden und Süden
erschlossen, wovon die mittleren einen Kamin
besitzen. Barocke Treppe mit Brettdocken sowie
barocke Füllungstüren.
Nebengebäude (In der Techt la), zuletzt
1989/90 unter Ausbau des Dachs instand ge-
setzt und als Wohnung genutzt. Das einge-
schossige, giebelständige Haus unter Sattel-
dach zeigt hofseitig eine Fachwerkkonstruktion,
während die schlichte Ostfassade verputzt ist
und von drei, leicht stichbogigen Fenstern des
19.Jh. gegliedert wird. Unter dem südöstlichen
Hausbereich kleiner Holzbalkenkeller.
GRAPENGIESSERSTRASSE
Die Grapengießerstraße bildet als Teil der Ver-
bindung zwischen der Burg auf dem Kalkberg
und der Siedlung Modestorpe eine der ältesten,
mittelalterlichen Wegeführungen der Stadt. Sie
zweigt an der Nordwestecke des Sandes ab
und wird etwa mittig von der leicht gegeneinan-
der versetzt angelegten Einmündung der
Kuhstraße auf der Nord- und der Engen Straße
auf der Südseite unterbrochen, um leicht ge-
schwungen in westliche Richtung auf den
Kreuzungspunkt „Vierorten“ hinzuführen. Ihr
zwölf bis 13 Meter breiter Querschnitt im öst-
lichen Abschnitt, 1802 noch Untere Grapen-
gießerstraße genannt, verjüngt sich auf elf bis
neun Meter im westlichen Teil, der die von
Süden kommende Schlägertwiete aufnimmt.
Sowohl im nordöstlichen als auch im südwest-
lichen Baublock ist in Teilen eine nahezu mittig
westöstlich verlaufende Linie nachzuvollziehen,
die möglicherweise in spätmittelalterlicher Zeit
als Grenze für die Grundstückstiefe diente,
während sich einige Hausstätten bis in die Ge-
genwart hinein über den gesamten Baublock
erstrecken. Ebenfalls in dem annähernd drei-
eckig zugeschnittenen, südöstlichen Baublock,
der an der breitesten Stelle nahezu 57 Meter
misst, nahmen die spätmittelalterlichen Haus-
stätten die gesamte Tiefe des Blocks ein. Dabei
weist die bemerkenswerte Ausdehnung der
beiden Eckgrundstücke Am Sande und Enge
Straße auf ihre sozial hoch angesiedelte Bele-
gung hin.
Der Straßennamen ist abgeleitet vom Grapen,
dem im mittelalterlichen Haushalt üblichen
metallenen Kochtopf, und findet erstmals 1347
Erwähnung. Im 15.Jh. sind mehrere Erzgießer,
im 16. und 17.Jh. auch Glockengießer als An-
wohner in der Straße nachgewiesen, die darü-
ber hinaus bis ins 19.Jh. hinein von Kupfer-
schmieden bevorzugt wurde. Ihre Wohnstätten
konzentrierten sich am Westende der Straße,
dort wo die bereits in ihrer Bezeichnung auf die
Kupferschläger bezugnehmende Schläger-
twiete einmündet. Hier war nach der Heiligen-
geiststraße die zweitgrößte Anzahl von Brau-
häusern und sogar das um 1500 entstandene
Gildehaus der Mälzer und Brauer an der Ecke
zur Engen Straße (Nr. 44, 1977 abgebrochen)
lokalisiert. Einen Einschnitt in der Geschichte
der Straße stellt der am 30.08.1834 von einem
Stall des Anwesens Am Sande 1 ausgegange-
ne Brand dar, der drei Häuser an der Grapen-
gießer- und Heiligengeiststraße vernichtete. Ein
Dokument des alsbald erfolgten Wiederaufbaus
stellt das zweigeschossige Traufenhaus Nr. 51
dar, ein schlichter Putzbau unter Satteldach zu
drei Achsen, der bis zu einem entkernenden
Umbau 1927 das Kellergewölbe des dreige-
schossigen, vorwiegend von Kleinbindern be-
wohnten Vorgängers barg.
Die seit dem Spätmittelalter bzw. der frühen
Neuzeit geschlossene Bauflucht der Grapen-
gießerstraße spiegelt die baugeschichtliche
Entwicklung des Lüneburger Bürgerhauses
vom spätmittelalterlichen Dielenhaus bis zum
Geschäftshaus des 20.Jh. in zahlreichen Facet-
ten wider. Mit der bisher ältesten erfassten
382