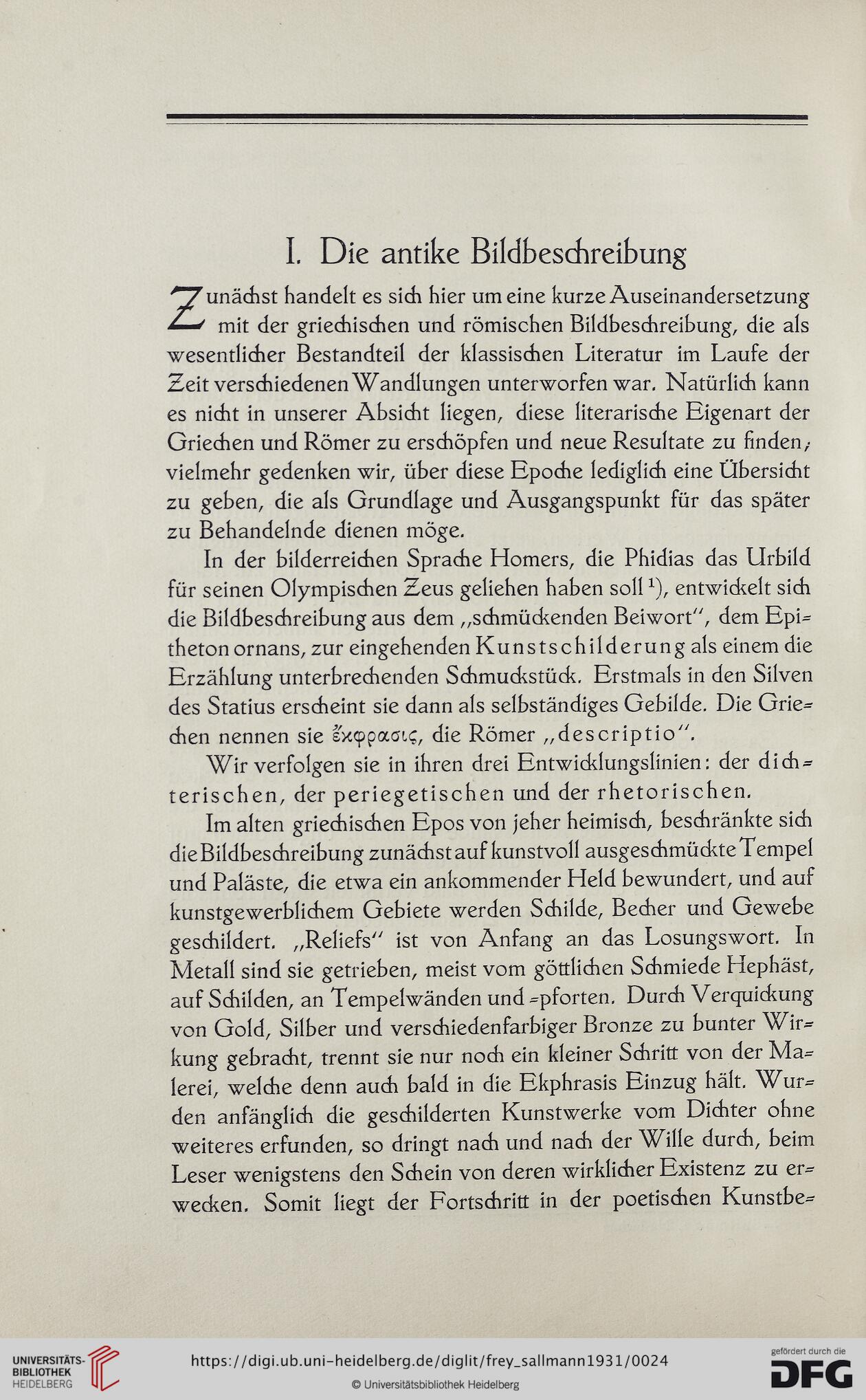I. Die antike Bildbeschreibung
Zunächst handelt es sich hier um eine kurze Auseinandersetzung
mit der griechischen und römischen Bildbeschreibung, die als
wesentlicher Bestandteil der klassischen Literatur im Laufe der
Zeit verschiedenen Wandlungen unterworfen war. Natürlich kann
es nicht in unserer Absicht liegen, diese literarische Eigenart der
Griechen und Römer zu erschöpfen und neue Resultate zu finden,-
vielmehr gedenken wir, über diese Epoche lediglich eine Übersicht
zu geben, die als Grundlage und Ausgangspunkt für das später
zu Behandelnde dienen möge.
In der bilderreichen Sprache Homers, die Phidias das Urbild
für seinen Olympischen Zeus geliehen haben sollx), entwickelt sich
die Bildbeschreibung aus dem ,,schmückenden Beiwort“, dem Epi-
theton ornans, zur eingehenden Kunstschilderung als einem die
Erzählung unterbrechenden Schmuckstück. Erstmals in den Silven
des Statius erscheint sie dann als selbständiges Gebilde. Die Grie-
chen nennen sie szcppaGi;, die Römer „descriptio“.
Wir verfolgen sie in ihren drei Entwicklungslinien: der dich-
terischen, der periegetischen und der rhetorischen.
Im alten griechischen Epos von jeher heimisch, beschränkte sich
die Bildbeschreibung zunächst auf kunstvoll ausgeschmüdcte Tempel
und Paläste, die etwa ein ankommender Held bewundert, und auf
kunstgewerblichem Gebiete werden Schilde, Becher und Gewebe
geschildert. „Reliefs“ ist von Anfang an das Losungswort. In
Metall sind sie getrieben, meist vom göttlichen Schmiede Hephäst,
auf Schilden, an Tempelwänden und-pforten. Durch Verquickung
von Gold, Silber und verschiedenfarbiger Bronze zu bunter Wir-
kung gebracht, trennt sie nur noch ein kleiner Schritt von der Ma-
lerei, welche denn auch bald in die Ekphrasis Einzug hält. Wur-
den anfänglich die geschilderten Kunstwerke vom Dichter ohne
weiteres erfunden, so dringt nach und nach der Wille durch, beim
Leser wenigstens den Schein von deren wirklicher Existenz zu er-
wecken. Somit liegt der Fortschritt in der poetischen Kunstbe-
Zunächst handelt es sich hier um eine kurze Auseinandersetzung
mit der griechischen und römischen Bildbeschreibung, die als
wesentlicher Bestandteil der klassischen Literatur im Laufe der
Zeit verschiedenen Wandlungen unterworfen war. Natürlich kann
es nicht in unserer Absicht liegen, diese literarische Eigenart der
Griechen und Römer zu erschöpfen und neue Resultate zu finden,-
vielmehr gedenken wir, über diese Epoche lediglich eine Übersicht
zu geben, die als Grundlage und Ausgangspunkt für das später
zu Behandelnde dienen möge.
In der bilderreichen Sprache Homers, die Phidias das Urbild
für seinen Olympischen Zeus geliehen haben sollx), entwickelt sich
die Bildbeschreibung aus dem ,,schmückenden Beiwort“, dem Epi-
theton ornans, zur eingehenden Kunstschilderung als einem die
Erzählung unterbrechenden Schmuckstück. Erstmals in den Silven
des Statius erscheint sie dann als selbständiges Gebilde. Die Grie-
chen nennen sie szcppaGi;, die Römer „descriptio“.
Wir verfolgen sie in ihren drei Entwicklungslinien: der dich-
terischen, der periegetischen und der rhetorischen.
Im alten griechischen Epos von jeher heimisch, beschränkte sich
die Bildbeschreibung zunächst auf kunstvoll ausgeschmüdcte Tempel
und Paläste, die etwa ein ankommender Held bewundert, und auf
kunstgewerblichem Gebiete werden Schilde, Becher und Gewebe
geschildert. „Reliefs“ ist von Anfang an das Losungswort. In
Metall sind sie getrieben, meist vom göttlichen Schmiede Hephäst,
auf Schilden, an Tempelwänden und-pforten. Durch Verquickung
von Gold, Silber und verschiedenfarbiger Bronze zu bunter Wir-
kung gebracht, trennt sie nur noch ein kleiner Schritt von der Ma-
lerei, welche denn auch bald in die Ekphrasis Einzug hält. Wur-
den anfänglich die geschilderten Kunstwerke vom Dichter ohne
weiteres erfunden, so dringt nach und nach der Wille durch, beim
Leser wenigstens den Schein von deren wirklicher Existenz zu er-
wecken. Somit liegt der Fortschritt in der poetischen Kunstbe-