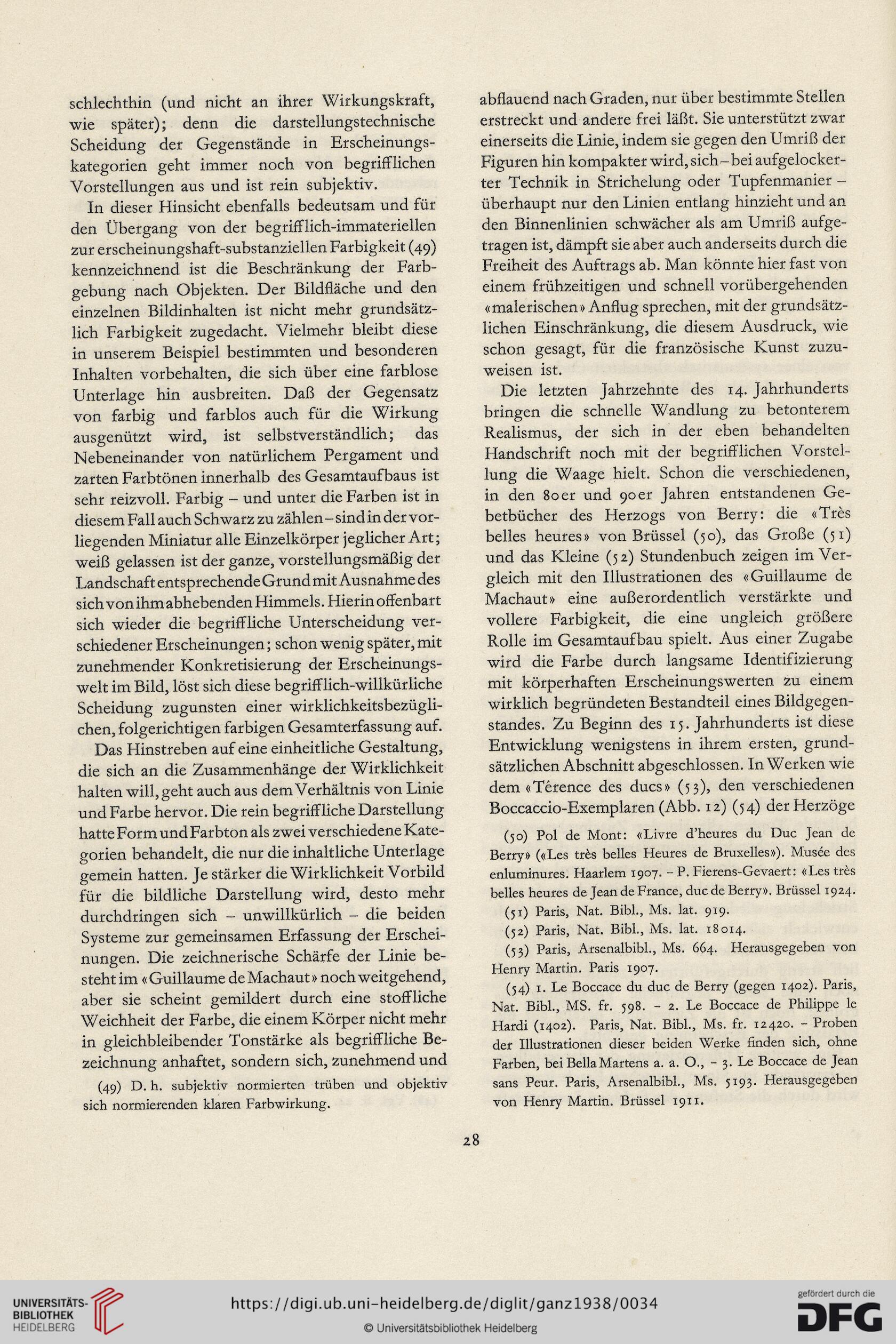schlechthin (und nicht an ihrer Wirkungskraft,
wie später); denn die darstellungstechnische
Scheidung der Gegenstände in Erscheinungs-
kategorien geht immer noch von begrifflichen
Vorstellungen aus und ist rein subjektiv.
In dieser Hinsicht ebenfalls bedeutsam und für
den Übergang von der begrifflich-immateriellen
zur erscheinungshaft-substanziellen Farbigkeit (49)
kennzeichnend ist die Beschränkung der Farb-
gebung nach Objekten. Der Bildfläche und den
einzelnen Bildinhalten ist nicht mehr grundsätz-
lich Farbigkeit zugedacht. Vielmehr bleibt diese
in unserem Beispiel bestimmten und besonderen
Inhalten vorbehalten, die sich über eine farblose
Unterlage hin ausbreiten. Daß der Gegensatz
von farbig und farblos auch für die Wirkung
ausgenützt wird, ist selbstverständlich; das
Nebeneinander von natürlichem Pergament und
zarten Farbtönen innerhalb des Gesamtaufbaus ist
sehr reizvoll. Farbig - und unter die Farben ist in
diesem Fall auch Schwarz zu zählen-sind in der vor-
liegenden Miniatur alle Einzelkörper jeglicher Art;
weiß gelassen ist der ganze, vorstellungsmäßig der
Landschaft entsprechende Grund mit Ausnahme des
sich von ihm abhebenden Himmels. Hierin offenbart
sich wieder die begriffliche Unterscheidung ver-
schiedener Erscheinungen; schon wenig später, mit
zunehmender Konkretisierung der Erscheinungs-
welt im Bild, löst sich diese begrifflich-willkürliche
Scheidung zugunsten einer wirklichkeitsbezügli-
chen, folgerichtigen farbigen Gesamterfassung auf.
Das Hinstreben auf eine einheitliche Gestaltung,
die sich an die Zusammenhänge der Wirklichkeit
halten will, geht auch aus dem Verhältnis von Linie
und Farbe hervor. Die rein begriffliche Darstellung
hatte Form und Farbton als zwei verschiedene Kate-
gorien behandelt, die nur die inhaltliche Unterlage
gemein hatten. Je stärker die Wirklichkeit Vorbild
für die bildliche Darstellung wird, desto mehr
durchdringen sich - unwillkürlich - die beiden
Systeme zur gemeinsamen Erfassung der Erschei-
nungen. Die zeichnerische Schärfe der Linie be-
steht im«Guillaume de Machaut»noch weitgehend,
aber sie scheint gemildert durch eine stoffliche
Weichheit der Farbe, die einem Körper nicht mehr
in gleichbleibender Tonstärke als begriffliche Be-
zeichnung anhaftet, sondern sich, zunehmend und
(49) D. h. subjektiv normierten trüben und objektiv
sich normierenden klaren Farbwirkung.
abflauend nach Graden, nur über bestimmte Stellen
erstreckt und andere frei läßt. Sie unterstützt zwar
einerseits die Linie, indem sie gegen den Umriß der
Figuren hin kompakter wird, sich-bei aufgelocker-
ter Technik in Strichelung oder Tupfenmanier -
überhaupt nur den Linien entlang hinzieht und an
den Binnenlinien schwächer als am Umriß aufge-
tragen ist, dämpft sie aber auch anderseits durch die
Freiheit des Auftrags ab. Man könnte hier fast von
einem frühzeitigen und schnell vorübergehenden
«malerischen»Anflug sprechen, mit der grundsätz-
lichen Einschränkung, die diesem Ausdruck, wie
schon gesagt, für die französische Kunst zuzu-
weisen ist.
Die letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts
bringen die schnelle Wandlung zu betonterem
Realismus, der sich in der eben behandelten
Handschrift noch mit der begrifflichen Vorstel-
lung die Waage hielt. Schon die verschiedenen,
in den 80er und 90er Jahren entstandenen Ge-
betbücher des Herzogs von Berry: die «Tres
beiles heures» von Brüssel (50), das Große (51)
und das Kleine (52) Stundenbuch zeigen im Ver-
gleich mit den Illustrationen des «Guillaume de
Machaut» eine außerordentlich verstärkte und
vollere Farbigkeit, die eine ungleich größere
Rolle im Gesamtaufbau spielt. Aus einer Zugabe
wird die Farbe durch langsame Identifizierung
mit körperhaften Erscheinungswerten zu einem
wirklich begründeten Bestandteil eines Bildgegen-
standes. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist diese
Entwicklung wenigstens in ihrem ersten, grund-
sätzlichen Abschnitt abgeschlossen. In Werken wie
dem «Terence des ducs» (53), den verschiedenen
Boccaccio-Exemplaren (Abb. 12) (54) der Herzöge
(50) Pol de Mont: «Livre d’heurcs du Duc Jean de
Berry» («Les trds beiles Heures de Bruxelles»). Musee des
enluminures. Haarlem 1907. - P. Fierens-Gevaert: «Les trcs
helles heures de Jean de France, duc de Berry». Brüssel 1924.
(51) Paris, Nat. Bibi., Ms. lat. 919.
(52) Paris, Nat. Bibi., Ms. lat. 18014.
(53) Paris, Arsenalbibl., Ms. 664. Herausgegeben von
Henry Martin. Paris 1907.
(54) 1. Le Boccace du duc de Berry (gegen 1402). Paris,
Nat. Bibi., MS. fr. 598. - 2. Le Boccace de Philippe le
Hardi (1402). Paris, Nat. Bibi., Ms. fr. 12420. - Proben
der Illustrationen dieser beiden Werke finden sich, ohne
Farben, bei Bella Martens a. a. O., - 3. Le Boccace de Jean
sans Peur. Paris, Arsenalbibl., Ms. 5193. Herausgegeben
von Henry Martin. Brüssel 1911.
28
wie später); denn die darstellungstechnische
Scheidung der Gegenstände in Erscheinungs-
kategorien geht immer noch von begrifflichen
Vorstellungen aus und ist rein subjektiv.
In dieser Hinsicht ebenfalls bedeutsam und für
den Übergang von der begrifflich-immateriellen
zur erscheinungshaft-substanziellen Farbigkeit (49)
kennzeichnend ist die Beschränkung der Farb-
gebung nach Objekten. Der Bildfläche und den
einzelnen Bildinhalten ist nicht mehr grundsätz-
lich Farbigkeit zugedacht. Vielmehr bleibt diese
in unserem Beispiel bestimmten und besonderen
Inhalten vorbehalten, die sich über eine farblose
Unterlage hin ausbreiten. Daß der Gegensatz
von farbig und farblos auch für die Wirkung
ausgenützt wird, ist selbstverständlich; das
Nebeneinander von natürlichem Pergament und
zarten Farbtönen innerhalb des Gesamtaufbaus ist
sehr reizvoll. Farbig - und unter die Farben ist in
diesem Fall auch Schwarz zu zählen-sind in der vor-
liegenden Miniatur alle Einzelkörper jeglicher Art;
weiß gelassen ist der ganze, vorstellungsmäßig der
Landschaft entsprechende Grund mit Ausnahme des
sich von ihm abhebenden Himmels. Hierin offenbart
sich wieder die begriffliche Unterscheidung ver-
schiedener Erscheinungen; schon wenig später, mit
zunehmender Konkretisierung der Erscheinungs-
welt im Bild, löst sich diese begrifflich-willkürliche
Scheidung zugunsten einer wirklichkeitsbezügli-
chen, folgerichtigen farbigen Gesamterfassung auf.
Das Hinstreben auf eine einheitliche Gestaltung,
die sich an die Zusammenhänge der Wirklichkeit
halten will, geht auch aus dem Verhältnis von Linie
und Farbe hervor. Die rein begriffliche Darstellung
hatte Form und Farbton als zwei verschiedene Kate-
gorien behandelt, die nur die inhaltliche Unterlage
gemein hatten. Je stärker die Wirklichkeit Vorbild
für die bildliche Darstellung wird, desto mehr
durchdringen sich - unwillkürlich - die beiden
Systeme zur gemeinsamen Erfassung der Erschei-
nungen. Die zeichnerische Schärfe der Linie be-
steht im«Guillaume de Machaut»noch weitgehend,
aber sie scheint gemildert durch eine stoffliche
Weichheit der Farbe, die einem Körper nicht mehr
in gleichbleibender Tonstärke als begriffliche Be-
zeichnung anhaftet, sondern sich, zunehmend und
(49) D. h. subjektiv normierten trüben und objektiv
sich normierenden klaren Farbwirkung.
abflauend nach Graden, nur über bestimmte Stellen
erstreckt und andere frei läßt. Sie unterstützt zwar
einerseits die Linie, indem sie gegen den Umriß der
Figuren hin kompakter wird, sich-bei aufgelocker-
ter Technik in Strichelung oder Tupfenmanier -
überhaupt nur den Linien entlang hinzieht und an
den Binnenlinien schwächer als am Umriß aufge-
tragen ist, dämpft sie aber auch anderseits durch die
Freiheit des Auftrags ab. Man könnte hier fast von
einem frühzeitigen und schnell vorübergehenden
«malerischen»Anflug sprechen, mit der grundsätz-
lichen Einschränkung, die diesem Ausdruck, wie
schon gesagt, für die französische Kunst zuzu-
weisen ist.
Die letzten Jahrzehnte des 14. Jahrhunderts
bringen die schnelle Wandlung zu betonterem
Realismus, der sich in der eben behandelten
Handschrift noch mit der begrifflichen Vorstel-
lung die Waage hielt. Schon die verschiedenen,
in den 80er und 90er Jahren entstandenen Ge-
betbücher des Herzogs von Berry: die «Tres
beiles heures» von Brüssel (50), das Große (51)
und das Kleine (52) Stundenbuch zeigen im Ver-
gleich mit den Illustrationen des «Guillaume de
Machaut» eine außerordentlich verstärkte und
vollere Farbigkeit, die eine ungleich größere
Rolle im Gesamtaufbau spielt. Aus einer Zugabe
wird die Farbe durch langsame Identifizierung
mit körperhaften Erscheinungswerten zu einem
wirklich begründeten Bestandteil eines Bildgegen-
standes. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist diese
Entwicklung wenigstens in ihrem ersten, grund-
sätzlichen Abschnitt abgeschlossen. In Werken wie
dem «Terence des ducs» (53), den verschiedenen
Boccaccio-Exemplaren (Abb. 12) (54) der Herzöge
(50) Pol de Mont: «Livre d’heurcs du Duc Jean de
Berry» («Les trds beiles Heures de Bruxelles»). Musee des
enluminures. Haarlem 1907. - P. Fierens-Gevaert: «Les trcs
helles heures de Jean de France, duc de Berry». Brüssel 1924.
(51) Paris, Nat. Bibi., Ms. lat. 919.
(52) Paris, Nat. Bibi., Ms. lat. 18014.
(53) Paris, Arsenalbibl., Ms. 664. Herausgegeben von
Henry Martin. Paris 1907.
(54) 1. Le Boccace du duc de Berry (gegen 1402). Paris,
Nat. Bibi., MS. fr. 598. - 2. Le Boccace de Philippe le
Hardi (1402). Paris, Nat. Bibi., Ms. fr. 12420. - Proben
der Illustrationen dieser beiden Werke finden sich, ohne
Farben, bei Bella Martens a. a. O., - 3. Le Boccace de Jean
sans Peur. Paris, Arsenalbibl., Ms. 5193. Herausgegeben
von Henry Martin. Brüssel 1911.
28