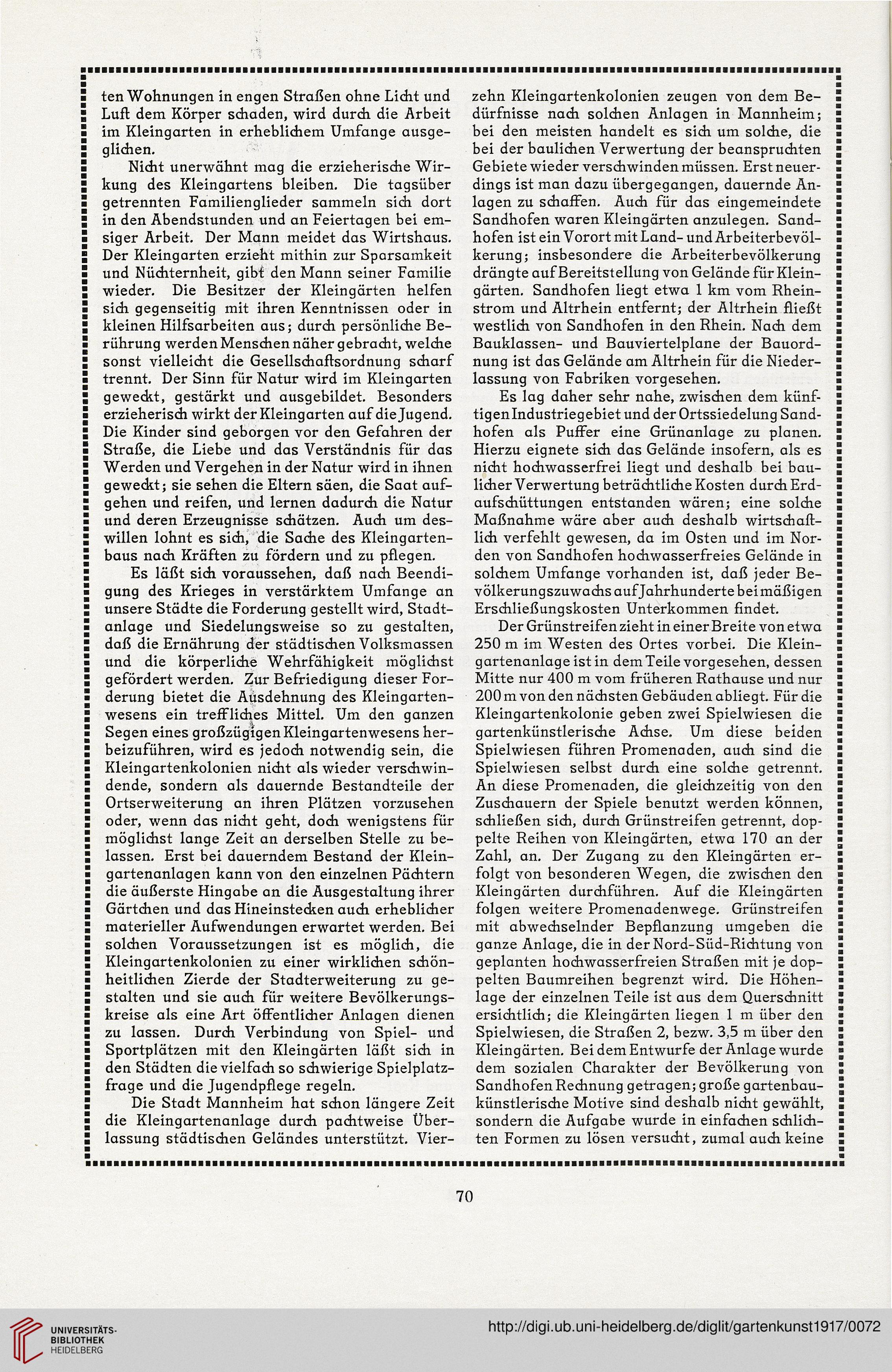ten Wohnungen in engen Straßen ohne Licht und
Luft dem Körper schaden, wird durch die Arbeit
im Kleingarten in erheblichem Umfange ausge-
glichen.
Nicht unerwähnt mag die erzieherische Wir-
kung des Kleingartens bleiben. Die tagsüber
getrennten Familienglieder sammeln sich dort
in den Abendstunden und an Feiertagen bei em-
siger Arbeit. Der Mann meidet das Wirtshaus.
Der Kleingarten erzieht mithin zur Sparsamkeit
und Nüchternheit, gibt den Mann seiner Familie
wieder. Die Besitzer der Kleingärten helfen
sich gegenseitig mit ihren Kenntnissen oder in
kleinen Hilfsarbeiten aus; durch persönliche Be-
rührung werden Menschen näher gebracht, welche
sonst vielleicht die Gesellschaftsordnung scharf
trennt. Der Sinn für Natur wird im Kleingarten
geweckt, gestärkt und ausgebildet. Besonders
erzieherisch wirkt der Kleingarten auf die Jugend.
Die Kinder sind geborgen vor den Gefahren der
Straße, die Liebe und das Verständnis für das
Werden und Vergehen in der Natur wird in ihnen
geweckt; sie sehen die Eltern säen, die Saat auf-
gehen und reifen, und lernen dadurch die Natur
und deren Erzeugnisse schätzen. Auch um des-
willen lohnt es sich, die Sache des Kleingarten-
baus nach Kräften zu fördern und zu pflegen.
Es läßt sich voraussehen, daß nach Beendi-
gung des Krieges in verstärktem Umfange an
unsere Städte die Forderung gestellt wird, Stadt-
anlage und Siedelungsweise so zu gestalten,
daß die Ernährung der städtischen Volksmassen
und die körperliche Wehrfähigkeit möglichst
gefördert werden. Zur Befriedigung dieser For-
derung bietet die Ausdehnung des Kleingarten-
wesens ein treffliches Mittel. Um den ganzen
Segen eines großzügigen Kleingartenwesens her-
beizuführen, wird es jedoch notwendig sein, die
Kleingartenkolonien nicht als wieder verschwin-
dende, sondern als dauernde Bestandteile der
Ortserweiterung an ihren Plätzen vorzusehen
oder, wenn das nicht geht, doch wenigstens für
möglichst lange Zeit an derselben Stelle zu be-
lassen. Erst bei dauerndem Bestand der Klein-
gartenanlagen kann von den einzelnen Pächtern
die äußerste Hingabe an die Ausgestaltung ihrer
Gärtchen und das Hineinstecken auch erheblicher
materieller Aufwendungen erwartet werden. Bei
solchen Voraussetzungen ist es möglich, die
Kleingartenkolonien zu einer wirklichen schön-
heitlichen Zierde der Stadterweiterung zu ge-
stalten und sie auch für weitere Bevölkerungs-
kreise als eine Art öffentlicher Anlagen dienen
zu lassen. Durch Verbindung von Spiel- und
Sportplätzen mit den Kleingärten läßt sich in
den Städten die vielfach so schwierige Spielplatz-
frage und die Jugendpflege regeln.
Die Stadt Mannheim hat schon längere Zeit
die Kleingartenanlage durch pachtweise Über-
lassung städtischen Geländes unterstützt. Vier-
zehn Kleingartenkolonien zeugen von dem Be-
dürfnisse nach solchen Anlagen in Mannheim;
bei den meisten handelt es sich um solche, die
bei der baulichen Verwertung der beanspruchten
Gebiete wieder verschwinden müssen. Erst neuer-
dings ist man dazu übergegangen, dauernde An-
lagen zu schaffen. Auch für das eingemeindete
Sandhofen waren Kleingärten anzulegen. Sand-
hofen ist ein Vorort mit Land- und Arbeiterbevöl-
kerung; insbesondere die Arbeiterbevölkerung
drängte auf Bereitstellung von Gelände für Klein-
gärten. Sandhofen liegt etwa 1 km vom Rhein-
strom und Altrhein entfernt; der Altrhein fließt
westlich von Sandhofen in den Rhein. Nach dem
Bauklassen- und Bauviertelplane der Bauord-
nung ist das Gelände am Altrhein für die Nieder-
lassung von Fabriken vorgesehen.
Es lag daher sehr nahe, zwischen dem künf-
tigenlndustriegebiet und der Ortssiedelung Sand-
hofen als Puffer eine Grünanlage zu planen.
Hierzu eignete sich das Gelände insofern, als es
nicht hochwasserfrei liegt und deshalb bei bau-
licher Verwertung beträchtliche Kosten durch Erd-
aufschüttungen entstanden wären; eine solche
Maßnahme wäre aber auch deshalb wirtschaft-
lich verfehlt gewesen, da im Osten und im Nor-
den von Sandhofen hochwasserfreies Gelände in
solchem Umfange vorhanden ist, daß jeder Be-
völkerungszuwachs auf Jahrhunderte beimäßigen
Erschließungskosten Unterkommen findet.
Der Grünstreifen zieht in einer Breite von etwa
250 m im Westen des Ortes vorbei. Die Klein-
gartenanlage ist in dem Teile vorgesehen, dessen
Mitte nur 400 m vom früheren Rathause und nur
200 m von den nächsten Gebäuden abliegt. Für die
Kleingartenkolonie geben zwei Spielwiesen die
gartenkünstlerische Achse. Um diese beiden
Spielwiesen führen Promenaden, auch sind die
Spielwiesen selbst durch eine solche getrennt.
An diese Promenaden, die gleichzeitig von den
Zuschauern der Spiele benutzt werden können,
schließen sich, durch Grünstreifen getrennt, dop-
pelte Reihen von Kleingärten, etwa 170 an der
Zahl, an. Der Zugang zu den Kleingärten er-
folgt von besonderen Wegen, die zwischen den
Kleingärten durchführen. Auf die Kleingärten
folgen weitere Promenadenwege. Grünstreifen
mit abwechselnder Bepflanzung umgeben die
ganze Anlage, die in der Nord-Süd-Richtung von
geplanten hochwasserfreien Straßen mit je dop-
pelten Baumreihen begrenzt wird. Die Höhen-
lage der einzelnen Teile ist aus dem Querschnitt
ersichtlich; die Kleingärten liegen 1 m über den
Spielwiesen, die Straßen 2, bezw. 3,5 m über den
Kleingärten. Bei dem Entwürfe der Anlage wurde
dem sozialen Charakter der Bevölkerung von
Sandhofen Rechnung getragen; große gartenbau-
künstlerische Motive sind deshalb nicht gewählt,
sondern die Aufgabe wurde in einfachen schlich-
ten Formen zu lösen versucht, zumal auch keine
70
Luft dem Körper schaden, wird durch die Arbeit
im Kleingarten in erheblichem Umfange ausge-
glichen.
Nicht unerwähnt mag die erzieherische Wir-
kung des Kleingartens bleiben. Die tagsüber
getrennten Familienglieder sammeln sich dort
in den Abendstunden und an Feiertagen bei em-
siger Arbeit. Der Mann meidet das Wirtshaus.
Der Kleingarten erzieht mithin zur Sparsamkeit
und Nüchternheit, gibt den Mann seiner Familie
wieder. Die Besitzer der Kleingärten helfen
sich gegenseitig mit ihren Kenntnissen oder in
kleinen Hilfsarbeiten aus; durch persönliche Be-
rührung werden Menschen näher gebracht, welche
sonst vielleicht die Gesellschaftsordnung scharf
trennt. Der Sinn für Natur wird im Kleingarten
geweckt, gestärkt und ausgebildet. Besonders
erzieherisch wirkt der Kleingarten auf die Jugend.
Die Kinder sind geborgen vor den Gefahren der
Straße, die Liebe und das Verständnis für das
Werden und Vergehen in der Natur wird in ihnen
geweckt; sie sehen die Eltern säen, die Saat auf-
gehen und reifen, und lernen dadurch die Natur
und deren Erzeugnisse schätzen. Auch um des-
willen lohnt es sich, die Sache des Kleingarten-
baus nach Kräften zu fördern und zu pflegen.
Es läßt sich voraussehen, daß nach Beendi-
gung des Krieges in verstärktem Umfange an
unsere Städte die Forderung gestellt wird, Stadt-
anlage und Siedelungsweise so zu gestalten,
daß die Ernährung der städtischen Volksmassen
und die körperliche Wehrfähigkeit möglichst
gefördert werden. Zur Befriedigung dieser For-
derung bietet die Ausdehnung des Kleingarten-
wesens ein treffliches Mittel. Um den ganzen
Segen eines großzügigen Kleingartenwesens her-
beizuführen, wird es jedoch notwendig sein, die
Kleingartenkolonien nicht als wieder verschwin-
dende, sondern als dauernde Bestandteile der
Ortserweiterung an ihren Plätzen vorzusehen
oder, wenn das nicht geht, doch wenigstens für
möglichst lange Zeit an derselben Stelle zu be-
lassen. Erst bei dauerndem Bestand der Klein-
gartenanlagen kann von den einzelnen Pächtern
die äußerste Hingabe an die Ausgestaltung ihrer
Gärtchen und das Hineinstecken auch erheblicher
materieller Aufwendungen erwartet werden. Bei
solchen Voraussetzungen ist es möglich, die
Kleingartenkolonien zu einer wirklichen schön-
heitlichen Zierde der Stadterweiterung zu ge-
stalten und sie auch für weitere Bevölkerungs-
kreise als eine Art öffentlicher Anlagen dienen
zu lassen. Durch Verbindung von Spiel- und
Sportplätzen mit den Kleingärten läßt sich in
den Städten die vielfach so schwierige Spielplatz-
frage und die Jugendpflege regeln.
Die Stadt Mannheim hat schon längere Zeit
die Kleingartenanlage durch pachtweise Über-
lassung städtischen Geländes unterstützt. Vier-
zehn Kleingartenkolonien zeugen von dem Be-
dürfnisse nach solchen Anlagen in Mannheim;
bei den meisten handelt es sich um solche, die
bei der baulichen Verwertung der beanspruchten
Gebiete wieder verschwinden müssen. Erst neuer-
dings ist man dazu übergegangen, dauernde An-
lagen zu schaffen. Auch für das eingemeindete
Sandhofen waren Kleingärten anzulegen. Sand-
hofen ist ein Vorort mit Land- und Arbeiterbevöl-
kerung; insbesondere die Arbeiterbevölkerung
drängte auf Bereitstellung von Gelände für Klein-
gärten. Sandhofen liegt etwa 1 km vom Rhein-
strom und Altrhein entfernt; der Altrhein fließt
westlich von Sandhofen in den Rhein. Nach dem
Bauklassen- und Bauviertelplane der Bauord-
nung ist das Gelände am Altrhein für die Nieder-
lassung von Fabriken vorgesehen.
Es lag daher sehr nahe, zwischen dem künf-
tigenlndustriegebiet und der Ortssiedelung Sand-
hofen als Puffer eine Grünanlage zu planen.
Hierzu eignete sich das Gelände insofern, als es
nicht hochwasserfrei liegt und deshalb bei bau-
licher Verwertung beträchtliche Kosten durch Erd-
aufschüttungen entstanden wären; eine solche
Maßnahme wäre aber auch deshalb wirtschaft-
lich verfehlt gewesen, da im Osten und im Nor-
den von Sandhofen hochwasserfreies Gelände in
solchem Umfange vorhanden ist, daß jeder Be-
völkerungszuwachs auf Jahrhunderte beimäßigen
Erschließungskosten Unterkommen findet.
Der Grünstreifen zieht in einer Breite von etwa
250 m im Westen des Ortes vorbei. Die Klein-
gartenanlage ist in dem Teile vorgesehen, dessen
Mitte nur 400 m vom früheren Rathause und nur
200 m von den nächsten Gebäuden abliegt. Für die
Kleingartenkolonie geben zwei Spielwiesen die
gartenkünstlerische Achse. Um diese beiden
Spielwiesen führen Promenaden, auch sind die
Spielwiesen selbst durch eine solche getrennt.
An diese Promenaden, die gleichzeitig von den
Zuschauern der Spiele benutzt werden können,
schließen sich, durch Grünstreifen getrennt, dop-
pelte Reihen von Kleingärten, etwa 170 an der
Zahl, an. Der Zugang zu den Kleingärten er-
folgt von besonderen Wegen, die zwischen den
Kleingärten durchführen. Auf die Kleingärten
folgen weitere Promenadenwege. Grünstreifen
mit abwechselnder Bepflanzung umgeben die
ganze Anlage, die in der Nord-Süd-Richtung von
geplanten hochwasserfreien Straßen mit je dop-
pelten Baumreihen begrenzt wird. Die Höhen-
lage der einzelnen Teile ist aus dem Querschnitt
ersichtlich; die Kleingärten liegen 1 m über den
Spielwiesen, die Straßen 2, bezw. 3,5 m über den
Kleingärten. Bei dem Entwürfe der Anlage wurde
dem sozialen Charakter der Bevölkerung von
Sandhofen Rechnung getragen; große gartenbau-
künstlerische Motive sind deshalb nicht gewählt,
sondern die Aufgabe wurde in einfachen schlich-
ten Formen zu lösen versucht, zumal auch keine
70