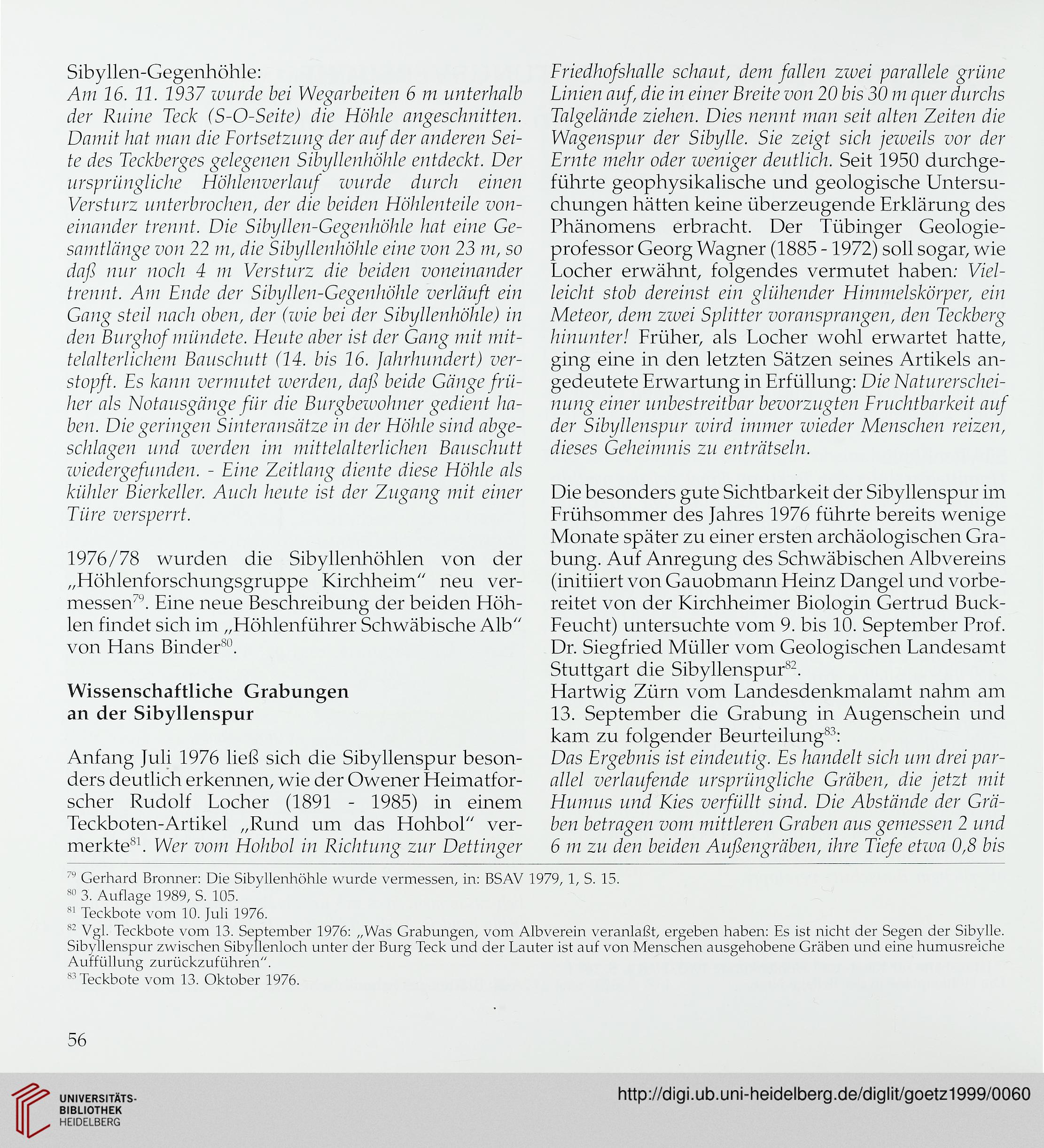Sibyllen-Gegenhöhle:
Am 16. 11. 1937 wurde bei Wegarbeiten 6 m unterhalb
der Ruine Teck (S-O-Seite) die Höhle angeschnitten.
Damit hat man die Fortsetzung der auf der anderen Sei-
te des Teckberges gelegenen Sibyllenhöhle entdeckt. Der
ursprüngliche Höhlenverlauf wurde durch einen
Versturz unterbrochen, der die beiden Höhlenteile von-
einander trennt. Die Sibyllen-Gegenhöhle hat eine Ge-
samtlänge von 22 m, die Sibyllenhöhle eine von 23 m, so
daß nur noch 4 m Versturz die beiden voneinander
trennt. Am Ende der Sibyllen-Gegenhöhle verläuft ein
Gang steil nach oben, der (wie bei der Sibyllenhöhle) in
den Burghof mündete. Heute aber ist der Gang mit mit-
telalterlichem Bauschutt (14. bis 16. Jahrhundert) ver-
stopft. Es kann vermutet werden, daß beide Gänge frü-
her als Notausgänge für die Burgbewohner gedient ha-
ben. Die geringen Sinteransätze in der Höhle sind abge-
schlagen und werden im mittelalterlichen Bauschutt
wiedergefunden. - Eine Zeitlang diente diese Höhle als
kühler Bierkeller. Auch heute ist der Zugang mit einer
Türe versperrt.
1976/78 wurden die Sibyllenhöhlen von der
„Höhlenforschungsgruppe Kirchheim" neu ver-
messen79. Eine neue Beschreibung der beiden Höh-
len findet sich im „Höhlenführer Schwäbische Alb"
von Hans Binder80.
Wissenschaftliche Grabungen
an der Sibyllenspur
Anfang Juli 1976 ließ sich die Sibyllenspur beson-
ders deutlich erkennen, wie der Owener Heimatfor-
scher Rudolf Locher (1891 - 1985) in einem
Teckboten-Artikel „Rund um das Hohbol" ver-
merkte81. Wer vom HoJibol in Richtung zur Dettinger
Friedhofshalle schaut, dem fallen zwei parallele grüne
Einien auf die in einer Breite von 20 bis 30 m quer durchs
Talgelände ziehen. Dies nennt man seit alten Zeiten die
Wagenspur der Sibylle. Sie zeigt sich jeweils vor der
Ernte mehr oder weniger deutlich. Seit 1950 durchge-
führte geophysikalische und geologische Untersu-
chungen hätten keine überzeugende Erklärung des
Phänomens erbracht. Der Tübinger Geologie-
professor Georg Wagner (1885 -1972) soll sogar, wie
Locher erwähnt, folgendes vermutet haben: Viel-
leicht stob dereinst ein glühender Himmelskörper, ein
Meteor, dem zwei Splitter voransprangen, den Teckberg
hinunter! Früher, als Locher wohl erwartet hatte,
ging eine in den letzten Sätzen seines Artikels an-
gedeutete Erwartung in Erfüllung: Die Naturerschei-
nung einer unbestreitbar bevorzugten Fruchtbarkeit auf
der Sibyllenspur wird immer wieder Menschen reizen,
dieses Geheimnis zu enträtseln.
Die besonders gute Sichtbarkeit der Sibyllenspur im
Frühsommer des Jahres 1976 führte bereits wenige
Monate später zu einer ersten archäologischen Gra-
bung. Auf Anregung des Schwäbischen Albvereins
(initiiert von Gauobmann Heinz Dangel und vorbe-
reitet von der Kirchheimer Biologin Gertrud Buck-
Feucht) untersuchte vom 9. bis 10. September Prof.
Dr. Siegfried Müller vom Geologischen Landesamt
Stuttgart die Sibyllenspur82.
Hartwig Zürn vom Landesdenkmalamt nahm am
13. September die Grabung in Augenschein und
kam zu folgender Beurteilung83:
Das Ergebnis ist eindeutig. Es handelt sich um drei par-
allel verlaufende ursprüngliche Gräben, die jetzt mit
Humus und Kies verfüllt sind. Die Abstände der Grä-
ben betragen vom mittleren Graben aus gemessen 2 und
6 m zu den beiden Außengräben, ihre Tiefe etwa 0,8 bis
79 Gerhard Bronner: Die Sibyllenhöhle wurde vermessen, in: BSAV 1979, 1, S. 15.
80 3. Auflage 1989, S. 105.
81 Teckbote vom 10. Juli 1976.
82 Vgl. Teckbote vom 13. September 1976: „Was Grabungen, vom Albverein veranlaßt, ergeben haben: Es ist nicht der Segen der Sibylle.
Sibyllenspur zwischen Sibyllenloch unter der Burg Teck und der Lauter ist auf von Menschen ausgehobene Gräben und eine humusreiche
Auffüllung zurückzuführen".
83 Teckbote vom 13. Oktober 1976.
56
Am 16. 11. 1937 wurde bei Wegarbeiten 6 m unterhalb
der Ruine Teck (S-O-Seite) die Höhle angeschnitten.
Damit hat man die Fortsetzung der auf der anderen Sei-
te des Teckberges gelegenen Sibyllenhöhle entdeckt. Der
ursprüngliche Höhlenverlauf wurde durch einen
Versturz unterbrochen, der die beiden Höhlenteile von-
einander trennt. Die Sibyllen-Gegenhöhle hat eine Ge-
samtlänge von 22 m, die Sibyllenhöhle eine von 23 m, so
daß nur noch 4 m Versturz die beiden voneinander
trennt. Am Ende der Sibyllen-Gegenhöhle verläuft ein
Gang steil nach oben, der (wie bei der Sibyllenhöhle) in
den Burghof mündete. Heute aber ist der Gang mit mit-
telalterlichem Bauschutt (14. bis 16. Jahrhundert) ver-
stopft. Es kann vermutet werden, daß beide Gänge frü-
her als Notausgänge für die Burgbewohner gedient ha-
ben. Die geringen Sinteransätze in der Höhle sind abge-
schlagen und werden im mittelalterlichen Bauschutt
wiedergefunden. - Eine Zeitlang diente diese Höhle als
kühler Bierkeller. Auch heute ist der Zugang mit einer
Türe versperrt.
1976/78 wurden die Sibyllenhöhlen von der
„Höhlenforschungsgruppe Kirchheim" neu ver-
messen79. Eine neue Beschreibung der beiden Höh-
len findet sich im „Höhlenführer Schwäbische Alb"
von Hans Binder80.
Wissenschaftliche Grabungen
an der Sibyllenspur
Anfang Juli 1976 ließ sich die Sibyllenspur beson-
ders deutlich erkennen, wie der Owener Heimatfor-
scher Rudolf Locher (1891 - 1985) in einem
Teckboten-Artikel „Rund um das Hohbol" ver-
merkte81. Wer vom HoJibol in Richtung zur Dettinger
Friedhofshalle schaut, dem fallen zwei parallele grüne
Einien auf die in einer Breite von 20 bis 30 m quer durchs
Talgelände ziehen. Dies nennt man seit alten Zeiten die
Wagenspur der Sibylle. Sie zeigt sich jeweils vor der
Ernte mehr oder weniger deutlich. Seit 1950 durchge-
führte geophysikalische und geologische Untersu-
chungen hätten keine überzeugende Erklärung des
Phänomens erbracht. Der Tübinger Geologie-
professor Georg Wagner (1885 -1972) soll sogar, wie
Locher erwähnt, folgendes vermutet haben: Viel-
leicht stob dereinst ein glühender Himmelskörper, ein
Meteor, dem zwei Splitter voransprangen, den Teckberg
hinunter! Früher, als Locher wohl erwartet hatte,
ging eine in den letzten Sätzen seines Artikels an-
gedeutete Erwartung in Erfüllung: Die Naturerschei-
nung einer unbestreitbar bevorzugten Fruchtbarkeit auf
der Sibyllenspur wird immer wieder Menschen reizen,
dieses Geheimnis zu enträtseln.
Die besonders gute Sichtbarkeit der Sibyllenspur im
Frühsommer des Jahres 1976 führte bereits wenige
Monate später zu einer ersten archäologischen Gra-
bung. Auf Anregung des Schwäbischen Albvereins
(initiiert von Gauobmann Heinz Dangel und vorbe-
reitet von der Kirchheimer Biologin Gertrud Buck-
Feucht) untersuchte vom 9. bis 10. September Prof.
Dr. Siegfried Müller vom Geologischen Landesamt
Stuttgart die Sibyllenspur82.
Hartwig Zürn vom Landesdenkmalamt nahm am
13. September die Grabung in Augenschein und
kam zu folgender Beurteilung83:
Das Ergebnis ist eindeutig. Es handelt sich um drei par-
allel verlaufende ursprüngliche Gräben, die jetzt mit
Humus und Kies verfüllt sind. Die Abstände der Grä-
ben betragen vom mittleren Graben aus gemessen 2 und
6 m zu den beiden Außengräben, ihre Tiefe etwa 0,8 bis
79 Gerhard Bronner: Die Sibyllenhöhle wurde vermessen, in: BSAV 1979, 1, S. 15.
80 3. Auflage 1989, S. 105.
81 Teckbote vom 10. Juli 1976.
82 Vgl. Teckbote vom 13. September 1976: „Was Grabungen, vom Albverein veranlaßt, ergeben haben: Es ist nicht der Segen der Sibylle.
Sibyllenspur zwischen Sibyllenloch unter der Burg Teck und der Lauter ist auf von Menschen ausgehobene Gräben und eine humusreiche
Auffüllung zurückzuführen".
83 Teckbote vom 13. Oktober 1976.
56