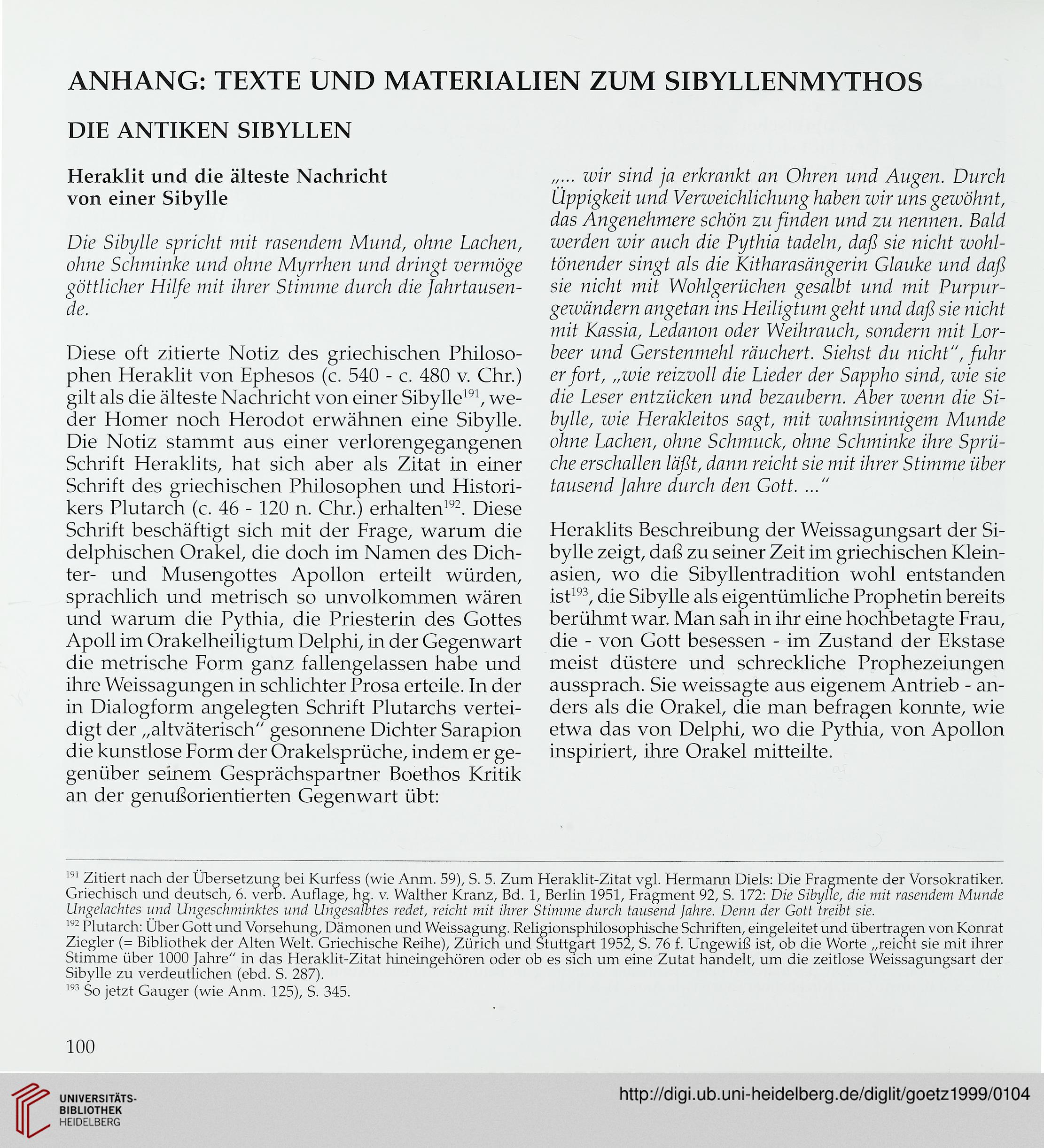ANHANG: TEXTE UND MATERIALIEN ZUM SIBYLLENMYTHOS
DIE ANTIKEN SIBYLLEN
Heraklit und die älteste Nachricht
von einer Sibylle
Die Sibylle spricht mit rasendem Mund, ohne Lachen,
ohne Schminke und ohne Myrrhen und dringt vermöge
göttlicher Hilfe mit Huer Stimme durch die Jahrtausen-
de.
Diese oft zitierte Notiz des griechischen Philoso-
phen Heraklit von Ephesos (c. 540 - c. 480 v. Chr.)
gilt als die älteste Nachricht von einer Sibylle191, we-
der Homer noch Herodot erwähnen eine Sibylle.
Die Notiz stammt aus einer verlorengegangenen
Schrift Heraklits, hat sich aber als Zitat in einer
Schrift des griechischen Philosophen und Histori-
kers Plutarch (c. 46 - 120 n. Chr.) erhalten192. Diese
Schrift beschäftigt sich mit der Frage, warum die
delphischen Orakel, die doch im Namen des Dich-
ter- und Musengottes Apollon erteilt würden,
sprachlich und metrisch so unvolkommen wären
und warum die Pythia, die Priesterin des Gottes
Apoll im Orakelheiligtum Delphi, in der Gegenwart
die metrische Form ganz fallengelassen habe und
ihre Weissagungen in schlichter Prosa erteile. In der
in Dialogform angelegten Schrift Plutarchs vertei-
digt der „altväterisch" gesonnene Dichter Sarapion
die kunstlose Form der Orakelsprüche, indem er ge-
genüber seinem Gesprächspartner Boethos Kritik
an der genußorientierten Gegenwart übt:
„... wir sind ja erkrankt an Ohren und Augen. Durch
Üppigkeit und Verweichlichung haben wir uns gewöhnt,
das Angenehmere schön zu finden und zu nennen. Bald
werden wir auch die Pythia tadeln, daß sie nicht wohl-
tönender singt als die Kitharasängerin Glauke und daß
sie nicht mit Wohlgerüchen gesalbt und mit Purpur-
gewändern angetan ins Heiligtum geht und daß sie nicht
mit Kassia, Ledanon oder Weihrauch, sondern mit Lor-
beer und Gerstenmehl räuchert. Siehst du nicht", fuhr
er fort, „wie reizvoll die Lieder der Sappho sind, wie sie
die Leser entzücken und bezaubern. Aber wenn die Si-
bylle, wie Herakleitos sagt, mit wahnsinnigem Munde
ohne Lachen, ohne Schmuck, ohne Schminke ihre Sprü-
che erschallen läßt, dann reicht sie mit ihrer Stimme über
tausend Jahre durch den Gott. ..."
Heraklits Beschreibung der Weissagungsart der Si-
bylle zeigt, daß zu seiner Zeit im griechischen Klein-
asien, wo die Sibyllentradition wohl entstanden
ist193, die Sibylle als eigentümliche Prophetin bereits
berühmt war. Man sah in ihr eine hochbetagte Frau,
die - von Gott besessen - im Zustand der Ekstase
meist düstere und schreckliche Prophezeiungen
aussprach. Sie weissagte aus eigenem Antrieb - an-
ders als die Orakel, die man befragen konnte, wie
etwa das von Delphi, wo die Pythia, von Apollon
inspiriert, ihre Orakel mitteilte.
191 Zitiert nach der Übersetzung bei Kurfess (wie Anm. 59), S. 5. Zum Heraklit-Zitat vgl. Hermann Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker.
Griechisch und deutsch, 6. verb. Auflage, hg. v. Walther Kranz, Bd. 1, Berlin 1951, Fragment 92, S. 172: Die Sibylle, die mit rasendem Munde
Ungelachtes und Ungeschminktes und Ungesalbtes redet, reicht mit ihrer Stimme durch tausend Jahre. Denn der Gott treibt sie.
192 Plutarch: Über Gott und Vorsehung, Dämonen und Weissagung. Religionsphilosophische Schriften, eingeleitet und übertragen von Konrat
Ziegler (= Bibliothek der Alten Welt. Griechische Reihe), Zürich und Stuttgart 1952, S. 76 f. Ungewiß ist, ob die Worte „reicht sie mit ihrer
Stimme über 1000 Jahre" in das Heraklit-Zitat hineingehören oder ob es sich um eine Zutat handelt, um die zeitlose Weissagungsart der
Sibylle zu verdeutlichen (ebd. S. 287).
193 So jetzt Gauger (wie Anm. 125), S. 345.
100
DIE ANTIKEN SIBYLLEN
Heraklit und die älteste Nachricht
von einer Sibylle
Die Sibylle spricht mit rasendem Mund, ohne Lachen,
ohne Schminke und ohne Myrrhen und dringt vermöge
göttlicher Hilfe mit Huer Stimme durch die Jahrtausen-
de.
Diese oft zitierte Notiz des griechischen Philoso-
phen Heraklit von Ephesos (c. 540 - c. 480 v. Chr.)
gilt als die älteste Nachricht von einer Sibylle191, we-
der Homer noch Herodot erwähnen eine Sibylle.
Die Notiz stammt aus einer verlorengegangenen
Schrift Heraklits, hat sich aber als Zitat in einer
Schrift des griechischen Philosophen und Histori-
kers Plutarch (c. 46 - 120 n. Chr.) erhalten192. Diese
Schrift beschäftigt sich mit der Frage, warum die
delphischen Orakel, die doch im Namen des Dich-
ter- und Musengottes Apollon erteilt würden,
sprachlich und metrisch so unvolkommen wären
und warum die Pythia, die Priesterin des Gottes
Apoll im Orakelheiligtum Delphi, in der Gegenwart
die metrische Form ganz fallengelassen habe und
ihre Weissagungen in schlichter Prosa erteile. In der
in Dialogform angelegten Schrift Plutarchs vertei-
digt der „altväterisch" gesonnene Dichter Sarapion
die kunstlose Form der Orakelsprüche, indem er ge-
genüber seinem Gesprächspartner Boethos Kritik
an der genußorientierten Gegenwart übt:
„... wir sind ja erkrankt an Ohren und Augen. Durch
Üppigkeit und Verweichlichung haben wir uns gewöhnt,
das Angenehmere schön zu finden und zu nennen. Bald
werden wir auch die Pythia tadeln, daß sie nicht wohl-
tönender singt als die Kitharasängerin Glauke und daß
sie nicht mit Wohlgerüchen gesalbt und mit Purpur-
gewändern angetan ins Heiligtum geht und daß sie nicht
mit Kassia, Ledanon oder Weihrauch, sondern mit Lor-
beer und Gerstenmehl räuchert. Siehst du nicht", fuhr
er fort, „wie reizvoll die Lieder der Sappho sind, wie sie
die Leser entzücken und bezaubern. Aber wenn die Si-
bylle, wie Herakleitos sagt, mit wahnsinnigem Munde
ohne Lachen, ohne Schmuck, ohne Schminke ihre Sprü-
che erschallen läßt, dann reicht sie mit ihrer Stimme über
tausend Jahre durch den Gott. ..."
Heraklits Beschreibung der Weissagungsart der Si-
bylle zeigt, daß zu seiner Zeit im griechischen Klein-
asien, wo die Sibyllentradition wohl entstanden
ist193, die Sibylle als eigentümliche Prophetin bereits
berühmt war. Man sah in ihr eine hochbetagte Frau,
die - von Gott besessen - im Zustand der Ekstase
meist düstere und schreckliche Prophezeiungen
aussprach. Sie weissagte aus eigenem Antrieb - an-
ders als die Orakel, die man befragen konnte, wie
etwa das von Delphi, wo die Pythia, von Apollon
inspiriert, ihre Orakel mitteilte.
191 Zitiert nach der Übersetzung bei Kurfess (wie Anm. 59), S. 5. Zum Heraklit-Zitat vgl. Hermann Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker.
Griechisch und deutsch, 6. verb. Auflage, hg. v. Walther Kranz, Bd. 1, Berlin 1951, Fragment 92, S. 172: Die Sibylle, die mit rasendem Munde
Ungelachtes und Ungeschminktes und Ungesalbtes redet, reicht mit ihrer Stimme durch tausend Jahre. Denn der Gott treibt sie.
192 Plutarch: Über Gott und Vorsehung, Dämonen und Weissagung. Religionsphilosophische Schriften, eingeleitet und übertragen von Konrat
Ziegler (= Bibliothek der Alten Welt. Griechische Reihe), Zürich und Stuttgart 1952, S. 76 f. Ungewiß ist, ob die Worte „reicht sie mit ihrer
Stimme über 1000 Jahre" in das Heraklit-Zitat hineingehören oder ob es sich um eine Zutat handelt, um die zeitlose Weissagungsart der
Sibylle zu verdeutlichen (ebd. S. 287).
193 So jetzt Gauger (wie Anm. 125), S. 345.
100