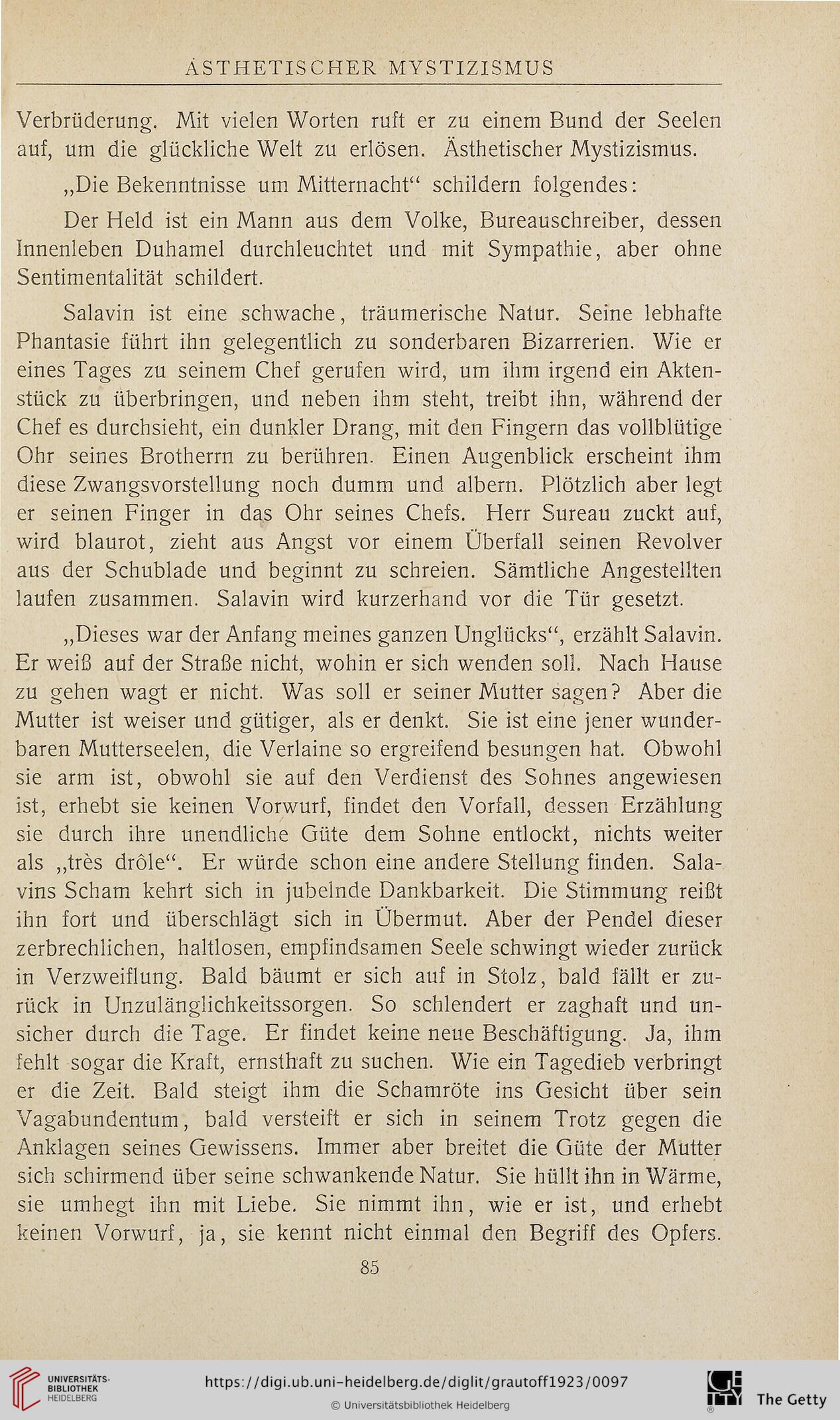ÄSTHETISCHER MYSTIZISMUS
Verbrüderung. Mit vielen Worten ruft er zu einem Bund der Seelen
auf, um die glückliche Welt zu erlösen. Ästhetischer Mystizismus.
„Die Bekenntnisse um Mitternacht“ schildern folgendes:
Der Held ist ein Mann aus dem Volke, Bureauschreiber, dessen
Innenleben Duhamel durchleuchtet und mit Sympathie, aber ohne
Sentimentalität schildert.
Salavin ist eine schwache, träumerische Natur. Seine lebhafte
Phantasie führt ihn gelegentlich zu sonderbaren Bizarrerien. Wie er
eines Tages zu seinem Chef gerufen wird, um ihm irgend ein Akten-
stück zu überbringen, und neben ihm steht, treibt ihn, während der
Chef es durchsieht, ein dunkler Drang, mit den Fingern das vollblütige
Ohr seines Brotherrn zu berühren. Einen Augenblick erscheint ihm
diese Zwangsvorstellung noch dumm und albern. Plötzlich aber legt
er seinen Finger in das Ohr seines Chefs. Herr Sureau zuckt auf,
wird blaurot, zieht aus Angst vor einem Überfall seinen Revolver
aus der Schublade und beginnt zu schreien. Sämtliche Angestellten
laufen zusammen. Salavin wird kurzerhand vor die Tür gesetzt.
„Dieses war der Anfang meines ganzen Unglücks“, erzählt Salavin.
Er weiß auf der Straße nicht, wohin er sich wenden soll. Nach Hause
zu gehen wagt er nicht. Was soll er seiner Mutter sagen? Aber die
Mutter ist weiser und gütiger, als er denkt. Sie ist eine jener wunder-
baren Mutterseelen, die Verlaine so ergreifend besungen hat. Obwohl
sie arm ist, obwohl sie auf den Verdienst des Sohnes angewiesen
ist, erhebt sie keinen Vorwurf, findet den Vorfall, dessen Erzählung
sie durch ihre unendliche Güte dem Sohne entlockt, nichts weiter
als „tres dröle“. Er würde schon eine andere Stellung finden. Sala-
vins Scham kehrt sich in jubelnde Dankbarkeit. Die Stimmung reißt
ihn fort und überschlägt sich in Übermut. Aber der Pendel dieser
zerbrechlichen, haltlosen, empfindsamen Seele schwingt wieder zurück
in Verzweiflung. Bald bäumt er sich auf in Stolz, bald fällt er zu-
rück in Unzulänglichkeitssorgen. So schlendert er zaghaft und un-
sicher durch die Tage. Er findet keine neue Beschäftigung. Ja, ihm
fehlt sogar die Kraft, ernsthaft zu suchen. Wie ein Tagedieb verbringt
er die Zeit. Bald steigt ihm die Schamröte ins Gesicht über sein
Vagabundentum, bald versteift er sich in seinem Trotz gegen die
Anklagen seines Gewissens. Immer aber breitet die Güte der Mutter
sich schirmend über seine schwankende Natur. Sie hüllt ihn in Wärme,
sie umhegt ihn mit Liebe. Sie nimmt ihn, wie er ist, und erhebt
keinen Vorwurf, ja, sie kennt nicht einmal den Begriff des Opfers.
85
Verbrüderung. Mit vielen Worten ruft er zu einem Bund der Seelen
auf, um die glückliche Welt zu erlösen. Ästhetischer Mystizismus.
„Die Bekenntnisse um Mitternacht“ schildern folgendes:
Der Held ist ein Mann aus dem Volke, Bureauschreiber, dessen
Innenleben Duhamel durchleuchtet und mit Sympathie, aber ohne
Sentimentalität schildert.
Salavin ist eine schwache, träumerische Natur. Seine lebhafte
Phantasie führt ihn gelegentlich zu sonderbaren Bizarrerien. Wie er
eines Tages zu seinem Chef gerufen wird, um ihm irgend ein Akten-
stück zu überbringen, und neben ihm steht, treibt ihn, während der
Chef es durchsieht, ein dunkler Drang, mit den Fingern das vollblütige
Ohr seines Brotherrn zu berühren. Einen Augenblick erscheint ihm
diese Zwangsvorstellung noch dumm und albern. Plötzlich aber legt
er seinen Finger in das Ohr seines Chefs. Herr Sureau zuckt auf,
wird blaurot, zieht aus Angst vor einem Überfall seinen Revolver
aus der Schublade und beginnt zu schreien. Sämtliche Angestellten
laufen zusammen. Salavin wird kurzerhand vor die Tür gesetzt.
„Dieses war der Anfang meines ganzen Unglücks“, erzählt Salavin.
Er weiß auf der Straße nicht, wohin er sich wenden soll. Nach Hause
zu gehen wagt er nicht. Was soll er seiner Mutter sagen? Aber die
Mutter ist weiser und gütiger, als er denkt. Sie ist eine jener wunder-
baren Mutterseelen, die Verlaine so ergreifend besungen hat. Obwohl
sie arm ist, obwohl sie auf den Verdienst des Sohnes angewiesen
ist, erhebt sie keinen Vorwurf, findet den Vorfall, dessen Erzählung
sie durch ihre unendliche Güte dem Sohne entlockt, nichts weiter
als „tres dröle“. Er würde schon eine andere Stellung finden. Sala-
vins Scham kehrt sich in jubelnde Dankbarkeit. Die Stimmung reißt
ihn fort und überschlägt sich in Übermut. Aber der Pendel dieser
zerbrechlichen, haltlosen, empfindsamen Seele schwingt wieder zurück
in Verzweiflung. Bald bäumt er sich auf in Stolz, bald fällt er zu-
rück in Unzulänglichkeitssorgen. So schlendert er zaghaft und un-
sicher durch die Tage. Er findet keine neue Beschäftigung. Ja, ihm
fehlt sogar die Kraft, ernsthaft zu suchen. Wie ein Tagedieb verbringt
er die Zeit. Bald steigt ihm die Schamröte ins Gesicht über sein
Vagabundentum, bald versteift er sich in seinem Trotz gegen die
Anklagen seines Gewissens. Immer aber breitet die Güte der Mutter
sich schirmend über seine schwankende Natur. Sie hüllt ihn in Wärme,
sie umhegt ihn mit Liebe. Sie nimmt ihn, wie er ist, und erhebt
keinen Vorwurf, ja, sie kennt nicht einmal den Begriff des Opfers.
85