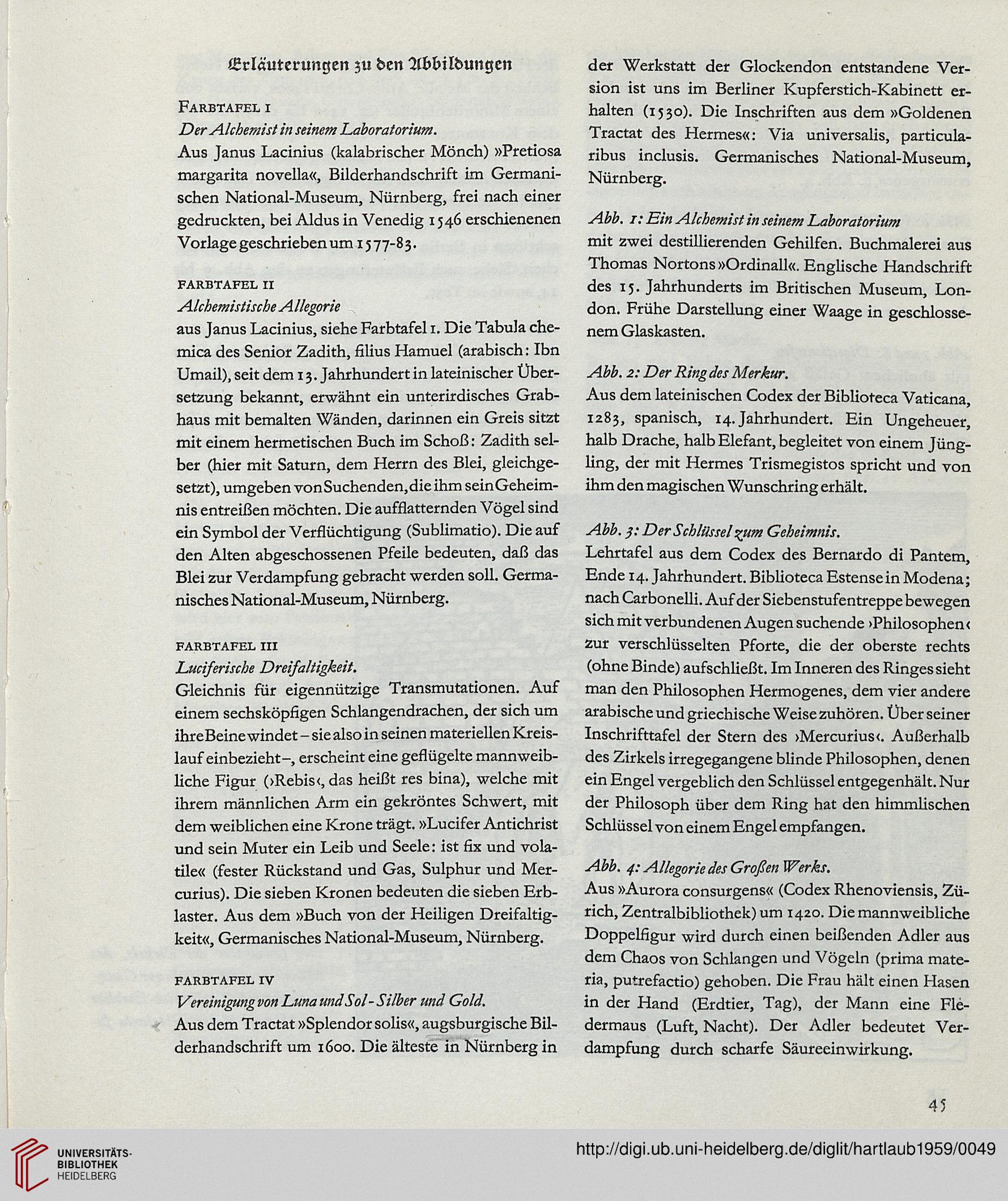/-Erläuterungen ;u ben Kbbüc-ungen
Farbtafeli
Der Alchemist in seinem Laboratorium.
Aus Janus Lacinius (kalabrischer Mönch) »Pretiosa
margarita novella«, Bilderhandschrift im Germani-
schen National-Museum, Nürnberg, frei nach einer
gedruckten, bei Aldus in Venedig 1546 erschienenen
Vorlage geschrieben um 1577-83.
farbtafel ii
Ahhemisiische Allegorie
aus Janus Lacinius, siehe Farbtafel 1. Die Tabula che-
mica des Senior Zadith, filius Hamuel (arabisch: Ibn
Umail), seit dem 13. Jahrhundert in lateinischer Uber-
setzung bekannt, erwähnt ein unterirdisches Grab-
haus mit bemalten Wänden, darinnen ein Greis sitzt
mit einem hermetischen Buch im Schoß: Zadith sel-
ber (hier mit Saturn, dem Herrn des Blei, gleichge-
setzt), umgeben vonSuchenden.die ihm sein Geheim-
nis entreißen möchten. Die aufflatternden Vögel sind
ein Symbol der Verflüchtigung (Sublimatio). Die auf
den Alten abgeschossenen Pfeile bedeuten, daß das
Blei zur Verdampfung gebracht werden soll. Germa-
nisches National-Museum, Nürnberg.
farbtafel iii
Luciferiscbe Dreifaltigkeit.
Gleichnis für eigennützige Transmutationen. Auf
einem sechsköpfigen Schlangendrachen, der sich um
ihreBeine windet - sie also in seinen materiellen Kreis-
lauf einbezieht-, erscheint eine geflügelte mannweib-
liche Figur (>Rebis<, das heißt res bina), welche mit
ihrem männlichen Arm ein gekröntes Schwert, mit
dem weiblichen eine Krone trägt. »Lucifer Antichrist
und sein Muter ein Leib und Seele: ist fix und vola-
tile« (fester Rückstand und Gas, Sulphur und Mer-
curius). Die sieben Kronen bedeuten die sieben Erb-
laster. Aus dem »Buch von der Heiligen Dreifaltig-
keit«, Germanisches National-Museum, Nürnberg.
farbtafel iv
Vereinigung von Luna und So! - Silber und Gold.
Aus dem Tractat »Splendor solis«, augsburgische Bil-
derhandschrift um 1600. Die älteste in Nürnberg in
der Werkstatt der Glockendon entstandene Ver-
sion ist uns im Berliner Kupferstich-Kabinett er-
halten (1530). Die Inschriften aus dem »Goldenen
Tractat des Hermes«: Via universalis, particula-
ribus inclusis. Germanisches National-Museum,
Nürnberg.
Abb. 1: Ein Alchemist in seinem Laboratorium
mit zwei destillierenden Gehilfen. Buchmalerei aus
Thomas Nortons »Ordinall«. Englische Handschrift
des 15. Jahrhunderts im Britischen Museum, Lon-
don. Frühe Darstellung einer Waage in geschlosse-
nem Glaskasten.
Abb. 2: Der Ring des Merkur.
Aus dem lateinischen Codex der Biblioteca Vaticana,
1283, spanisch, 14. Jahrhundert. Ein Ungeheuer,
halb Drache, halb Elefant, begleitet von einem Jüng-
ling, der mit Hermes Trismegistos spricht und von
ihm den magischen Wunschring erhält.
Abb.}: Der Schlüssel\um Geheimnis.
Lehrtafel aus dem Codex des Bernardo di Pantem,
Ende 14. Jahrhundert. Biblioteca Estense in Modena;
nach Carbonelli. Auf der Siebenstufentreppe bewegen
sich mit verbundenen Augen suchende Philosophen <
zur verschlüsselten Pforte, die der oberste rechts
(ohne Binde) aufschließt. Im Inneren des Ringes sieht
man den Philosophen Hermogenes, dem vier andere
arabische und griechische Weise zuhören. Uber seiner
Inschrifttafel der Stern des >Mercurius<. Außerhalb
des Zirkels irregegangene blinde Philosophen, denen
ein Engel vergeblich den Schlüssel entgegenhält. Nur
der Philosoph über dem Ring hat den himmlischen
Schlüssel von einem Engel empfangen.
Abb. 4: Allegorie des Großen Werks.
Aus »Aurora consurgens« (Codex Rhenoviensis, Zü-
rich, Zentralbibliothek) um 1420. Die mannweibliche
Doppelfigur wird durch einen beißenden Adler aus
dem Chaos von Schlangen und Vögeln (prima mate-
ria, putrefactio) gehoben. Die Frau hält einen Hasen
in der Hand (Erdtier, Tag), der Mann eine Fle-
dermaus (Luft, Nacht). Der Adler bedeutet Ver-
dampfung durch scharfe Säureeinwirkung.
45
Farbtafeli
Der Alchemist in seinem Laboratorium.
Aus Janus Lacinius (kalabrischer Mönch) »Pretiosa
margarita novella«, Bilderhandschrift im Germani-
schen National-Museum, Nürnberg, frei nach einer
gedruckten, bei Aldus in Venedig 1546 erschienenen
Vorlage geschrieben um 1577-83.
farbtafel ii
Ahhemisiische Allegorie
aus Janus Lacinius, siehe Farbtafel 1. Die Tabula che-
mica des Senior Zadith, filius Hamuel (arabisch: Ibn
Umail), seit dem 13. Jahrhundert in lateinischer Uber-
setzung bekannt, erwähnt ein unterirdisches Grab-
haus mit bemalten Wänden, darinnen ein Greis sitzt
mit einem hermetischen Buch im Schoß: Zadith sel-
ber (hier mit Saturn, dem Herrn des Blei, gleichge-
setzt), umgeben vonSuchenden.die ihm sein Geheim-
nis entreißen möchten. Die aufflatternden Vögel sind
ein Symbol der Verflüchtigung (Sublimatio). Die auf
den Alten abgeschossenen Pfeile bedeuten, daß das
Blei zur Verdampfung gebracht werden soll. Germa-
nisches National-Museum, Nürnberg.
farbtafel iii
Luciferiscbe Dreifaltigkeit.
Gleichnis für eigennützige Transmutationen. Auf
einem sechsköpfigen Schlangendrachen, der sich um
ihreBeine windet - sie also in seinen materiellen Kreis-
lauf einbezieht-, erscheint eine geflügelte mannweib-
liche Figur (>Rebis<, das heißt res bina), welche mit
ihrem männlichen Arm ein gekröntes Schwert, mit
dem weiblichen eine Krone trägt. »Lucifer Antichrist
und sein Muter ein Leib und Seele: ist fix und vola-
tile« (fester Rückstand und Gas, Sulphur und Mer-
curius). Die sieben Kronen bedeuten die sieben Erb-
laster. Aus dem »Buch von der Heiligen Dreifaltig-
keit«, Germanisches National-Museum, Nürnberg.
farbtafel iv
Vereinigung von Luna und So! - Silber und Gold.
Aus dem Tractat »Splendor solis«, augsburgische Bil-
derhandschrift um 1600. Die älteste in Nürnberg in
der Werkstatt der Glockendon entstandene Ver-
sion ist uns im Berliner Kupferstich-Kabinett er-
halten (1530). Die Inschriften aus dem »Goldenen
Tractat des Hermes«: Via universalis, particula-
ribus inclusis. Germanisches National-Museum,
Nürnberg.
Abb. 1: Ein Alchemist in seinem Laboratorium
mit zwei destillierenden Gehilfen. Buchmalerei aus
Thomas Nortons »Ordinall«. Englische Handschrift
des 15. Jahrhunderts im Britischen Museum, Lon-
don. Frühe Darstellung einer Waage in geschlosse-
nem Glaskasten.
Abb. 2: Der Ring des Merkur.
Aus dem lateinischen Codex der Biblioteca Vaticana,
1283, spanisch, 14. Jahrhundert. Ein Ungeheuer,
halb Drache, halb Elefant, begleitet von einem Jüng-
ling, der mit Hermes Trismegistos spricht und von
ihm den magischen Wunschring erhält.
Abb.}: Der Schlüssel\um Geheimnis.
Lehrtafel aus dem Codex des Bernardo di Pantem,
Ende 14. Jahrhundert. Biblioteca Estense in Modena;
nach Carbonelli. Auf der Siebenstufentreppe bewegen
sich mit verbundenen Augen suchende Philosophen <
zur verschlüsselten Pforte, die der oberste rechts
(ohne Binde) aufschließt. Im Inneren des Ringes sieht
man den Philosophen Hermogenes, dem vier andere
arabische und griechische Weise zuhören. Uber seiner
Inschrifttafel der Stern des >Mercurius<. Außerhalb
des Zirkels irregegangene blinde Philosophen, denen
ein Engel vergeblich den Schlüssel entgegenhält. Nur
der Philosoph über dem Ring hat den himmlischen
Schlüssel von einem Engel empfangen.
Abb. 4: Allegorie des Großen Werks.
Aus »Aurora consurgens« (Codex Rhenoviensis, Zü-
rich, Zentralbibliothek) um 1420. Die mannweibliche
Doppelfigur wird durch einen beißenden Adler aus
dem Chaos von Schlangen und Vögeln (prima mate-
ria, putrefactio) gehoben. Die Frau hält einen Hasen
in der Hand (Erdtier, Tag), der Mann eine Fle-
dermaus (Luft, Nacht). Der Adler bedeutet Ver-
dampfung durch scharfe Säureeinwirkung.
45