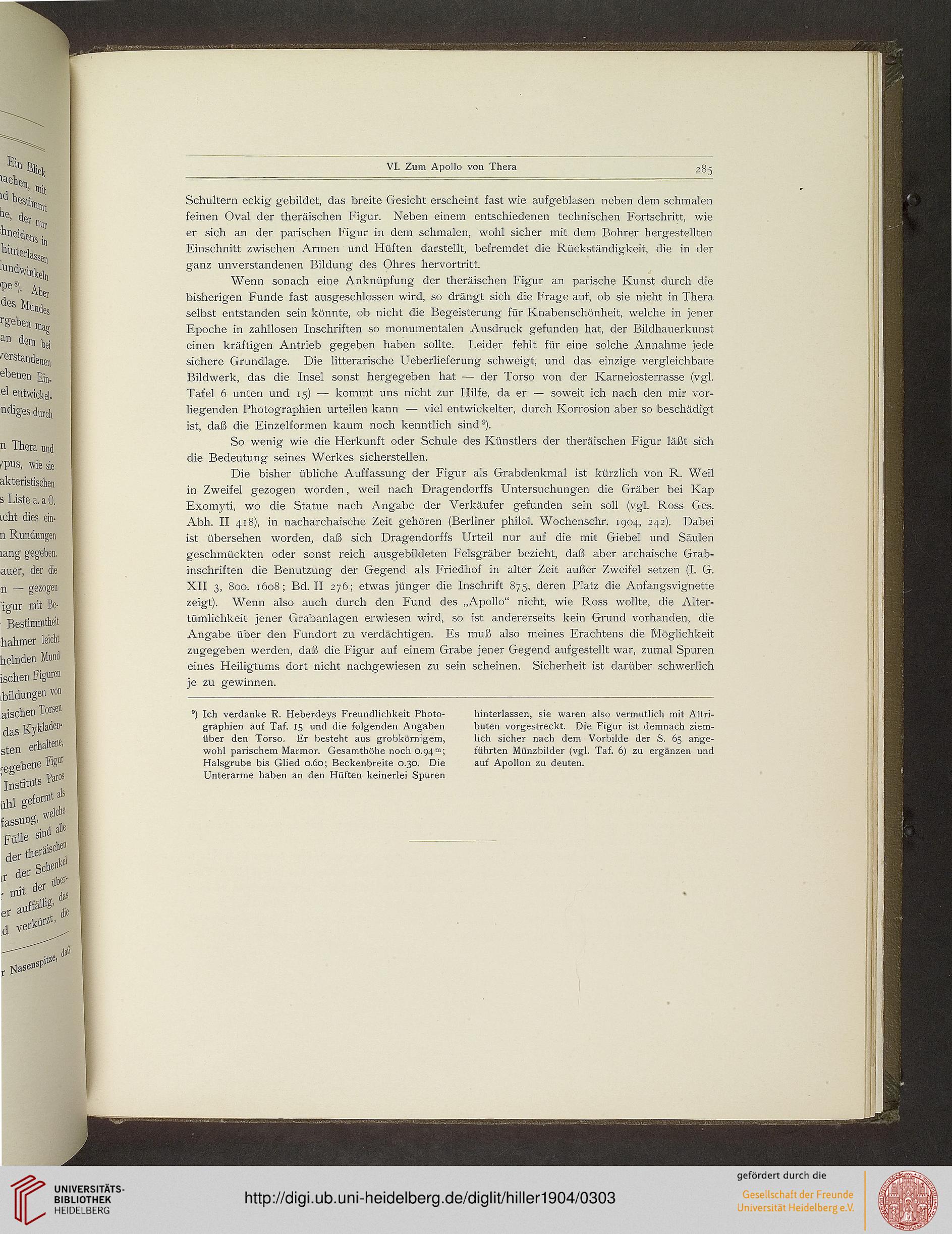Ein Blick
'pe8)- Aber
des Mund^
rSebe« n^
an dem bei
erstandenen
ebenen Ein-
el entwickel.
ndiges durch
n Thera und
/pus, wie sie
akteristischen
ä Liste a. a 0.
icht dies ein-
n Rundungen
lang gegeben,
auer, der die
n — gezogen
'igur mit Be-
Bestimmtheit
hahmer leicht
helnden Mund
ischen Figuren
bildungen von
aischenTorsen
das Kykladen-
sten erhaltene
regebene J
Instituts ■
übl *****
fassung,^'
Fülle sind'
der Schenk'
* der **
- mit off ^
er **"* ?
d veri^'
VI. Zum Apollo von Thera
285
Schultern eckig gebildet, das breite Gesicht erscheint fast wie aufgeblasen neben dem schmalen
feinen Oval der theräischen Figur. Neben einem entschiedenen technischen Fortschritt, wie
er sich an der parischen Figur in dem schmalen, wohl sicher mit dem Bohrer hergestellten
Einschnitt zwischen Armen und Hüften darstellt, befremdet die Rückständigkeit, die in der
ganz unverstandenen Bildung des Ohres hervortritt.
Wenn sonach eine Anknüpfung der theräischen Figur an pansche Kunst durch die
bisherigen Funde fast ausgeschlossen wird, so drängt sich die Frage auf, ob sie nicht in Thera
selbst entstanden sein könnte, ob nicht die Begeisterung für Knabenschönheit, welche in jener
Epoche in zahllosen Inschriften so monumentalen Ausdruck gefunden hat, der Bildhauerkunst
einen kräftigen Antrieb gegeben haben sollte. Leider fehlt für eine solche Annahme jede
sichere Grundlage. Die litterarische Ueberlieferung schweigt, und das einzige vergleichbare
Bildwerk, das die Insel sonst hergegeben hat — der Torso von der Karneiosterrasse (vgl.
Tafel 6 unten und 15) — kommt uns nicht zur Hilfe, da er — soweit ich nach den mir vor-
liegenden Photographien urteilen kann — viel entwickelter, durch Korrosion aber so beschädigt
ist, daß die Einzelformen kaum noch kenntlich sind9).
So wenig wie die Herkunft oder Schule des Künstlers der theräischen Figur läßt sich
die Bedeutung seines Werkes sicherstellen.
Die bisher übliche Auffassung der Figur als Grabdenkmal ist kürzlich von R. Weil
in Zweifel gezogen worden, weil nach Dragendorffs Untersuchungen die Gräber bei Kap
Exomyti, wo die Statue nach Angabe der Verkäufer gefunden sein soll (vgl. Ross Ges.
Abh. II 418), in nacharchaische Zeit gehören (Berliner philol. Wochenschr. 1904, 242). Dabei
ist übersehen worden, daß sich Dragendorffs Urteil nur auf die mit Giebel und Säulen
geschmückten oder sonst reich ausgebildeten Felsgräber bezieht, daß aber archaische Grab-
inschriften die Benutzung der Gegend als Friedhof in alter Zeit außer Zweifel setzen (I. G.
XII 3, 800. 1608; Bd. II 276; etwas jünger die Inschrift 875, deren Platz die Anfangsvignette
zeigt). Wenn also auch durch den Fund des „Apollo" nicht, wie Ross wollte, die Alter-
tümlichkeit jener Grabanlagen erwiesen wird, so ist andererseits kein Grund vorhanden, die
Angabe über den Fundort zu verdächtigen. Es muß also meines Erachtens die Möglichkeit
zugegeben werden, daß die Figur auf einem Grabe jener Gegend aufgestellt war, zumal Spuren
eines Heiligtums dort nicht nachgewiesen zu sein scheinen. Sicherheit ist darüber schwerlich
je zu gewinnen.
9) Ich verdanke R. Heberdeys Freundlichkeit Photo-
graphien auf Taf. 15 und die folgenden Angaben
über den Torso. Er besteht aus grobkörnigem,
wohl parischem Marmor. Gesamthöhe noch 0.94™;
Halsgrube bis Glied 0.60; Beckenbreite 0.30. Die
Unterarme haben an den Hüften keinerlei Spuren
hinterlassen, sie waren also vermutlich mit Attri-
buten vorgestreckt. Die Figur ist demnach ziem-
lich sicher nach dem Vorbilde der S. 65 ange-
führten Münzbilder (vgl. Taf. 6) zu ergänzen und
auf Apollon zu deuten.
r Nase:
'pe8)- Aber
des Mund^
rSebe« n^
an dem bei
erstandenen
ebenen Ein-
el entwickel.
ndiges durch
n Thera und
/pus, wie sie
akteristischen
ä Liste a. a 0.
icht dies ein-
n Rundungen
lang gegeben,
auer, der die
n — gezogen
'igur mit Be-
Bestimmtheit
hahmer leicht
helnden Mund
ischen Figuren
bildungen von
aischenTorsen
das Kykladen-
sten erhaltene
regebene J
Instituts ■
übl *****
fassung,^'
Fülle sind'
der Schenk'
* der **
- mit off ^
er **"* ?
d veri^'
VI. Zum Apollo von Thera
285
Schultern eckig gebildet, das breite Gesicht erscheint fast wie aufgeblasen neben dem schmalen
feinen Oval der theräischen Figur. Neben einem entschiedenen technischen Fortschritt, wie
er sich an der parischen Figur in dem schmalen, wohl sicher mit dem Bohrer hergestellten
Einschnitt zwischen Armen und Hüften darstellt, befremdet die Rückständigkeit, die in der
ganz unverstandenen Bildung des Ohres hervortritt.
Wenn sonach eine Anknüpfung der theräischen Figur an pansche Kunst durch die
bisherigen Funde fast ausgeschlossen wird, so drängt sich die Frage auf, ob sie nicht in Thera
selbst entstanden sein könnte, ob nicht die Begeisterung für Knabenschönheit, welche in jener
Epoche in zahllosen Inschriften so monumentalen Ausdruck gefunden hat, der Bildhauerkunst
einen kräftigen Antrieb gegeben haben sollte. Leider fehlt für eine solche Annahme jede
sichere Grundlage. Die litterarische Ueberlieferung schweigt, und das einzige vergleichbare
Bildwerk, das die Insel sonst hergegeben hat — der Torso von der Karneiosterrasse (vgl.
Tafel 6 unten und 15) — kommt uns nicht zur Hilfe, da er — soweit ich nach den mir vor-
liegenden Photographien urteilen kann — viel entwickelter, durch Korrosion aber so beschädigt
ist, daß die Einzelformen kaum noch kenntlich sind9).
So wenig wie die Herkunft oder Schule des Künstlers der theräischen Figur läßt sich
die Bedeutung seines Werkes sicherstellen.
Die bisher übliche Auffassung der Figur als Grabdenkmal ist kürzlich von R. Weil
in Zweifel gezogen worden, weil nach Dragendorffs Untersuchungen die Gräber bei Kap
Exomyti, wo die Statue nach Angabe der Verkäufer gefunden sein soll (vgl. Ross Ges.
Abh. II 418), in nacharchaische Zeit gehören (Berliner philol. Wochenschr. 1904, 242). Dabei
ist übersehen worden, daß sich Dragendorffs Urteil nur auf die mit Giebel und Säulen
geschmückten oder sonst reich ausgebildeten Felsgräber bezieht, daß aber archaische Grab-
inschriften die Benutzung der Gegend als Friedhof in alter Zeit außer Zweifel setzen (I. G.
XII 3, 800. 1608; Bd. II 276; etwas jünger die Inschrift 875, deren Platz die Anfangsvignette
zeigt). Wenn also auch durch den Fund des „Apollo" nicht, wie Ross wollte, die Alter-
tümlichkeit jener Grabanlagen erwiesen wird, so ist andererseits kein Grund vorhanden, die
Angabe über den Fundort zu verdächtigen. Es muß also meines Erachtens die Möglichkeit
zugegeben werden, daß die Figur auf einem Grabe jener Gegend aufgestellt war, zumal Spuren
eines Heiligtums dort nicht nachgewiesen zu sein scheinen. Sicherheit ist darüber schwerlich
je zu gewinnen.
9) Ich verdanke R. Heberdeys Freundlichkeit Photo-
graphien auf Taf. 15 und die folgenden Angaben
über den Torso. Er besteht aus grobkörnigem,
wohl parischem Marmor. Gesamthöhe noch 0.94™;
Halsgrube bis Glied 0.60; Beckenbreite 0.30. Die
Unterarme haben an den Hüften keinerlei Spuren
hinterlassen, sie waren also vermutlich mit Attri-
buten vorgestreckt. Die Figur ist demnach ziem-
lich sicher nach dem Vorbilde der S. 65 ange-
führten Münzbilder (vgl. Taf. 6) zu ergänzen und
auf Apollon zu deuten.
r Nase: