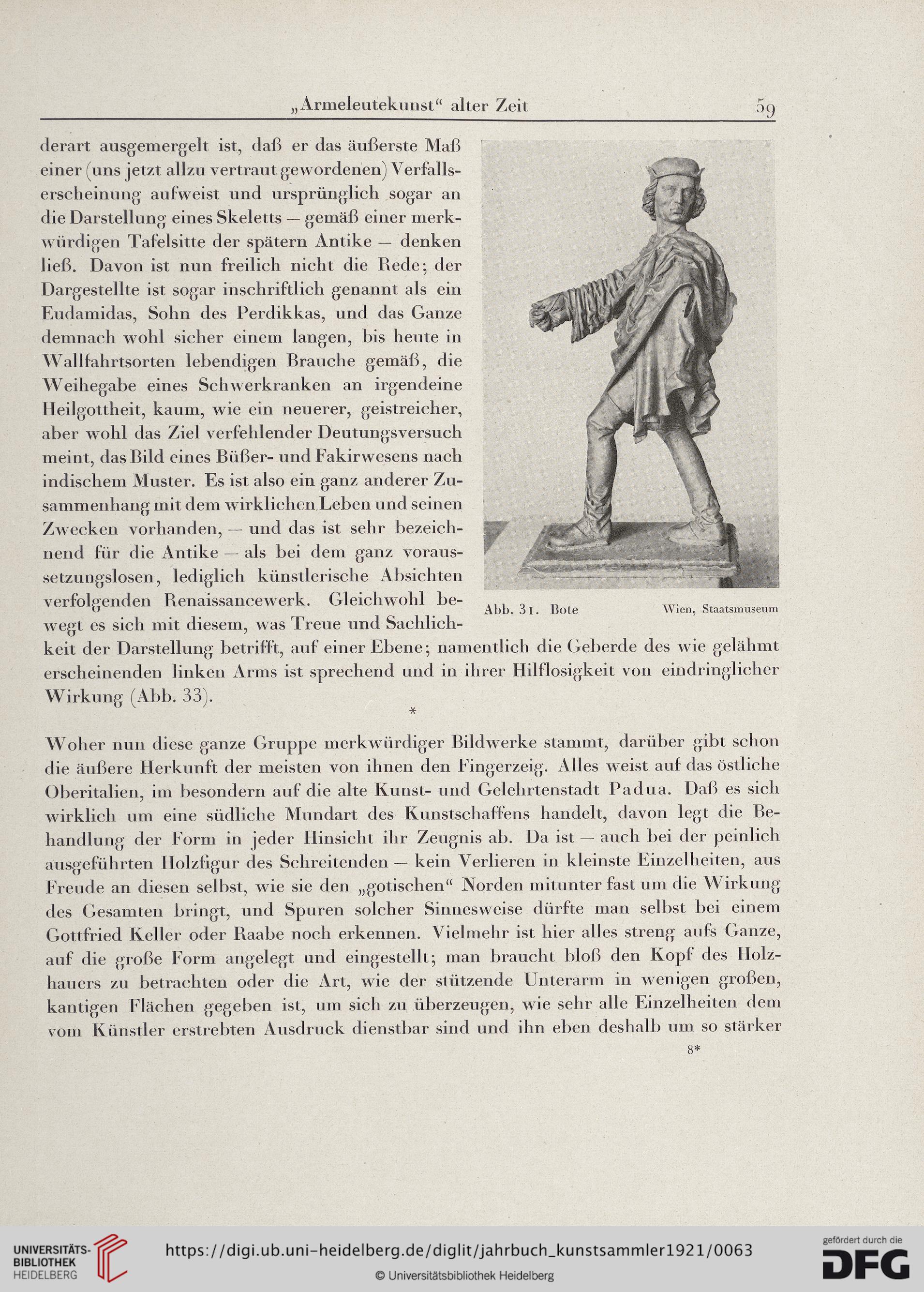„Armeleutekunst“ aller Zeit
derart ausgemergelt ist, daß er das äußerste Maß
einer (uns jetzt allzu vertraut gewordenen) Verfalls¬
erscheinung aufweist und ursprünglich sogar an
die Darstellung eines Skeletts — gemäß einer merk¬
würdigen Tafelsitte der spätem Antike — denken
ließ. Davon ist nun freilich nicht die Rede; der
Dargestellte ist sogar inschriftlicli genannt als ein
Eudamidas, Sohn des Perdikkas, und das Ganze
demnach wohl sicher einem langen, bis heute in
Wallfahrtsorten lebendigen Brauche gemäß, die
Weihegabe eines Schwerkranken an irgendeine
Heiigottheit, kaum, wie ein neuerer, geistreicher,
aber wohl das Ziel verfehlender Deutungsversuch
meint, das Bild eines Büßer- und Fakirwesens nach
indischem Muster. Es ist also ein ganz anderer Zu¬
sammenhang mit dem wirklichen Leben und seinen
Zwecken vorhanden, — und das ist sehr bezeich¬
nend für die Antike — als bei dem ganz voraus¬
setzungslosen, lediglich künstlerische Absichten
verfolgenden Renaissancewerk. Gleichwohl be¬
wegt es sich mit diesem, was Treue und Sachlich-
keit der Darstellung betrifft, auf einer Ebene; namentlich die Geberde des wie gelähmt
erscheinenden linken Arms ist sprechend und in ihrer Hilflosigkeit von eindringlicher
Wirkung (Abb. 33).
*
Woher nun diese ganze Gruppe merkwürdiger Bildwerke stammt, darüber gibt schon
die äußere Herkunft der meisten von ihnen den Fingerzeig. Alles weist auf das östliche
Oberitalien, im besondern auf die alte Kunst- und Gelehrtenstadt Padua. Daß es sich
wirklich um eine südliche Mundart des Kunstschaffens handelt, davon legt die Be-
handlung der Form in jeder Hinsicht ihr Zeugnis ab. Da ist — auch bei der peinlich
ausgeführten Holzfigur des Schreitenden — kein Verlieren in kleinste Einzelheiten, aus
Freude an diesen selbst, wie sie den „gotischen“ Norden mitunter fast um die Wirkung
des Gesamten bringt, und Spuren solcher Sinnesweise dürfte man selbst bei einem
Gottfried Keller oder Raabe noch erkennen. Vielmehr ist hier alles streng aufs Ganze,
auf die große Form angelegt und eingestellt; man braucht bloß den Kopf des Holz-
hauers zu betrachten oder die Art, wie der stützende Unterarm in wenigen großen,
kantigen Flächen gegeben ist, um sich zu überzeugen, wie sehr alle Einzelheiten dem
vom Künstler erstrebten Ausdruck dienstbar sind und ihn eben deshalb um so stärker
8*
derart ausgemergelt ist, daß er das äußerste Maß
einer (uns jetzt allzu vertraut gewordenen) Verfalls¬
erscheinung aufweist und ursprünglich sogar an
die Darstellung eines Skeletts — gemäß einer merk¬
würdigen Tafelsitte der spätem Antike — denken
ließ. Davon ist nun freilich nicht die Rede; der
Dargestellte ist sogar inschriftlicli genannt als ein
Eudamidas, Sohn des Perdikkas, und das Ganze
demnach wohl sicher einem langen, bis heute in
Wallfahrtsorten lebendigen Brauche gemäß, die
Weihegabe eines Schwerkranken an irgendeine
Heiigottheit, kaum, wie ein neuerer, geistreicher,
aber wohl das Ziel verfehlender Deutungsversuch
meint, das Bild eines Büßer- und Fakirwesens nach
indischem Muster. Es ist also ein ganz anderer Zu¬
sammenhang mit dem wirklichen Leben und seinen
Zwecken vorhanden, — und das ist sehr bezeich¬
nend für die Antike — als bei dem ganz voraus¬
setzungslosen, lediglich künstlerische Absichten
verfolgenden Renaissancewerk. Gleichwohl be¬
wegt es sich mit diesem, was Treue und Sachlich-
keit der Darstellung betrifft, auf einer Ebene; namentlich die Geberde des wie gelähmt
erscheinenden linken Arms ist sprechend und in ihrer Hilflosigkeit von eindringlicher
Wirkung (Abb. 33).
*
Woher nun diese ganze Gruppe merkwürdiger Bildwerke stammt, darüber gibt schon
die äußere Herkunft der meisten von ihnen den Fingerzeig. Alles weist auf das östliche
Oberitalien, im besondern auf die alte Kunst- und Gelehrtenstadt Padua. Daß es sich
wirklich um eine südliche Mundart des Kunstschaffens handelt, davon legt die Be-
handlung der Form in jeder Hinsicht ihr Zeugnis ab. Da ist — auch bei der peinlich
ausgeführten Holzfigur des Schreitenden — kein Verlieren in kleinste Einzelheiten, aus
Freude an diesen selbst, wie sie den „gotischen“ Norden mitunter fast um die Wirkung
des Gesamten bringt, und Spuren solcher Sinnesweise dürfte man selbst bei einem
Gottfried Keller oder Raabe noch erkennen. Vielmehr ist hier alles streng aufs Ganze,
auf die große Form angelegt und eingestellt; man braucht bloß den Kopf des Holz-
hauers zu betrachten oder die Art, wie der stützende Unterarm in wenigen großen,
kantigen Flächen gegeben ist, um sich zu überzeugen, wie sehr alle Einzelheiten dem
vom Künstler erstrebten Ausdruck dienstbar sind und ihn eben deshalb um so stärker
8*