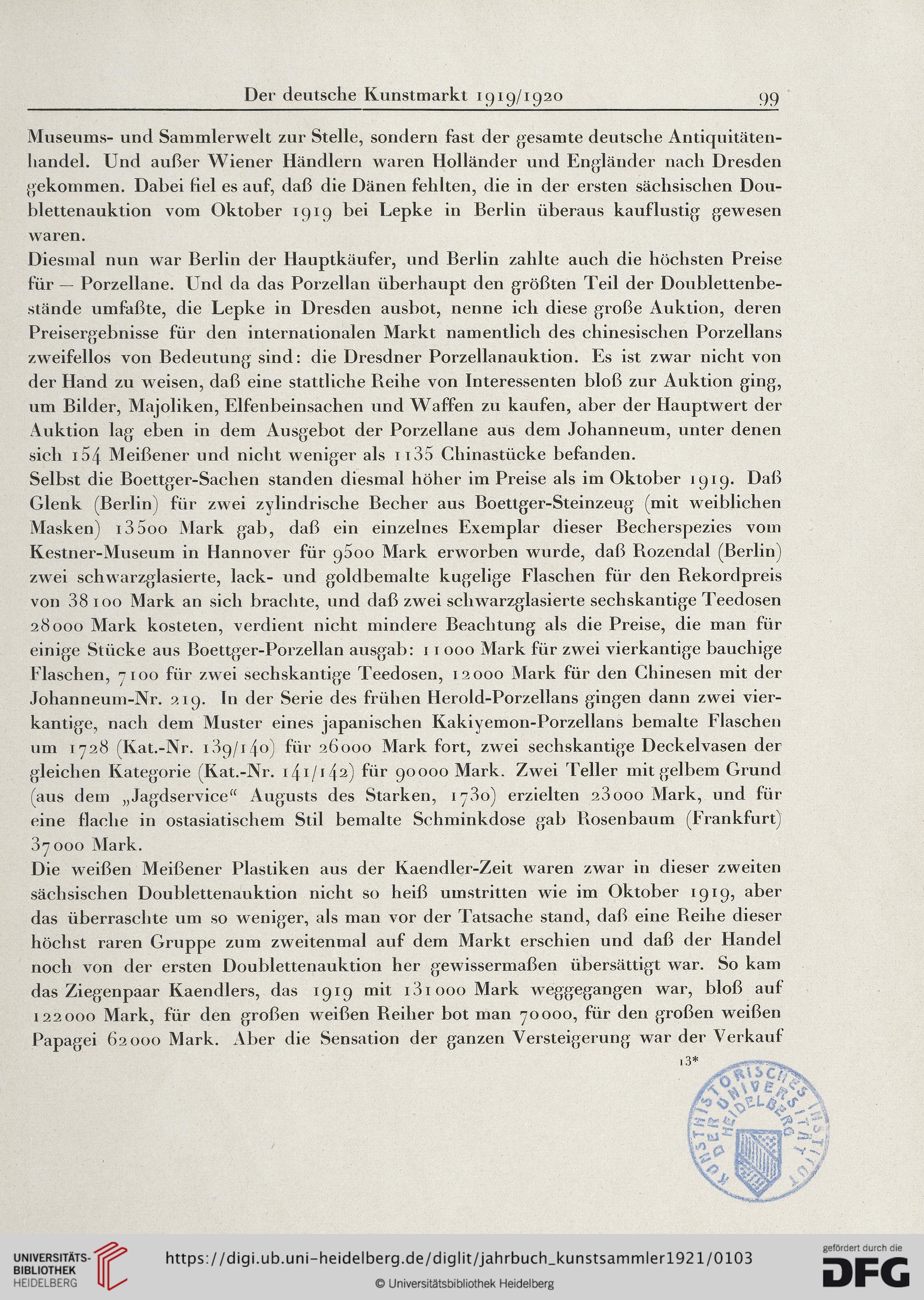Der deutsche Kunstmarkt 1919/1920
99
Museums- und Sammlerwelt zur Stelle, sondern fast der gesamte deutsche Antiquitäten-
handel. Und außer Wiener Händlern waren Holländer und Engländer nach Dresden
gekommen. Dabei fiel es auf, daß die Dänen fehlten, die in der ersten sächsischen Dou-
blettenauktion vom Oktober 1919 bei Lepke in Berlin überaus kauflustig gewesen
waren.
Diesmal nun war Berlin der Hauptkäufer, und Berlin zahlte auch die höchsten Preise
für — Porzellane. Und da das Porzellan überhaupt den größten Teil der Doublettenbe-
stände umfaßte, die Lepke in Dresden ausbot, nenne ich diese große Auktion, deren
Preisergebnisse für den internationalen Markt namentlich des chinesischen Porzellans
zweifellos von Bedeutung sind: die Dresdner Porzellanauktion. Es ist zwar nicht von
der Hand zu weisen, daß eine stattliche Beihe von Interessenten bloß zur Auktion ging,
um Bilder, Majoliken, Elfenbeinsachen und Waffen zu kaufen, aber der Hauptwert der
Auktion lag eben in dem Ausgebot der Porzellane aus dem Johanneum, unter denen
sich i54 Meißener und nicht weniger als it35 Chinastücke befanden.
Selbst die Boettger-Sachen standen diesmal höher im Preise als im Oktober 1919. Daß
Glenk (Berlin) für zwei zylindrische Becher aus Boettger-Steinzeug (mit weiblichen
Masken) i35oo Mark gab, daß ein einzelnes Exemplar dieser Becherspezies vom
Kestner-Museum in Hannover für 9000 Mark erworben wurde, daß Bozendal (Berlin)
zwei schwarzglasierte, lack- und goldbemalte kugelige Flaschen für den Rekordpreis
von 38 100 Mark an sich brachte, und daß zwei schwarzglasierte sechskantige Teedosen
28000 Mark kosteten, verdient nicht mindere Beachtung als die Preise, die man für
einige Stücke aus Boettger-Porzellan ausgab: 11 000 Mark für zwei vierkantige bauchige
Flaschen, 7100 für zwei sechskantige Teedosen, 12000 Mark für den Chinesen mit der
Johanneum-Nr. 219. In der Serie des frühen Herold-Porzellans gingen dann zwei vier-
kantige, nach dem Muster eines japanischen Kakiyemon-Porzellans bemalte Flaschen
um 1728 (Kat.-Nr. 189/140) für 26000 Mark fort, zwei sechskantige Deckelvasen der
gleichen Kategorie (Kat.-Nr. 141 /142) ^ur 90000 Mark. Zwei Teller mit gelbem Grund
(aus dem „Jagdservice“ Augusts des Starken, 1780) erzielten 28000 Mark, und für
eine flache in ostasiatischem Stil bemalte Schminkdose gab Rosenbaum (Frankfurt)
37000 Mark.
Die weißen Meißener Plastiken aus der Kaendler-Zeit waren zwar in dieser zweiten
sächsischen Doublettenauktion nicht so heiß umstritten wie im Oktober 1919, aber
das überraschte um so weniger, als man vor der Tatsache stand, daß eine Reihe dieser
höchst raren Gruppe zum zweitenmal auf dem Markt erschien und daß der Handel
noch von der ersten Doublettenauktion her gewissermaßen übersättigt war. So kam
das Ziegenpaar Kaendlers, das 1919 mit i3i 000 Mark weggegangen war, bloß auf
122000 Mark, für den großen weißen Reiher bot man 70000, für den großen weißen
Papagei 62000 Mark. Aber die Sensation der ganzen Versteigerung war der Verkauf
99
Museums- und Sammlerwelt zur Stelle, sondern fast der gesamte deutsche Antiquitäten-
handel. Und außer Wiener Händlern waren Holländer und Engländer nach Dresden
gekommen. Dabei fiel es auf, daß die Dänen fehlten, die in der ersten sächsischen Dou-
blettenauktion vom Oktober 1919 bei Lepke in Berlin überaus kauflustig gewesen
waren.
Diesmal nun war Berlin der Hauptkäufer, und Berlin zahlte auch die höchsten Preise
für — Porzellane. Und da das Porzellan überhaupt den größten Teil der Doublettenbe-
stände umfaßte, die Lepke in Dresden ausbot, nenne ich diese große Auktion, deren
Preisergebnisse für den internationalen Markt namentlich des chinesischen Porzellans
zweifellos von Bedeutung sind: die Dresdner Porzellanauktion. Es ist zwar nicht von
der Hand zu weisen, daß eine stattliche Beihe von Interessenten bloß zur Auktion ging,
um Bilder, Majoliken, Elfenbeinsachen und Waffen zu kaufen, aber der Hauptwert der
Auktion lag eben in dem Ausgebot der Porzellane aus dem Johanneum, unter denen
sich i54 Meißener und nicht weniger als it35 Chinastücke befanden.
Selbst die Boettger-Sachen standen diesmal höher im Preise als im Oktober 1919. Daß
Glenk (Berlin) für zwei zylindrische Becher aus Boettger-Steinzeug (mit weiblichen
Masken) i35oo Mark gab, daß ein einzelnes Exemplar dieser Becherspezies vom
Kestner-Museum in Hannover für 9000 Mark erworben wurde, daß Bozendal (Berlin)
zwei schwarzglasierte, lack- und goldbemalte kugelige Flaschen für den Rekordpreis
von 38 100 Mark an sich brachte, und daß zwei schwarzglasierte sechskantige Teedosen
28000 Mark kosteten, verdient nicht mindere Beachtung als die Preise, die man für
einige Stücke aus Boettger-Porzellan ausgab: 11 000 Mark für zwei vierkantige bauchige
Flaschen, 7100 für zwei sechskantige Teedosen, 12000 Mark für den Chinesen mit der
Johanneum-Nr. 219. In der Serie des frühen Herold-Porzellans gingen dann zwei vier-
kantige, nach dem Muster eines japanischen Kakiyemon-Porzellans bemalte Flaschen
um 1728 (Kat.-Nr. 189/140) für 26000 Mark fort, zwei sechskantige Deckelvasen der
gleichen Kategorie (Kat.-Nr. 141 /142) ^ur 90000 Mark. Zwei Teller mit gelbem Grund
(aus dem „Jagdservice“ Augusts des Starken, 1780) erzielten 28000 Mark, und für
eine flache in ostasiatischem Stil bemalte Schminkdose gab Rosenbaum (Frankfurt)
37000 Mark.
Die weißen Meißener Plastiken aus der Kaendler-Zeit waren zwar in dieser zweiten
sächsischen Doublettenauktion nicht so heiß umstritten wie im Oktober 1919, aber
das überraschte um so weniger, als man vor der Tatsache stand, daß eine Reihe dieser
höchst raren Gruppe zum zweitenmal auf dem Markt erschien und daß der Handel
noch von der ersten Doublettenauktion her gewissermaßen übersättigt war. So kam
das Ziegenpaar Kaendlers, das 1919 mit i3i 000 Mark weggegangen war, bloß auf
122000 Mark, für den großen weißen Reiher bot man 70000, für den großen weißen
Papagei 62000 Mark. Aber die Sensation der ganzen Versteigerung war der Verkauf