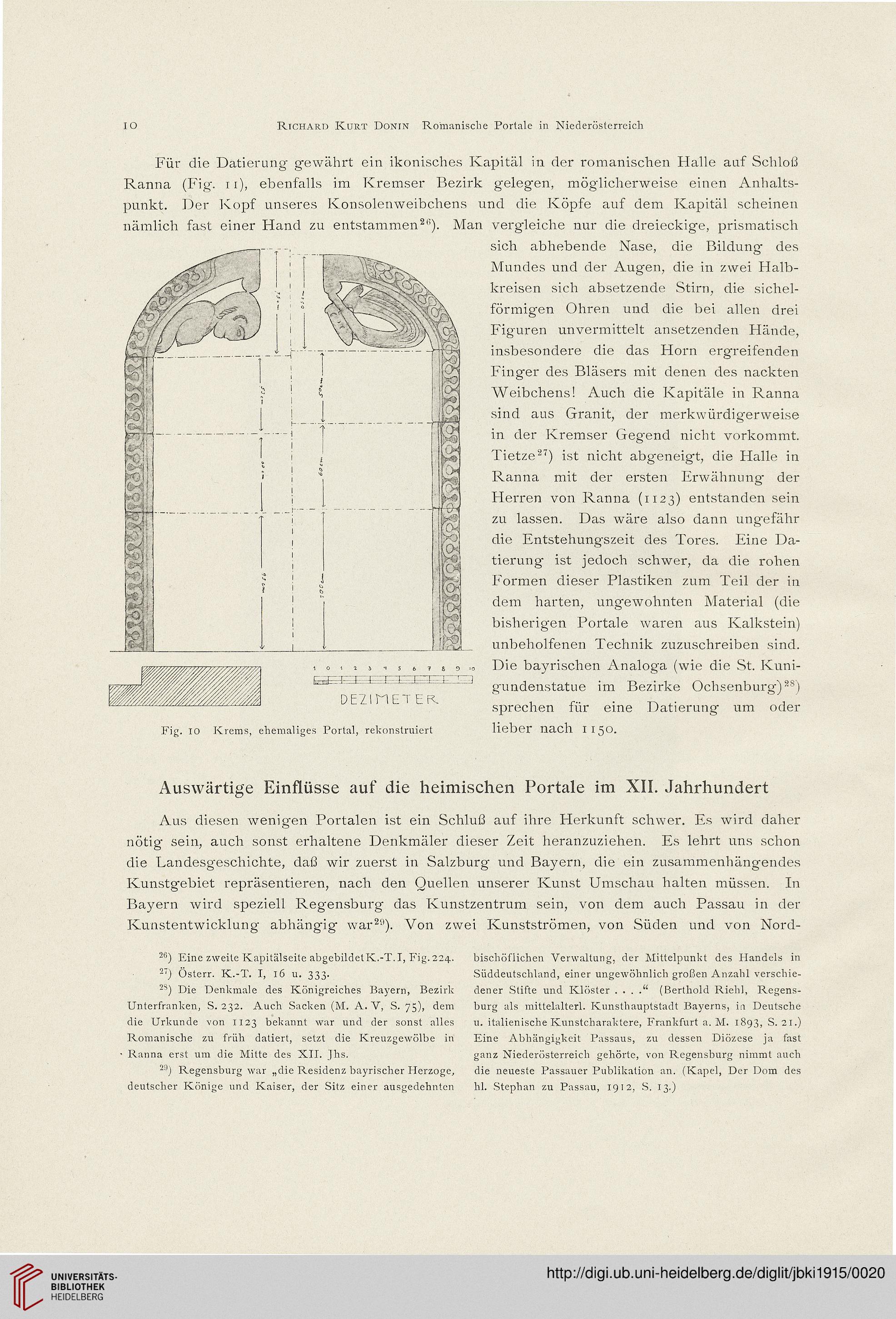IO
RiCHARD K.URT DoNlN Romanisclie Portale in Niederöstcrreich
Für die Datierung gewährt ein ikonisches Kapitäl in der romanischen Halle anf Schloß
Ranna (Fig. it), ebenfalls im Rremser Bezirk gelegen, möglicherweise einen Anhalts-
punkt. Der Fiopf unseres Konsolenweibchens und die Röpfe auf dem Kapitäl scheinen
nämlich fast einer Hand zu entstammen^^). Man vergleiche nur die dreieckige, prismatisch
sich abhebende Nase, die Bildung des
Mundes und der Augen, die in zwei Halb-
kreisen sich absetzende Stirn, die sichel-
förmigen Ohren und die bei allen drei
Figuren unvermittelt ansetzenden Hände,
insbesondere die das Horn ergreifenden
Finger des Bläsers mit denen des nackten
Weibchens! Auch die Kapitäle in Ranna
sind aus Granit, der merkwürdigerweise
in der Rremser Gegend nicht vorkommt.
Tietze^^) ist nicht abgeneigt, die Halle in
Ranna mit der ersten Erwähnung* der
Herren von Ranna (ti2ß) entstanden sein
zu lassen. Das wäre also dann ungefähr
die Entstehungszeit des Tores. Eine Da-
tierung ist jedoch schwer, da die rohen
Formen dieser Plastiken zum Teil der in
dem harten, ungewohnten Material (die
bisherigen Portale waren aus Kalkstein)
unbeholfenen Technik zuzuschreiben sind.
Die bayrischen Analoga (wie die St. Kuni-
gundenstatue im Bezjrke Ochsenburg)^^)
sprechen für eine Datierung um oder
lieber nach 1150.
Auswärtige Einfiüsse auf die heimischen Portale im XII. Jahrhundert
Aus diesen wenigen Portalen ist ein Schluß auf ihre Herkunft schwer. Es wird daher
nötig sein, auch sonst erhaltene Denkmäler dieser Zeit heranzuziehen. Es lehrt uns schon
die Landesgeschichte, daß wir zuerst in Salzburg und Bayern, die ein zusammenhängendes
Kunstgebiet repräsentieren, nach den Quellen unserer Kunst Umschau halten müssen. In
Bayern wird spezieli Regensburg das Kunstzentrum sein, von dem auch Passau in der
Kunstentwicklung abhängig waH"). Von zwei Kunstströmen, von Süden und von Nord-
26) Eine zweite Kapitälseite abgebilaetK.-T.I, Fig.224..
27) ögterr. K--T. I, 16 u. 333.
23) Die Denkmaie des Königreiches Bayern, Bezirk
Unterfranken, S. 232. Auch Sacken (M. A. V, S. 73), dem
die Urkunde von 1123 bekannt war und der sonst alles
Romanische zu früh datiert, setzt die Kreuzgewölbe in
Ranna erst um die Mitte des XII. Jhs.
26) Regensburg war „dieResidenzbayrischerHerzoge,
deutscher Könige und Kaiser, der Sitz einer ausgedehntcn
bischöfiichen Verwaltung, der Mittelpunkt des Handels in
Süddeutschiand, einer ungewöhniich großen Anzahl verschie-
dener Stifte und Klöster . . . ." (Berthoid Riehl, Regens-
burg als mittelalterl. Kunstbauptstadt Bayerns, in Deutsche
u. italienischeKunstcharaktere, Frankfurt a. M. 1893, S. 21.)
Eine Abhängigkcit Passaus, zu dessen Diözese ja fast
ganz Niederösterreich gehörte, von Regensburg nimmt auch
die neueste Passauer Publikation an. (Kapei, Der Dom des
hi. Stephan zu Passau, 1912, S. 13.)
RiCHARD K.URT DoNlN Romanisclie Portale in Niederöstcrreich
Für die Datierung gewährt ein ikonisches Kapitäl in der romanischen Halle anf Schloß
Ranna (Fig. it), ebenfalls im Rremser Bezirk gelegen, möglicherweise einen Anhalts-
punkt. Der Fiopf unseres Konsolenweibchens und die Röpfe auf dem Kapitäl scheinen
nämlich fast einer Hand zu entstammen^^). Man vergleiche nur die dreieckige, prismatisch
sich abhebende Nase, die Bildung des
Mundes und der Augen, die in zwei Halb-
kreisen sich absetzende Stirn, die sichel-
förmigen Ohren und die bei allen drei
Figuren unvermittelt ansetzenden Hände,
insbesondere die das Horn ergreifenden
Finger des Bläsers mit denen des nackten
Weibchens! Auch die Kapitäle in Ranna
sind aus Granit, der merkwürdigerweise
in der Rremser Gegend nicht vorkommt.
Tietze^^) ist nicht abgeneigt, die Halle in
Ranna mit der ersten Erwähnung* der
Herren von Ranna (ti2ß) entstanden sein
zu lassen. Das wäre also dann ungefähr
die Entstehungszeit des Tores. Eine Da-
tierung ist jedoch schwer, da die rohen
Formen dieser Plastiken zum Teil der in
dem harten, ungewohnten Material (die
bisherigen Portale waren aus Kalkstein)
unbeholfenen Technik zuzuschreiben sind.
Die bayrischen Analoga (wie die St. Kuni-
gundenstatue im Bezjrke Ochsenburg)^^)
sprechen für eine Datierung um oder
lieber nach 1150.
Auswärtige Einfiüsse auf die heimischen Portale im XII. Jahrhundert
Aus diesen wenigen Portalen ist ein Schluß auf ihre Herkunft schwer. Es wird daher
nötig sein, auch sonst erhaltene Denkmäler dieser Zeit heranzuziehen. Es lehrt uns schon
die Landesgeschichte, daß wir zuerst in Salzburg und Bayern, die ein zusammenhängendes
Kunstgebiet repräsentieren, nach den Quellen unserer Kunst Umschau halten müssen. In
Bayern wird spezieli Regensburg das Kunstzentrum sein, von dem auch Passau in der
Kunstentwicklung abhängig waH"). Von zwei Kunstströmen, von Süden und von Nord-
26) Eine zweite Kapitälseite abgebilaetK.-T.I, Fig.224..
27) ögterr. K--T. I, 16 u. 333.
23) Die Denkmaie des Königreiches Bayern, Bezirk
Unterfranken, S. 232. Auch Sacken (M. A. V, S. 73), dem
die Urkunde von 1123 bekannt war und der sonst alles
Romanische zu früh datiert, setzt die Kreuzgewölbe in
Ranna erst um die Mitte des XII. Jhs.
26) Regensburg war „dieResidenzbayrischerHerzoge,
deutscher Könige und Kaiser, der Sitz einer ausgedehntcn
bischöfiichen Verwaltung, der Mittelpunkt des Handels in
Süddeutschiand, einer ungewöhniich großen Anzahl verschie-
dener Stifte und Klöster . . . ." (Berthoid Riehl, Regens-
burg als mittelalterl. Kunstbauptstadt Bayerns, in Deutsche
u. italienischeKunstcharaktere, Frankfurt a. M. 1893, S. 21.)
Eine Abhängigkcit Passaus, zu dessen Diözese ja fast
ganz Niederösterreich gehörte, von Regensburg nimmt auch
die neueste Passauer Publikation an. (Kapei, Der Dom des
hi. Stephan zu Passau, 1912, S. 13.)