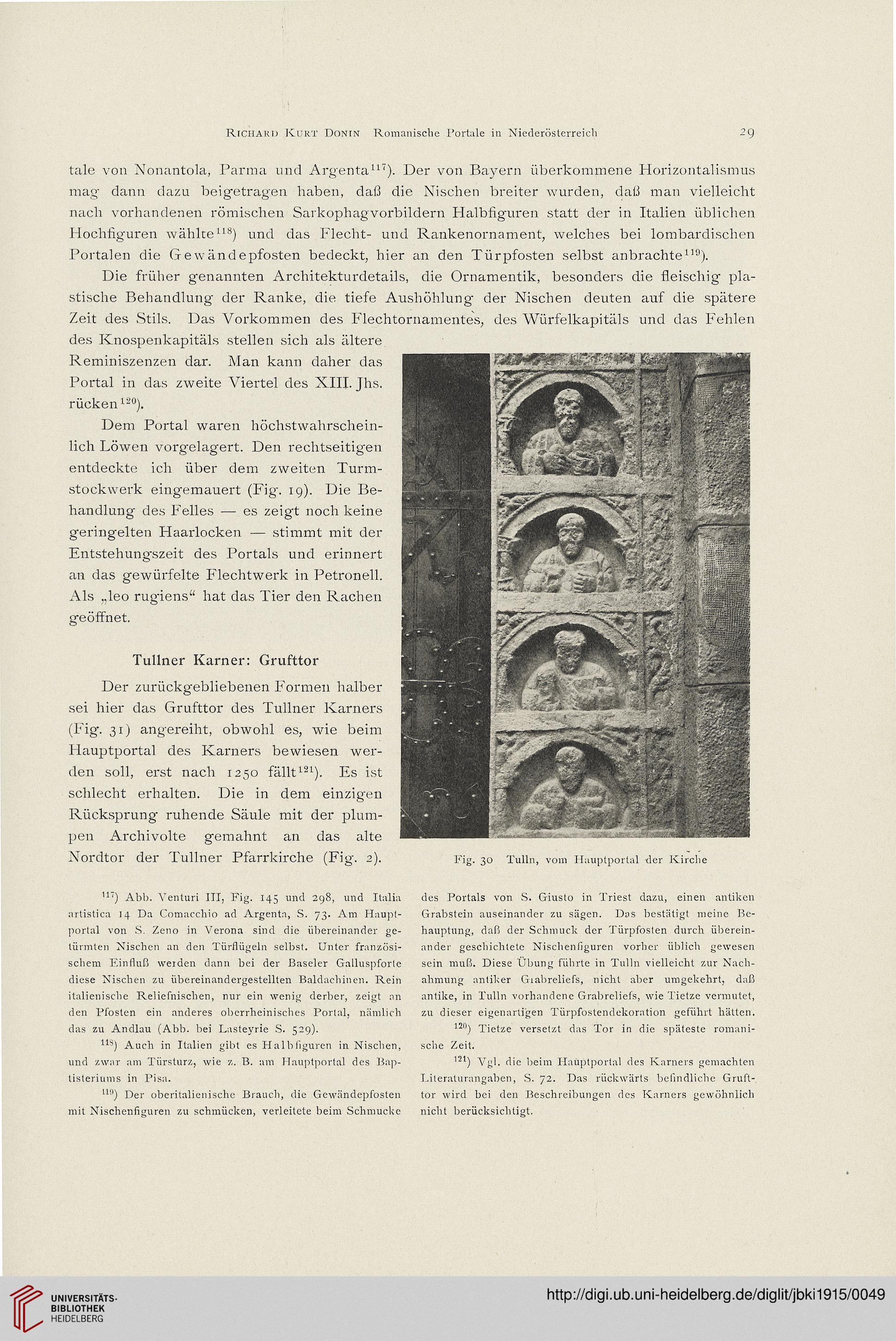RtCHAK!) KuR'i' DoNiN Romanische Portale in Niederösterreich
2Q
Tultner Karner: Grufttor
Der zurückgebliebenen Formen balber
sei hier das Grufttor des Tullner Karners
(Fig. 31) angereiht, obwohl es, wie beim
Hauptportal des Karners bewiesen wer-
den soli, erst nach 1250 fällt^^). Es ist
schlecht erhalten. Die in dem einzigen
Rücksprung ruhende Säule mit der plum-
pen Archivolte gemahnt an das alte
Nordtor der Tullner Pfarrkirche (Fig. 2). Fig. 30 Tuiin, vom Huuptportal der KiJche
tale von Nonantola, Parma und Argenta"'). Der von Bayern überkommene Horizontaiismus
mag dann dazu beigetragen haben, daß die Nischen breiter wurden, daÜ man vieileicht
nach vorhancienen römischen Sarkophagvorbildern Haibhguren statt der in Italien üblichen
Hochhguren wählce^^) und das Fiecht- und Rankenornament, welches bei lombardischen
Portalen die Gewändepfosten bedeckt, hier an den Türpfosten selbst anbrachte^").
Die früher genannten Architekturdetails, die Ornamentik, besonders die heischig pla-
stische Behandiung der Ranke, die tiefe Aushöhiung der Nischen deuten auf die spätere
Zeit des Stiis. Das Vorkommen des Flechtornamentes, des Würfelkapitäls und das Fehlen
des Knospenkapitäls stellen sich als ältere
Reminiszenzen dar. Man kann daher das
Portal in das zweite Viertel des XTII. Jhs.
rücken^^").
Dem Portal waren höchstwahrschein-
iich Löwen vorgelagert. Den rechtseitigen
entdeckte ich über dem zweiten Turm-
stockwerk eingemauert (Fig. 19). Die Be-
handlung des Felles -— es zeigt noch keine
geringelten Haarlocken — stimmt mit der
Entstehungszeit des Portals und erinnert
an das gewürfelte Fiechtwerk in Petronell.
Als „leo rug'iens" hat das Tier den Rachen
geöffnet.
'*') Abb. Venturi III, Fig. 1^3 und 298, und Italin
artistica 14 Da Comacchio ad Argentn, S. 73. Am Haupl-
portal von S. Zeno in Verona sind die übereinander ge-
türmtenNischenandenTürßügeinselbst. Unterfranzösi-
schem Einduß werden dann bei der ßaseler Galiuspfortc
diese Nischen zu übereinandergestellten Baldachinen. Rein
itaiienische Reiiefnischen, nur ein wenig derber, zeigt an
den Pfosten ein anderes obcrrheinisches Portal, nämiich
das zu Andlau (Abb. bei Lasteyrie S. 52p).
Auch in Italien gibt es Halbtiguren in Nischen,
und zwar am Türsturz, wie z. B. am Hauptportal des Bap-
tisteriums in Pisa.
Der oberitalicnischc Brauch, die Gewändepfosten
mit Nischenhguren zu schmücken, verleitete beim Schmuckc
des Portais von S. Giusto in Triest dazu, einen antikcn
Grabstein auseinander zu sägen. Das bestätigt meine Be-
hauptung, daß der Schmuck dcr Türpfosten durch überein-
ander geschichtete Nisclienfiguren vorher üblicli gewesen
sein muß. Diese Übung fülirte in Tulln vielleicht zur Nach-
ahmung antiker Giabreliefs, nicht aber umgekehrt, daß
antike, in Tulin vorhandenc Grabreliefs, wie Tietze vermutet,
zu dieser eigenartigen Türpfostendekoration geführt hättcn.
scheZeit.
Ygl. beim Hauptportai des Karners gemachten
Idteraturangaben, S. 72. Das rückwärts bctindliche Gruft-
tor wird bci den Beschreibungen dcs Karners gcwöhnlich
nicht berücksichtigt.
2Q
Tultner Karner: Grufttor
Der zurückgebliebenen Formen balber
sei hier das Grufttor des Tullner Karners
(Fig. 31) angereiht, obwohl es, wie beim
Hauptportal des Karners bewiesen wer-
den soli, erst nach 1250 fällt^^). Es ist
schlecht erhalten. Die in dem einzigen
Rücksprung ruhende Säule mit der plum-
pen Archivolte gemahnt an das alte
Nordtor der Tullner Pfarrkirche (Fig. 2). Fig. 30 Tuiin, vom Huuptportal der KiJche
tale von Nonantola, Parma und Argenta"'). Der von Bayern überkommene Horizontaiismus
mag dann dazu beigetragen haben, daß die Nischen breiter wurden, daÜ man vieileicht
nach vorhancienen römischen Sarkophagvorbildern Haibhguren statt der in Italien üblichen
Hochhguren wählce^^) und das Fiecht- und Rankenornament, welches bei lombardischen
Portalen die Gewändepfosten bedeckt, hier an den Türpfosten selbst anbrachte^").
Die früher genannten Architekturdetails, die Ornamentik, besonders die heischig pla-
stische Behandiung der Ranke, die tiefe Aushöhiung der Nischen deuten auf die spätere
Zeit des Stiis. Das Vorkommen des Flechtornamentes, des Würfelkapitäls und das Fehlen
des Knospenkapitäls stellen sich als ältere
Reminiszenzen dar. Man kann daher das
Portal in das zweite Viertel des XTII. Jhs.
rücken^^").
Dem Portal waren höchstwahrschein-
iich Löwen vorgelagert. Den rechtseitigen
entdeckte ich über dem zweiten Turm-
stockwerk eingemauert (Fig. 19). Die Be-
handlung des Felles -— es zeigt noch keine
geringelten Haarlocken — stimmt mit der
Entstehungszeit des Portals und erinnert
an das gewürfelte Fiechtwerk in Petronell.
Als „leo rug'iens" hat das Tier den Rachen
geöffnet.
'*') Abb. Venturi III, Fig. 1^3 und 298, und Italin
artistica 14 Da Comacchio ad Argentn, S. 73. Am Haupl-
portal von S. Zeno in Verona sind die übereinander ge-
türmtenNischenandenTürßügeinselbst. Unterfranzösi-
schem Einduß werden dann bei der ßaseler Galiuspfortc
diese Nischen zu übereinandergestellten Baldachinen. Rein
itaiienische Reiiefnischen, nur ein wenig derber, zeigt an
den Pfosten ein anderes obcrrheinisches Portal, nämiich
das zu Andlau (Abb. bei Lasteyrie S. 52p).
Auch in Italien gibt es Halbtiguren in Nischen,
und zwar am Türsturz, wie z. B. am Hauptportal des Bap-
tisteriums in Pisa.
Der oberitalicnischc Brauch, die Gewändepfosten
mit Nischenhguren zu schmücken, verleitete beim Schmuckc
des Portais von S. Giusto in Triest dazu, einen antikcn
Grabstein auseinander zu sägen. Das bestätigt meine Be-
hauptung, daß der Schmuck dcr Türpfosten durch überein-
ander geschichtete Nisclienfiguren vorher üblicli gewesen
sein muß. Diese Übung fülirte in Tulln vielleicht zur Nach-
ahmung antiker Giabreliefs, nicht aber umgekehrt, daß
antike, in Tulin vorhandenc Grabreliefs, wie Tietze vermutet,
zu dieser eigenartigen Türpfostendekoration geführt hättcn.
scheZeit.
Ygl. beim Hauptportai des Karners gemachten
Idteraturangaben, S. 72. Das rückwärts bctindliche Gruft-
tor wird bci den Beschreibungen dcs Karners gcwöhnlich
nicht berücksichtigt.