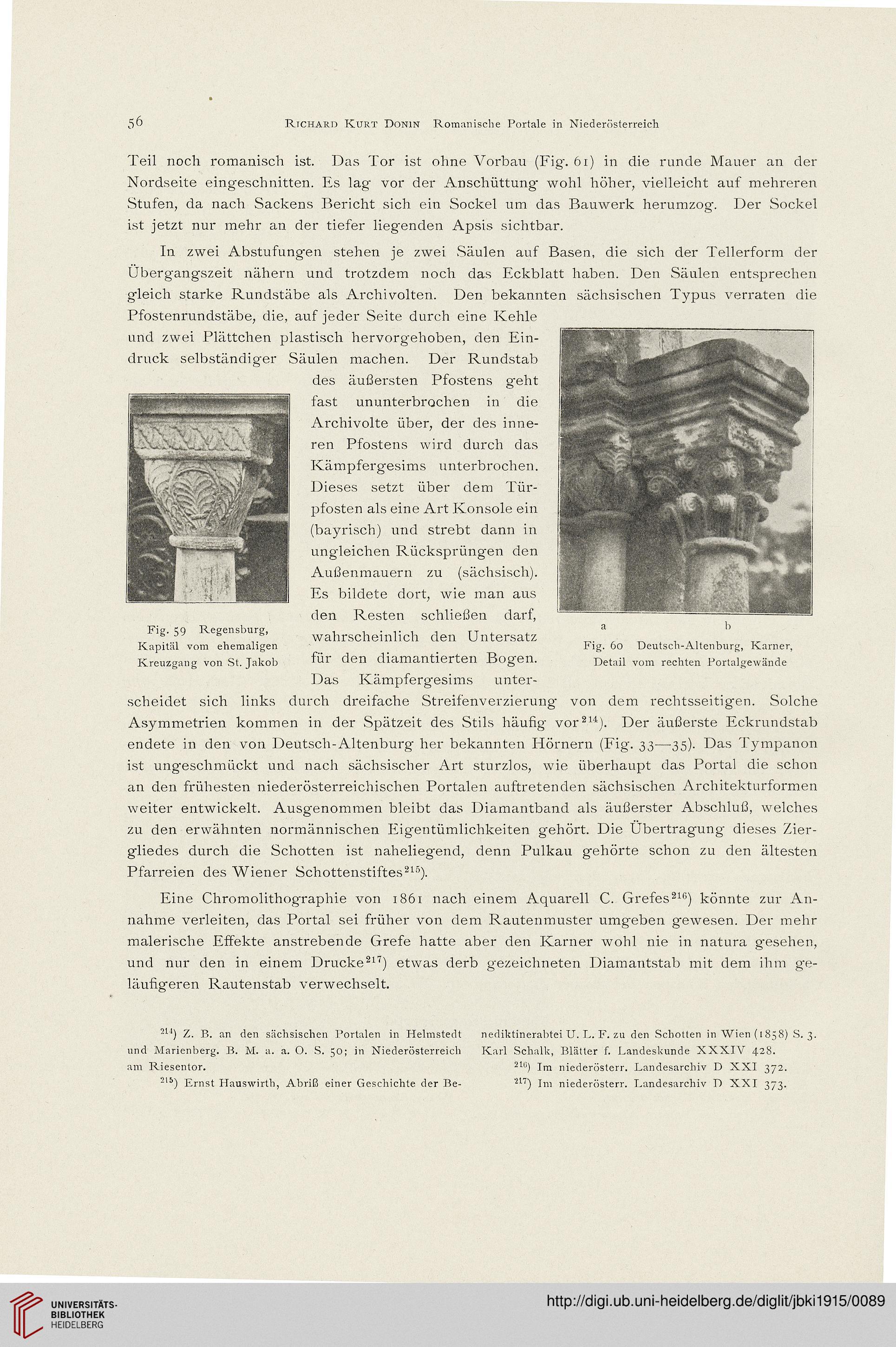56
R.fCHARD RuRT DoNiN Romanisclie Portale in NiederÖsterreich
Teil noch romanisch ist. Das Tor ist ohne Vorbau (Fig. 61) in die runde Mauer an der
Nordseite eingeschnitten. Es lag vor der Anschüttung wohl höher, viedeicht auf mehreren
Stufen, da nach Sackens Bericht sich ein Sockei um das Bauwerk herumzog. Der Sockel
ist jetzt nur mehr an der tiefer liegenden Apsis sichtbar.
In zwei Abstufungen stehen je zwei Säulen auf Basen, die sich der Tellerform der
Ubergangszeit nähern und trotzdem noch das Eckblatt haben. Den Säulen entsprechen
gleich starke Rundstäbe als Archivolten. Den bekannten sächsischen Typus verraten die
Pfostenrundstäbe, die, auf jeder Seite durch eine Kehle
und zwei Plättchen plastisch hervorgehoben, den Ein-
druck selbständiger Säulen machen. Der Rundstab
des äußersten Pfostens geht
fast ununterbrochen in die
Archivolte über, der des inne-
ren Pfostens wird durch das
Kämpfergesims unterbrochen.
Dieses setzt über dem Tür-
pfosten als eine Art Konsole ein
(bayrisch) und strebt dann in
ungleichen Rücksprüngen den
Auhenmauern zu (sächsisch).
Es bildete dort, wie man aus
den Resten schließen darf,
wahrscheinlich den Untersatz
für den diamantierten Bogen.
Das Kämpfergesims unter-
scheidet sich links durch dreifache Streifenverzierung* von dem rechtsseitigen. Solche
Asymmetrien kommen in der Spätzeit des Stils häuhg vor^). Der äußerste Eckrundstab
endete in den von Deutsch-Altenburg her bekannten Hörnern (Fig. 33—35). Das Tympanon
ist ungeschmückt und nach sächsischer Art sturzlos, wie überhaupt das Portal die schon
an den frühesten niederösterreichischen Portalen auftretenden sächsischen Architekturformen
weiter entwickelt. Ausgenommen bieibt das Diamantband als äußerster Abschluß, welches
zu den erwähnten normännischen Eigentümlichkeiten gehört. Die Übertragung dieses Zier-
gliedes durch die Schotten ist naheliegend, denn Pulkau gehörte schon zu den ältesten
Pfarreien des Wiener Schottenstiftes^").
Eine Chromolithographie von 1861 nach einem Aquarell C. Grefes^s) könnte zur An-
nahme verleiten, das Portal sei früher von dem Rautenmuster umgeben gewesen. Der mehr
malerische Effekte anstrebende Grefe hatte aber den Karner wohl nie in natura g*esehen,
und nur den in einem Drucke^?) etwas derb gezeichneten Diamantstab mit dem ihm ge-
läuhgeren Rautenstab verwechselt.
Fig. 59 Regensburg,
Rapitäi vom ehemaligen
KLreuzgang von St. Jakob
Fig. 60 Deutsch-Aitenburg, Narner,
Detail vom rechten Portalgewände
^^) Z. B. an den sächsischen Portalen in Helmstedt
und Marienberg. B. M. a. a. O. S. $0; in Niederösterreich
am Riesentor.
Ernst Hauswirth, Abriß einer Geschichte der Be-
nediktinerabteiU. L. F. zu den Schotten in Wien(t8$8) S. ß.
Karl Schalk, Blätter f. Landeskunde XXXIV 428.
^^) Im niederösterr. Landesarchiv D XXI 372.
3*7) Jni niederösterr. Landesarchiv D XXI 373.
R.fCHARD RuRT DoNiN Romanisclie Portale in NiederÖsterreich
Teil noch romanisch ist. Das Tor ist ohne Vorbau (Fig. 61) in die runde Mauer an der
Nordseite eingeschnitten. Es lag vor der Anschüttung wohl höher, viedeicht auf mehreren
Stufen, da nach Sackens Bericht sich ein Sockei um das Bauwerk herumzog. Der Sockel
ist jetzt nur mehr an der tiefer liegenden Apsis sichtbar.
In zwei Abstufungen stehen je zwei Säulen auf Basen, die sich der Tellerform der
Ubergangszeit nähern und trotzdem noch das Eckblatt haben. Den Säulen entsprechen
gleich starke Rundstäbe als Archivolten. Den bekannten sächsischen Typus verraten die
Pfostenrundstäbe, die, auf jeder Seite durch eine Kehle
und zwei Plättchen plastisch hervorgehoben, den Ein-
druck selbständiger Säulen machen. Der Rundstab
des äußersten Pfostens geht
fast ununterbrochen in die
Archivolte über, der des inne-
ren Pfostens wird durch das
Kämpfergesims unterbrochen.
Dieses setzt über dem Tür-
pfosten als eine Art Konsole ein
(bayrisch) und strebt dann in
ungleichen Rücksprüngen den
Auhenmauern zu (sächsisch).
Es bildete dort, wie man aus
den Resten schließen darf,
wahrscheinlich den Untersatz
für den diamantierten Bogen.
Das Kämpfergesims unter-
scheidet sich links durch dreifache Streifenverzierung* von dem rechtsseitigen. Solche
Asymmetrien kommen in der Spätzeit des Stils häuhg vor^). Der äußerste Eckrundstab
endete in den von Deutsch-Altenburg her bekannten Hörnern (Fig. 33—35). Das Tympanon
ist ungeschmückt und nach sächsischer Art sturzlos, wie überhaupt das Portal die schon
an den frühesten niederösterreichischen Portalen auftretenden sächsischen Architekturformen
weiter entwickelt. Ausgenommen bieibt das Diamantband als äußerster Abschluß, welches
zu den erwähnten normännischen Eigentümlichkeiten gehört. Die Übertragung dieses Zier-
gliedes durch die Schotten ist naheliegend, denn Pulkau gehörte schon zu den ältesten
Pfarreien des Wiener Schottenstiftes^").
Eine Chromolithographie von 1861 nach einem Aquarell C. Grefes^s) könnte zur An-
nahme verleiten, das Portal sei früher von dem Rautenmuster umgeben gewesen. Der mehr
malerische Effekte anstrebende Grefe hatte aber den Karner wohl nie in natura g*esehen,
und nur den in einem Drucke^?) etwas derb gezeichneten Diamantstab mit dem ihm ge-
läuhgeren Rautenstab verwechselt.
Fig. 59 Regensburg,
Rapitäi vom ehemaligen
KLreuzgang von St. Jakob
Fig. 60 Deutsch-Aitenburg, Narner,
Detail vom rechten Portalgewände
^^) Z. B. an den sächsischen Portalen in Helmstedt
und Marienberg. B. M. a. a. O. S. $0; in Niederösterreich
am Riesentor.
Ernst Hauswirth, Abriß einer Geschichte der Be-
nediktinerabteiU. L. F. zu den Schotten in Wien(t8$8) S. ß.
Karl Schalk, Blätter f. Landeskunde XXXIV 428.
^^) Im niederösterr. Landesarchiv D XXI 372.
3*7) Jni niederösterr. Landesarchiv D XXI 373.