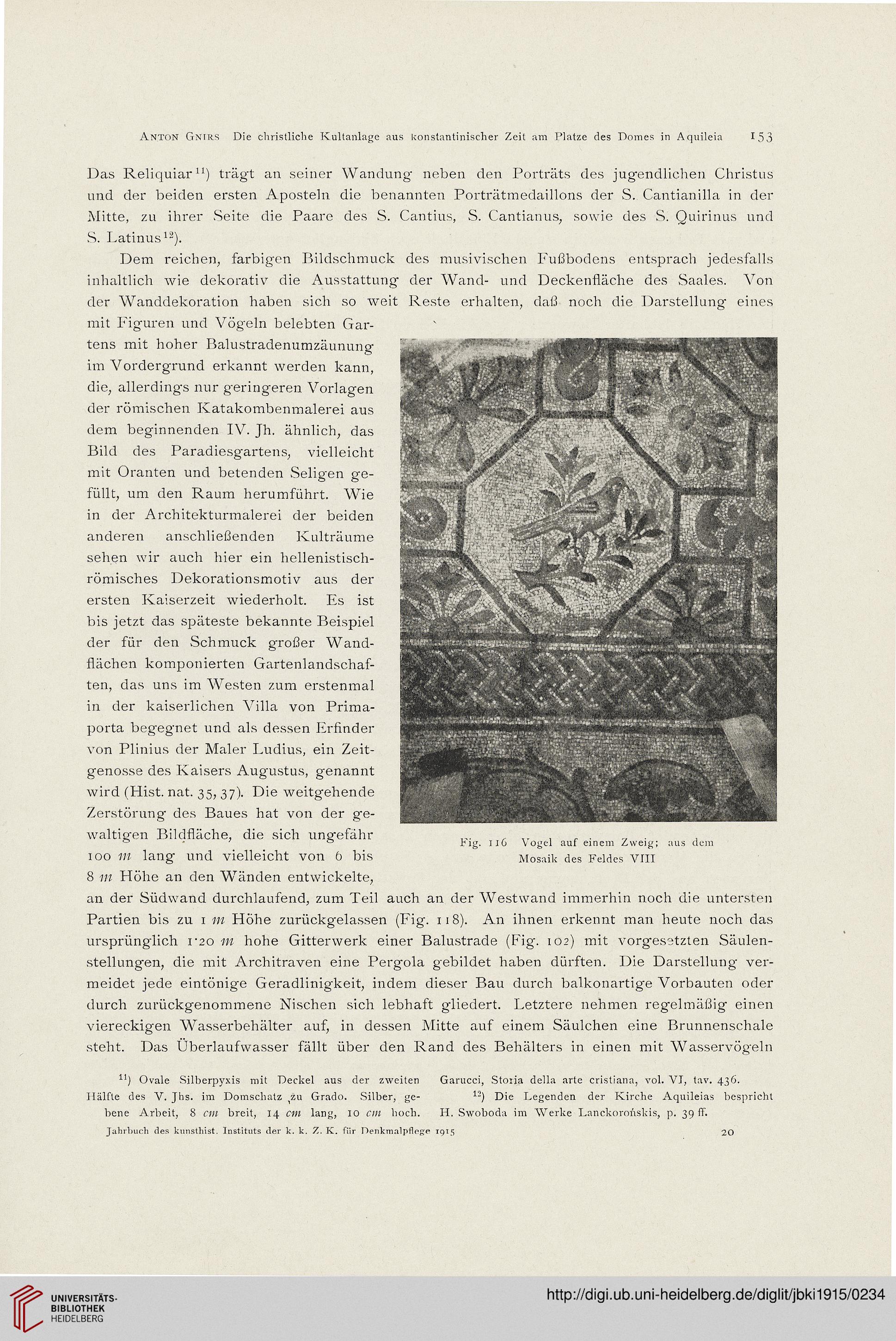153
Das Reliquiar^) trägt an seiner Wandung neben den Porträts des jugendlichen Christus
und der beiden ersten Aposteln die benannten Porträtmedaiiions der S. Cantianilla in der
Mitte, zu ihrer Seite die Paare des S. Cantius, S. Cantianus, sowie des S. Quirinus und
S. Latinus^).
Dem reichen, farbigen Pildschmuck des musivischen Fußbodens entsprach jedesfaHs
inhaltiich wie dekorativ die Ausstattung der Wand- und Deckenßäche des Saales. Von
der Wanddekoration haben sich so weit Reste erhalten, daß noch die Darstellung eines
mit Figuren und Vögeln belebten Gar-
tens mit hoher Baiustradenumzäunung
im Vordergrund erkannt werden kann,
die, alierdings nur geringeren Voriagen
der römischen Katakombenmalerei aus
dem beginnenden IV. Jh. ähnlich, das
Bild des Paradiesgartens, vielleicht
mit Oranten und betenden Seligen ge-
füllt, um den Raum herumführt. Wie
in der Architekturmalerei der beiden
anderen anschließenden Kulträume
sehen wir auch hier ein hellenistisch-
römisches Dekorationsmotiv aus der
ersten Kaiserzeit wiederholt. Es ist
bis jetzt das späteste bekannte Beispiel
der für den Schmuck großer Wand-
Hächen komponierten Gartenlandschaf-
ten, das uns im Westen zum erstenmal
in der kaiserlichen Villa von Prima-
porta begegnet und als dessen Erhnder
von Plinius der Maler Ludius, ein Zeit-
genosse des Kaisers Augustus, genannt
wird (Fiist. nat. 35, 37)- Die weitgehende
Zerstörung des Baues hat von der ge-
waltigen Bildßäche, die sich ungefähr
100 M lang und vielleicht von b bis
8 w Höhe an den Wänden entwickelte,
an der Südwand durchlaufend, zum Teil auch an der Westwand immerhin noch die untersten
Partien bis zu 1 Höhe zurückgelassen (Fig. it8). An ihnen erkennt man heute noch das
ursprünglich 1*20 w hohe Gitterwerk einer Balustrade (Fig. 102) mit vorgesetzten Säulen-
stellungen, die mit Architraven eine Pergola gebildet haben dürften. Die Darstellung ver-
meidet jede eintönige Geradlinigkeit, indem dieser Bau durch balkonartige Vorbauten oder
durch zurückgenommene Nischen sich lebhaft gliedert. Letztere nehmen regelmäßig einen
viereckigen Wasserbehälter auf, in dessen Mitte auf einem Säulchen eine Brunnenschale
steht. Das Uberlaufwasser fällt über den Rand des Behälters in einen mit Wasservögeln
Ovale Silberpyxis mit Deckei aus der zweiten Garucci, Storia delia arte cristiana, voi. Vt, tav. 436.
Iiälfte des V. Jhs. im Domscbatz zu Grado. Siiber, ge- *-) Die Legenden der Kirche Aquileias bespricht
bene Arbeit, 8 breit, 14 lang, 10 cur hoch. H. Swoboda im Werlre LanckoroAstis, p. 39 ff-
Mosaih des Feldcs VIII
20