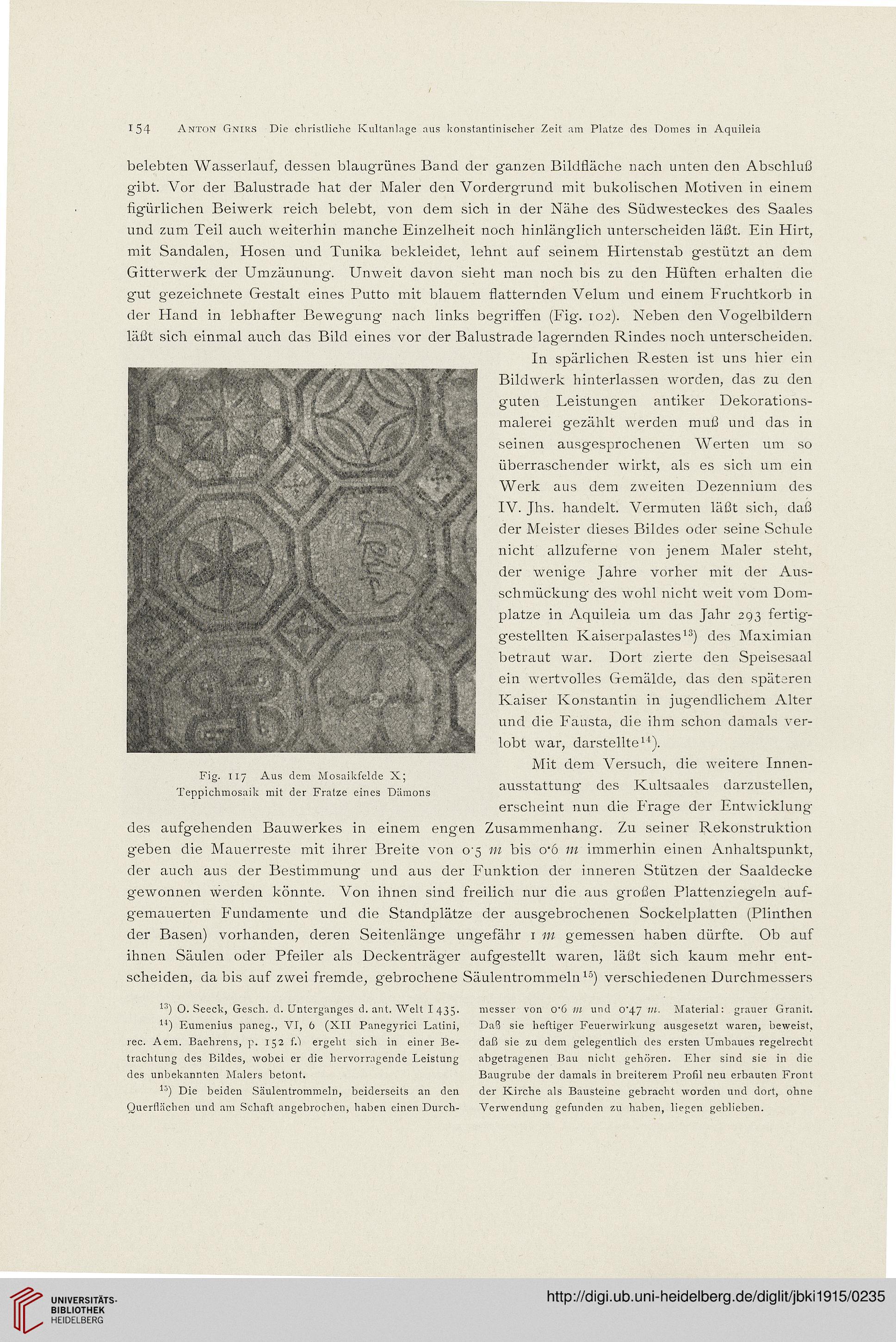154
ANTON GNIRS Die cliristliche Kultanlnge aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia
belebten Wasserlauf, dessen blaugrünes Band der ganzen Bildftäche nach unten den Abschluß
gibt. Vor der Balustrade hat der Maler den Vordergrund mit bukolischen Motiven in einem
hgürlichen Beiwerk reich belebt, von dem sich in der Nähe des Südwesteckes des Saales
und zum Teil auch weiterhin manche Einzelheit noch hinlänglich unterscheiden läßt. Ein Hirt,
mit Sandalen, Hosen und Tunika bekleidet, lehnt auf seinem Hirtenstab gestützt an dem
Gitterwerk der Umzäunung. Unweit davon sieht man noch bis zu den Hüften erhalten die
gut gezeichnete Gestalt eines Putto mit biauem hatternden Velum und einem Fruchtkorb in
der Hand in lebhafter Bewegung nach links begriffen (Fig. to2). Neben den Vogelbiidern
läßt sich einmai auch das Bild eines vor der Baiustrade lagernden Rindes noch unterscheiden.
In spärlichen Resten ist uns hier ein
Bildwerk hinterlassen worden, das zu den
guten Leistungen antiker Dekorations-
malerei gezählt werden muß und das in
seinen ausgesprochenen Werten um so
überraschender wirkt, als es sich um ein
Werk aus dem zweiten Dezennium des
IV. Jhs. handelt. Vermuteu läßt sich, daß
der Meister dieses Bildes oder seine Schuie
nicht allzuferne von jenem Maler steht,
der wenige Jahre vorher mit der Aus-
schmückung des wohi nicht weit vom Dom-
platze in Aquileia um das Jahr 293 fertig-
gesteliten Raiserpalastes^) des Maximian
betraut war. Dort zierte den Speisesaal
ein wertvolles Gemälde, das den späteren
Raiser Ronstantin in jugendlichem Alter
und die Fausta, die ihm schon damals ver-
lobt war, darstellte^).
Mit dem Versuch, die weitere Innen-
ausstattung des Rultsaales darzustellen,
erscheint nun die B'rage der Entwicklung
des aufgehenden Bauwerkes in einem engen Zusammenhang. Zu seiner Rekonstruktion
geben die Mauerreste mit ihrer Breite von o g w bis 0*6 nz immerhin einen Anhaltspunkt,
der auch aus der Bestimmung und aus der Funktion der inneren Stützen der Saaldecke
gewonnen werden könnte. Von ihnen sind freilich nur die aus großen Plattenziegeln auf-
gemauerten Fundamente und die Standplätze der ausgebrochenen Sockelplatten (Plinthen
der Basen) vorhanden, deren Seitenlänge ungefälir 1 w gemessen haben dürfte. Ob auf
ihnen Säulen oder Pfeiler als Deckenträger aufgestellt waren, läßt sich kaum mehr ent-
scheiden, dabis auf zwei fremde, gebrochene SäuIentrommelnV) verschiedenen Durchmessers
O. Seecl;, Gesch. d. Untcrganges d. ant. Wett I 435.
'*) Eumenius paneg-, Vt, & (XII Panegyrici Latini,
rec. Aem. Baehrens, p. 132 f.) ergeht sich in einer Be-
trachtung des Bildes, wobei er die hervorragende Leistung
des unbekannten Maiers betont.
^) Die beiden Säulentrommein, beiderseits an den
Querßächen und am Schnft angebroclien, haben einen Durch-
messer von 0*6 77: und C47 <77. Materiai: grauer Granit.
DaB sie heftiger Feuerwirkung ausgesetzt waren, beweist,
daß sie zu dem geiegentlich des ersten Umbaues regeirecbt
abgetragenen Bau niclrt gehören. Eher sind sie in die
Baugrube der damals in breiterem Profii neu erbauten Front
der Kirche ais Bausteine gebracht worden und dort, ohne
Verwendung gefunden zu haben, iiegen geblieben.
ANTON GNIRS Die cliristliche Kultanlnge aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia
belebten Wasserlauf, dessen blaugrünes Band der ganzen Bildftäche nach unten den Abschluß
gibt. Vor der Balustrade hat der Maler den Vordergrund mit bukolischen Motiven in einem
hgürlichen Beiwerk reich belebt, von dem sich in der Nähe des Südwesteckes des Saales
und zum Teil auch weiterhin manche Einzelheit noch hinlänglich unterscheiden läßt. Ein Hirt,
mit Sandalen, Hosen und Tunika bekleidet, lehnt auf seinem Hirtenstab gestützt an dem
Gitterwerk der Umzäunung. Unweit davon sieht man noch bis zu den Hüften erhalten die
gut gezeichnete Gestalt eines Putto mit biauem hatternden Velum und einem Fruchtkorb in
der Hand in lebhafter Bewegung nach links begriffen (Fig. to2). Neben den Vogelbiidern
läßt sich einmai auch das Bild eines vor der Baiustrade lagernden Rindes noch unterscheiden.
In spärlichen Resten ist uns hier ein
Bildwerk hinterlassen worden, das zu den
guten Leistungen antiker Dekorations-
malerei gezählt werden muß und das in
seinen ausgesprochenen Werten um so
überraschender wirkt, als es sich um ein
Werk aus dem zweiten Dezennium des
IV. Jhs. handelt. Vermuteu läßt sich, daß
der Meister dieses Bildes oder seine Schuie
nicht allzuferne von jenem Maler steht,
der wenige Jahre vorher mit der Aus-
schmückung des wohi nicht weit vom Dom-
platze in Aquileia um das Jahr 293 fertig-
gesteliten Raiserpalastes^) des Maximian
betraut war. Dort zierte den Speisesaal
ein wertvolles Gemälde, das den späteren
Raiser Ronstantin in jugendlichem Alter
und die Fausta, die ihm schon damals ver-
lobt war, darstellte^).
Mit dem Versuch, die weitere Innen-
ausstattung des Rultsaales darzustellen,
erscheint nun die B'rage der Entwicklung
des aufgehenden Bauwerkes in einem engen Zusammenhang. Zu seiner Rekonstruktion
geben die Mauerreste mit ihrer Breite von o g w bis 0*6 nz immerhin einen Anhaltspunkt,
der auch aus der Bestimmung und aus der Funktion der inneren Stützen der Saaldecke
gewonnen werden könnte. Von ihnen sind freilich nur die aus großen Plattenziegeln auf-
gemauerten Fundamente und die Standplätze der ausgebrochenen Sockelplatten (Plinthen
der Basen) vorhanden, deren Seitenlänge ungefälir 1 w gemessen haben dürfte. Ob auf
ihnen Säulen oder Pfeiler als Deckenträger aufgestellt waren, läßt sich kaum mehr ent-
scheiden, dabis auf zwei fremde, gebrochene SäuIentrommelnV) verschiedenen Durchmessers
O. Seecl;, Gesch. d. Untcrganges d. ant. Wett I 435.
'*) Eumenius paneg-, Vt, & (XII Panegyrici Latini,
rec. Aem. Baehrens, p. 132 f.) ergeht sich in einer Be-
trachtung des Bildes, wobei er die hervorragende Leistung
des unbekannten Maiers betont.
^) Die beiden Säulentrommein, beiderseits an den
Querßächen und am Schnft angebroclien, haben einen Durch-
messer von 0*6 77: und C47 <77. Materiai: grauer Granit.
DaB sie heftiger Feuerwirkung ausgesetzt waren, beweist,
daß sie zu dem geiegentlich des ersten Umbaues regeirecbt
abgetragenen Bau niclrt gehören. Eher sind sie in die
Baugrube der damals in breiterem Profii neu erbauten Front
der Kirche ais Bausteine gebracht worden und dort, ohne
Verwendung gefunden zu haben, iiegen geblieben.