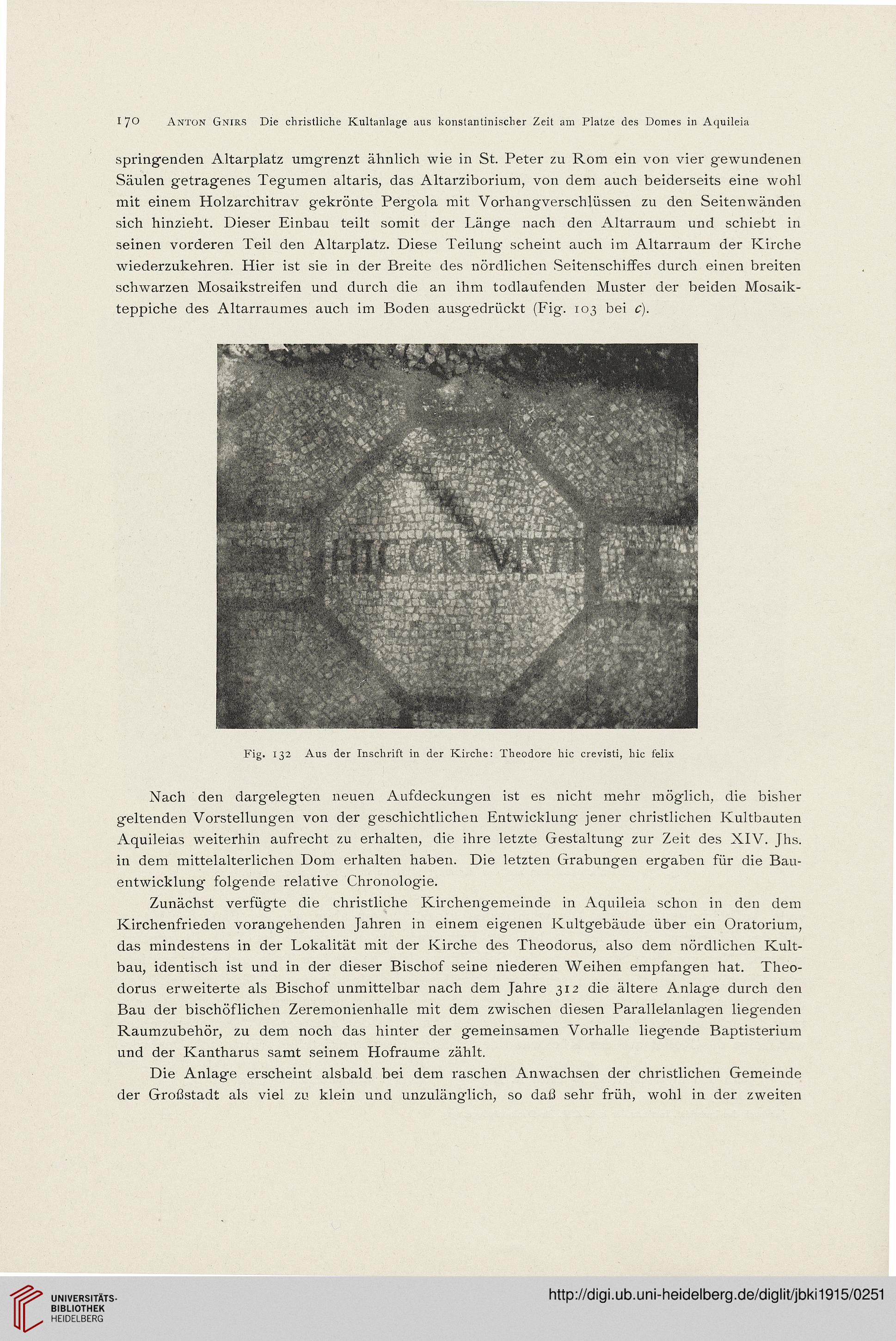170 ANTON GNIRS Die christliche Kultanlage aus konstantinischer Zeit am Platze des Domes in Aquileia
sprmgenden Altarplatz umgrenzt ähnlich wie in St. Peter zu Rom ein von vier gewundenen
Säulen getragenes Tegumen altaris, das Altarziborium, von dem auch beiderseits eine wohl
mit einem Holzarchitrav gekrönte Pergola mit Vorhangverschlüssen zu den Seitenwänden
sich hinzieht. Dieser Einbau teilt somit der Länge nach den Altarraum und schiebt in
seinen vorderen Teil den Altarpiatz. Diese Teilung scheint auch im Altarraum der Kirche
wiederzukehren. Hier ist sie in der Breite des nördlichen Seitenschiifes durch einen breiten
schwarzen Mosaikstreifen und durch die an ihm todiaufenden Muster der beiden Mosaik-
teppiche des Altarraumes auch im Boden ausgedrückt (Fig. 103 bei c).
Fig. 132 Aus der Inschrift in der ELirche: Theodore hic crevisti, hic telix
Nach den dargelegten neuen Aufdeckungen ist es nicht mehr möglich, die bisher
geltenden Vorstellungen von der geschichtlichen Entwicklung jener christlichen Hultbauten
Aquileias weiterhin aufrecht zu erhalten, die ihre letzte Gestaltung zur Zeit des XIV. Jhs.
in dem mittelalterlichen Dom erhalten habeu. Die letzten Grabungen ergaben für die Bau-
entwicklung folgende relative Chronologie.
Zunächst verfügte die christliche Kirchengemeinde in Aquileia schon in den dem
Kirchenfrieden vorangehenden Jahren in einem eigenen ICultgebäude über ein Oratorium,
das mindestens in der Lokalität mit der Kirche des Theodorus, also dem nördlichen Kult-
bau, identisch ist und in der dieser Bischof seine niederen Weihen empfangen hat. Theo-
dorus erweiterte als Bischof unmittelbar nach dem Jahre 312 die ältere Anlage durch den
Bau der bischöflichen Zeremonienhalle mit dem zwischen diesen Parallelanlagen liegenden
Raumzubehör, zu dem noch das hinter der gemeinsamen Vorhalle liegende Baptisterium
und der Kantharus samt seinem Hofraume zählt.
Die Anlage erscheint alsbald bei dem raschen Anwachsen der christlichen Gemeinde
der Großstadt als viel zu klein und unzuläng'lich, so da6 sehr früh, wohl in der zweiten
sprmgenden Altarplatz umgrenzt ähnlich wie in St. Peter zu Rom ein von vier gewundenen
Säulen getragenes Tegumen altaris, das Altarziborium, von dem auch beiderseits eine wohl
mit einem Holzarchitrav gekrönte Pergola mit Vorhangverschlüssen zu den Seitenwänden
sich hinzieht. Dieser Einbau teilt somit der Länge nach den Altarraum und schiebt in
seinen vorderen Teil den Altarpiatz. Diese Teilung scheint auch im Altarraum der Kirche
wiederzukehren. Hier ist sie in der Breite des nördlichen Seitenschiifes durch einen breiten
schwarzen Mosaikstreifen und durch die an ihm todiaufenden Muster der beiden Mosaik-
teppiche des Altarraumes auch im Boden ausgedrückt (Fig. 103 bei c).
Fig. 132 Aus der Inschrift in der ELirche: Theodore hic crevisti, hic telix
Nach den dargelegten neuen Aufdeckungen ist es nicht mehr möglich, die bisher
geltenden Vorstellungen von der geschichtlichen Entwicklung jener christlichen Hultbauten
Aquileias weiterhin aufrecht zu erhalten, die ihre letzte Gestaltung zur Zeit des XIV. Jhs.
in dem mittelalterlichen Dom erhalten habeu. Die letzten Grabungen ergaben für die Bau-
entwicklung folgende relative Chronologie.
Zunächst verfügte die christliche Kirchengemeinde in Aquileia schon in den dem
Kirchenfrieden vorangehenden Jahren in einem eigenen ICultgebäude über ein Oratorium,
das mindestens in der Lokalität mit der Kirche des Theodorus, also dem nördlichen Kult-
bau, identisch ist und in der dieser Bischof seine niederen Weihen empfangen hat. Theo-
dorus erweiterte als Bischof unmittelbar nach dem Jahre 312 die ältere Anlage durch den
Bau der bischöflichen Zeremonienhalle mit dem zwischen diesen Parallelanlagen liegenden
Raumzubehör, zu dem noch das hinter der gemeinsamen Vorhalle liegende Baptisterium
und der Kantharus samt seinem Hofraume zählt.
Die Anlage erscheint alsbald bei dem raschen Anwachsen der christlichen Gemeinde
der Großstadt als viel zu klein und unzuläng'lich, so da6 sehr früh, wohl in der zweiten