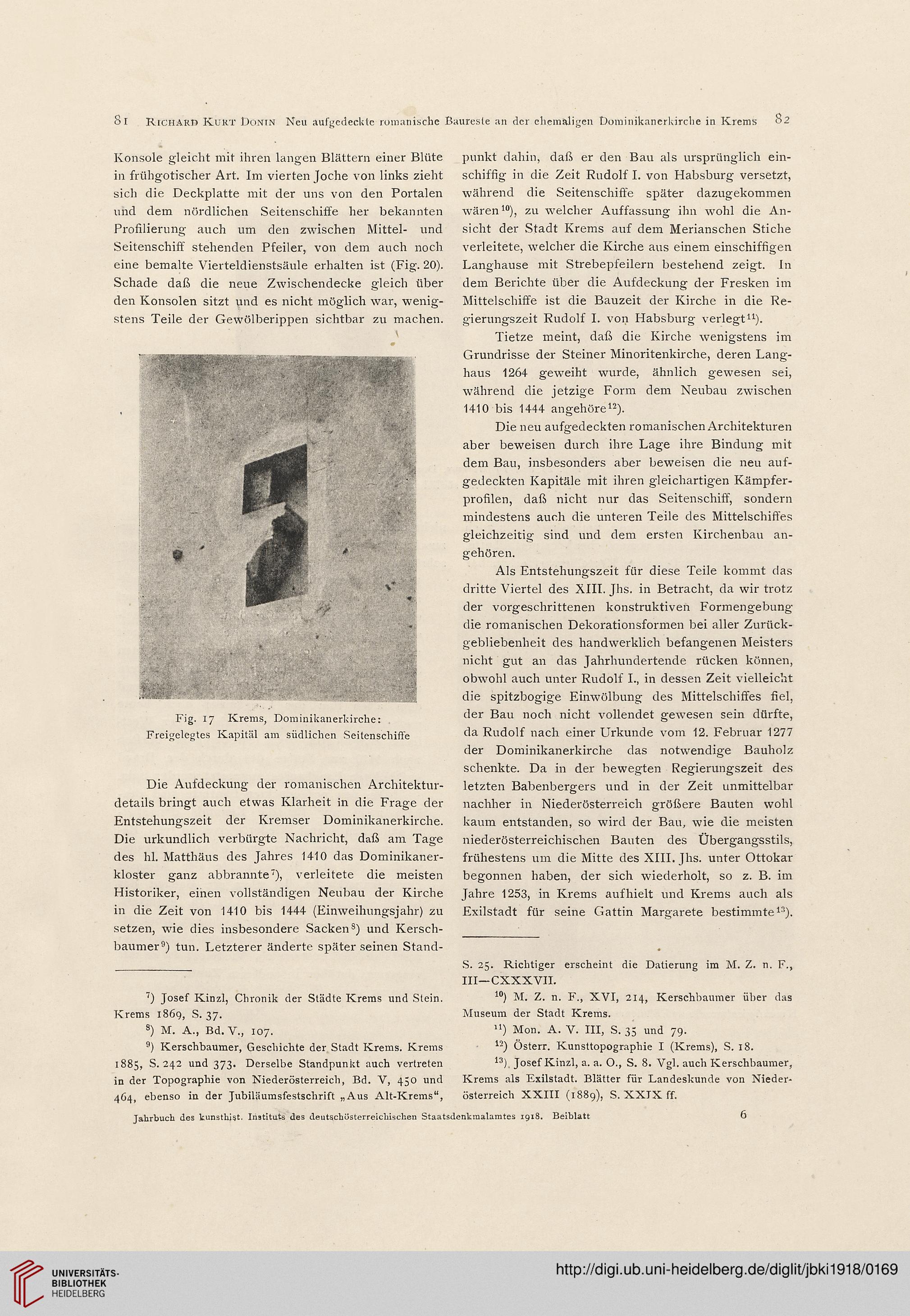8 I Richard Kurt Down Neu aufgedeckte rumänische Baureste an der ehemaligen Dominikanerkirche in Krems
Konsole gleicht mit ihren langen Blättern einer Blüte
in frühgotischer Art. Im vierten Joche von links zieht
sich die Deckplatte mit der uns von den Portalen
und dem nördlichen Seitenschiffe her bekannten
Profilierung auch um den zwischen Mittel- und
Seitenschiff stehenden Pfeiler, von dem auch noch
eine bemalte Vierteldienstsäule erhalten ist (Fig. 20).
Schade daß die neue Zwischendecke gleich über
den Konsolen sitzt und es nicht möglich war, wenig-
stens Teile der Gewölberippen sichtbar zu machen.
Fig. 17 Krems, Dominikanerkirche:
Freigelegtes Kapital am südlichen Seitenschiffe
Die Aufdeckung der romanischen Architektur-
details bringt auch etwas Klarheit in die Frage der
Entstehungszeit der Kremser Dominikanerkirche.
Die urkundlich verbürgte Nachricht, daß am Tage
des hl. Matthäus des Jahres 1410 das Dominikaner-
kloster ganz abbrannte7), verleitete die meisten
Historiker, einen vollständigen Neubau der Kirche
in die Zeit von 1410 bis 1444 (Einweihungsjahr) zu
setzen, wie dies insbesondere Sacken8) und Kersch-
baumer9) tun. Letzterer änderte später seinen Stand-
7) Josef Kinzl, Chronik der Städte Krems und Stein.
Krems 1869, S. 37.
8) M. A., Bd. V., 107.
9) Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems. Krems
1885, S. 242 und 373. Derselbe Standpunkt auch vertreten
in der Topographie von Niederösterreich, Bd. V, 450 und
464, ebenso in der Jubiläumsfestschrift „Aus Alt-Krems“,
punkt dahin, daß er den Bau als ursprünglich ein-
schiffig in die Zeit Rudolf I. von Habsburg versetzt,
während die Seitenschiffe später dazugekommen
wären10), zu welcher Auffassung ihn wohl die An-
sicht der Stadt Krems auf dem Merianschen Stiche
verleitete, welcher die Kirche aus einem einschiffigen
Langhause mit Strebepfeilern bestehend zeigt. In
dem Berichte über die Aufdeckung der Fresken im
Mittelschiffe ist die Bauzeit der Kirche in die Re-
gierungszeit Rudolf I. von Habsburg verlegt11).
Tietze meint, daß die Kirche wenigstens im
Grundrisse der Steiner Minoritenkirche, deren Lang-
haus 1264 geweiht wurde, ähnlich gewesen sei,
während die jetzige Form dem Neubau zwischen
1410 bis 1444 angehöre12).
Die neu aufgedeckten romanischen Architekturen
aber beweisen durch ihre Lage ihre Bindung mit
dem Bau, insbesondere aber beweisen die neu auf-
gedeckten Kapitale mit ihren gleichartigen Kämpfer-
profilen, daß nicht nur das Seitenschiff, sondern
mindestens auch die unteren Teile des Mittelschiffes
gleichzeitig sind und dem ersten Kirchenbau an-
gehören.
Als Entstehungszeit für diese Teile kommt das
dritte Viertel des XIII. Jhs. in Betracht, da wir trotz
der vorgeschrittenen konstruktiven Formengebung
die romanischen Dekorationsformen bei aller Zurück-
gebliebenheit des handwerklich befangenen Meisters
nicht gut an das Jahrhundertende rücken können,
obwohl auch unter Rudolf I., in dessen Zeit vielleicht
die spitzbogige Einwölbung des Mittelschiffes fiel,
der Bau noch nicht vollendet gewesen sein dürfte,
da Rudolf nach einer Urkunde vom 12. Februar 1277
der Dominikanerkirche das notwendige Bauholz
schenkte. Da in der bewegten Regierungszeit des
letzten Babenbergers und in der Zeit unmittelbar
nachher in Niederösterreich größere Bauten wohl
kaum entstanden, so wird der Bau, wie die meisten
niederösterreichischen Bauten des Übergangsstils,
frühestens um die Mitte des XIII. Jhs. unter Ottokar
begonnen haben, der sich wiederholt, so z. B. im
Jahre 1253, in Krems auf hielt und Krems auch als
Exilstadt für seine Gattin Margarete bestimmte19).
S. 25. Richtiger erscheint die Datierung im M. Z. n. F.,
III—CXXXVII.
10) M. Z. n. F., XVI, 214, Kerschbaumer über das
Museum der Stadt Krems.
n) Mon. A. V. III, S. 35 und 79.
12) Österr. Kunsttopographie I (Krems), S. 18.
13) Josef Kinzl, a. a. O., S. 8. Vgl. auch Kerschbaumer,
Krems als Exilstadt. Blätter für Landeskunde von Nieder-
österreich XXIII (1889), S. XXIX ff.
Jahrbuch des kunsthist. Instituts des deutschiisterreichischen Staatsdenkmalamtes 1918. Beiblatt
Konsole gleicht mit ihren langen Blättern einer Blüte
in frühgotischer Art. Im vierten Joche von links zieht
sich die Deckplatte mit der uns von den Portalen
und dem nördlichen Seitenschiffe her bekannten
Profilierung auch um den zwischen Mittel- und
Seitenschiff stehenden Pfeiler, von dem auch noch
eine bemalte Vierteldienstsäule erhalten ist (Fig. 20).
Schade daß die neue Zwischendecke gleich über
den Konsolen sitzt und es nicht möglich war, wenig-
stens Teile der Gewölberippen sichtbar zu machen.
Fig. 17 Krems, Dominikanerkirche:
Freigelegtes Kapital am südlichen Seitenschiffe
Die Aufdeckung der romanischen Architektur-
details bringt auch etwas Klarheit in die Frage der
Entstehungszeit der Kremser Dominikanerkirche.
Die urkundlich verbürgte Nachricht, daß am Tage
des hl. Matthäus des Jahres 1410 das Dominikaner-
kloster ganz abbrannte7), verleitete die meisten
Historiker, einen vollständigen Neubau der Kirche
in die Zeit von 1410 bis 1444 (Einweihungsjahr) zu
setzen, wie dies insbesondere Sacken8) und Kersch-
baumer9) tun. Letzterer änderte später seinen Stand-
7) Josef Kinzl, Chronik der Städte Krems und Stein.
Krems 1869, S. 37.
8) M. A., Bd. V., 107.
9) Kerschbaumer, Geschichte der Stadt Krems. Krems
1885, S. 242 und 373. Derselbe Standpunkt auch vertreten
in der Topographie von Niederösterreich, Bd. V, 450 und
464, ebenso in der Jubiläumsfestschrift „Aus Alt-Krems“,
punkt dahin, daß er den Bau als ursprünglich ein-
schiffig in die Zeit Rudolf I. von Habsburg versetzt,
während die Seitenschiffe später dazugekommen
wären10), zu welcher Auffassung ihn wohl die An-
sicht der Stadt Krems auf dem Merianschen Stiche
verleitete, welcher die Kirche aus einem einschiffigen
Langhause mit Strebepfeilern bestehend zeigt. In
dem Berichte über die Aufdeckung der Fresken im
Mittelschiffe ist die Bauzeit der Kirche in die Re-
gierungszeit Rudolf I. von Habsburg verlegt11).
Tietze meint, daß die Kirche wenigstens im
Grundrisse der Steiner Minoritenkirche, deren Lang-
haus 1264 geweiht wurde, ähnlich gewesen sei,
während die jetzige Form dem Neubau zwischen
1410 bis 1444 angehöre12).
Die neu aufgedeckten romanischen Architekturen
aber beweisen durch ihre Lage ihre Bindung mit
dem Bau, insbesondere aber beweisen die neu auf-
gedeckten Kapitale mit ihren gleichartigen Kämpfer-
profilen, daß nicht nur das Seitenschiff, sondern
mindestens auch die unteren Teile des Mittelschiffes
gleichzeitig sind und dem ersten Kirchenbau an-
gehören.
Als Entstehungszeit für diese Teile kommt das
dritte Viertel des XIII. Jhs. in Betracht, da wir trotz
der vorgeschrittenen konstruktiven Formengebung
die romanischen Dekorationsformen bei aller Zurück-
gebliebenheit des handwerklich befangenen Meisters
nicht gut an das Jahrhundertende rücken können,
obwohl auch unter Rudolf I., in dessen Zeit vielleicht
die spitzbogige Einwölbung des Mittelschiffes fiel,
der Bau noch nicht vollendet gewesen sein dürfte,
da Rudolf nach einer Urkunde vom 12. Februar 1277
der Dominikanerkirche das notwendige Bauholz
schenkte. Da in der bewegten Regierungszeit des
letzten Babenbergers und in der Zeit unmittelbar
nachher in Niederösterreich größere Bauten wohl
kaum entstanden, so wird der Bau, wie die meisten
niederösterreichischen Bauten des Übergangsstils,
frühestens um die Mitte des XIII. Jhs. unter Ottokar
begonnen haben, der sich wiederholt, so z. B. im
Jahre 1253, in Krems auf hielt und Krems auch als
Exilstadt für seine Gattin Margarete bestimmte19).
S. 25. Richtiger erscheint die Datierung im M. Z. n. F.,
III—CXXXVII.
10) M. Z. n. F., XVI, 214, Kerschbaumer über das
Museum der Stadt Krems.
n) Mon. A. V. III, S. 35 und 79.
12) Österr. Kunsttopographie I (Krems), S. 18.
13) Josef Kinzl, a. a. O., S. 8. Vgl. auch Kerschbaumer,
Krems als Exilstadt. Blätter für Landeskunde von Nieder-
österreich XXIII (1889), S. XXIX ff.
Jahrbuch des kunsthist. Instituts des deutschiisterreichischen Staatsdenkmalamtes 1918. Beiblatt