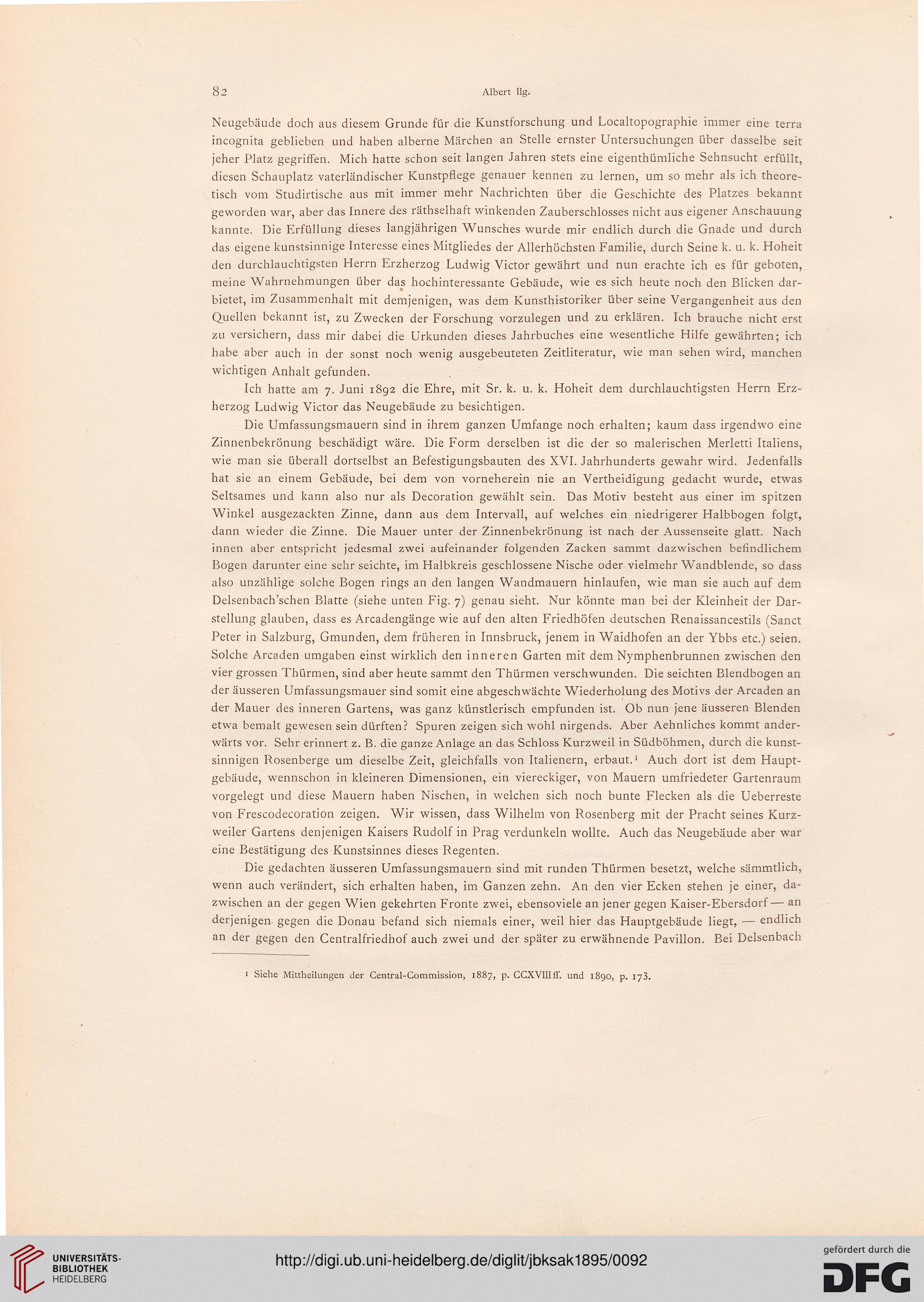82
Albert Hg.
Neugebäude doch aus diesem Grunde für die Kunstforschung und Localtopographie immer eine terra
incognita geblieben und haben alberne Märchen an Stelle ernster Untersuchungen über dasselbe seit
jeher Platz gegriffen. Mich hatte schon seit langen Jahren stets eine eigenthümliche Sehnsucht erfüllt,
diesen Schauplatz vaterländischer Kunstpflege genauer kennen zu lernen, um so mehr als ich theore-
tisch vom Studirtische aus mit immer mehr Nachrichten über die Geschichte des Platzes bekannt
geworden war, aber das Innere des räthselhaft winkenden Zauberschlosses nicht aus eigener Anschauung
kannte. Die Erfüllung dieses langjährigen Wunsches wurde mir endlich durch die Gnade und durch
das eigene kunstsinnige Interesse eines Mitgliedes der Allerhöchsten Familie, durch Seine k. u. k. Hoheit
den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Ludwig Victor gewährt und nun erachte ich es für geboten,
meine Wahrnehmungen über das hochinteressante Gebäude, wie es sich heute noch den Blicken dar-
bietet, im Zusammenhalt mit demjenigen, was dem Kunsthistoriker über seine Vergangenheit aus den
Quellen bekannt ist, zu Zwecken der Forschung vorzulegen und zu erklären. Ich brauche nicht erst
zu versichern, dass mir dabei die Urkunden dieses Jahrbuches eine wesentliche Hilfe gewährten; ich
habe aber auch in der sonst noch wenig ausgebeuteten Zeitliteratur, wie man sehen wird, manchen
wichtigen Anhalt gefunden.
Ich hatte am 7. Juni 1892 die Ehre, mit Sr. k. u. k. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erz-
herzog Ludwig Victor das Neugebäude zu besichtigen.
Die Umfassungsmauern sind in ihrem ganzen Umfange noch erhalten; kaum dass irgendwo eine
Zinnenbekrönung beschädigt wäre. Die Form derselben ist die der so malerischen Merletti Italiens,
wie man sie überall dortselbst an Befestigungsbauten des XVI. Jahrhunderts gewahr wird. Jedenfalls
hat sie an einem Gebäude, bei dem von vorneherein nie an Vertheidigung gedacht wurde, etwas
Seltsames und kann also nur als Decoration gewählt sein. Das Motiv besteht aus einer im spitzen
Winkel ausgezackten Zinne, dann aus dem Intervall, auf welches ein niedrigerer Halbbogen folgt,
dann wieder die Zinne. Die Mauer unter der Zinnenbekrönung ist nach der Aussenseite glatt. Nach
innen aber entspricht jedesmal zwei aufeinander folgenden Zacken sammt dazwischen befindlichem
Bogen darunter eine sehr seichte, im Halbkreis geschlossene Nische oder vielmehr Wandblende, so dass
also unzählige solche Bogen rings an den langen Wandmauern hinlaufen, wie man sie auch auf dem
Delsenbach'schen Blatte (siehe unten Fig. 7) genau sieht. Nur könnte man bei der Kleinheit der Dar-
stellung glauben, dass es Arcadengänge wie auf den alten Friedhöfen deutschen Renaissancestils (Sanct
Peter in Salzburg, Gmunden, dem früheren in Innsbruck, jenem in Waidhofen an der Ybbs etc.) seien.
Solche Arcaden umgaben einst wirklich den inneren Garten mit dem Nymphenbrunnen zwischen den
vier grossen Thürmen, sind aber heute sammt den Thürmen verschwunden. Die seichten Blendbogen an
der äusseren Umfassungsmauer sind somit eine abgeschwächte Wiederholung des Motivs der Arcaden an
der Mauer des inneren Gartens, was ganz künstlerisch empfunden ist. Ob nun jene äusseren Blenden
etwa bemalt gewesen sein dürften? Spuren zeigen sich wohl nirgends. Aber Aehnliches kommt ander-
wärts vor. Sehr erinnert z. B. die ganze Anlage an das Schloss Kurzweil in Südböhmen, durch die kunst-
sinnigen Rosenberge um dieselbe Zeit, gleichfalls von Italienern, erbaut.1 Auch dort ist dem Haupt-
gebäude, wennschon in kleineren Dimensionen, ein viereckiger, von Mauern umfriedeter Gartenraum
vorgelegt und diese Mauern haben Nischen, in welchen sich noch bunte Flecken als die Ueberreste
von Frescodecoration zeigen. Wir wissen, dass Wilhelm von Rosenberg mit der Pracht seines Kurz-
weiler Gartens denjenigen Kaisers Rudolf in Prag verdunkeln wollte. Auch das Neugebäude aber war
eine Bestätigung des Kunstsinnes dieses Regenten.
Die gedachten äusseren Umfassungsmauern sind mit runden Thürmen besetzt, welche sämmtlich,
wenn auch verändert, sich erhalten haben, im Ganzen zehn. An den vier Ecken stehen je einer, da-
zwischen an der gegen Wien gekehrten Fronte zwei, ebensoviele an jener gegen Kaiser-Ebersdorf— an
derjenigen gegen die Donau befand sich niemals einer, weil hier das Hauptgebäude liegt, — endlich
an der gegen den Centralfriedhof auch zwei und der später zu erwähnende Pavillon. Bei Delsenbach
1 Siehe Mittheilungen der Central-Commission, 1887, p. CCXVIIIff. und 1890, p. 173.
Albert Hg.
Neugebäude doch aus diesem Grunde für die Kunstforschung und Localtopographie immer eine terra
incognita geblieben und haben alberne Märchen an Stelle ernster Untersuchungen über dasselbe seit
jeher Platz gegriffen. Mich hatte schon seit langen Jahren stets eine eigenthümliche Sehnsucht erfüllt,
diesen Schauplatz vaterländischer Kunstpflege genauer kennen zu lernen, um so mehr als ich theore-
tisch vom Studirtische aus mit immer mehr Nachrichten über die Geschichte des Platzes bekannt
geworden war, aber das Innere des räthselhaft winkenden Zauberschlosses nicht aus eigener Anschauung
kannte. Die Erfüllung dieses langjährigen Wunsches wurde mir endlich durch die Gnade und durch
das eigene kunstsinnige Interesse eines Mitgliedes der Allerhöchsten Familie, durch Seine k. u. k. Hoheit
den durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Ludwig Victor gewährt und nun erachte ich es für geboten,
meine Wahrnehmungen über das hochinteressante Gebäude, wie es sich heute noch den Blicken dar-
bietet, im Zusammenhalt mit demjenigen, was dem Kunsthistoriker über seine Vergangenheit aus den
Quellen bekannt ist, zu Zwecken der Forschung vorzulegen und zu erklären. Ich brauche nicht erst
zu versichern, dass mir dabei die Urkunden dieses Jahrbuches eine wesentliche Hilfe gewährten; ich
habe aber auch in der sonst noch wenig ausgebeuteten Zeitliteratur, wie man sehen wird, manchen
wichtigen Anhalt gefunden.
Ich hatte am 7. Juni 1892 die Ehre, mit Sr. k. u. k. Hoheit dem durchlauchtigsten Herrn Erz-
herzog Ludwig Victor das Neugebäude zu besichtigen.
Die Umfassungsmauern sind in ihrem ganzen Umfange noch erhalten; kaum dass irgendwo eine
Zinnenbekrönung beschädigt wäre. Die Form derselben ist die der so malerischen Merletti Italiens,
wie man sie überall dortselbst an Befestigungsbauten des XVI. Jahrhunderts gewahr wird. Jedenfalls
hat sie an einem Gebäude, bei dem von vorneherein nie an Vertheidigung gedacht wurde, etwas
Seltsames und kann also nur als Decoration gewählt sein. Das Motiv besteht aus einer im spitzen
Winkel ausgezackten Zinne, dann aus dem Intervall, auf welches ein niedrigerer Halbbogen folgt,
dann wieder die Zinne. Die Mauer unter der Zinnenbekrönung ist nach der Aussenseite glatt. Nach
innen aber entspricht jedesmal zwei aufeinander folgenden Zacken sammt dazwischen befindlichem
Bogen darunter eine sehr seichte, im Halbkreis geschlossene Nische oder vielmehr Wandblende, so dass
also unzählige solche Bogen rings an den langen Wandmauern hinlaufen, wie man sie auch auf dem
Delsenbach'schen Blatte (siehe unten Fig. 7) genau sieht. Nur könnte man bei der Kleinheit der Dar-
stellung glauben, dass es Arcadengänge wie auf den alten Friedhöfen deutschen Renaissancestils (Sanct
Peter in Salzburg, Gmunden, dem früheren in Innsbruck, jenem in Waidhofen an der Ybbs etc.) seien.
Solche Arcaden umgaben einst wirklich den inneren Garten mit dem Nymphenbrunnen zwischen den
vier grossen Thürmen, sind aber heute sammt den Thürmen verschwunden. Die seichten Blendbogen an
der äusseren Umfassungsmauer sind somit eine abgeschwächte Wiederholung des Motivs der Arcaden an
der Mauer des inneren Gartens, was ganz künstlerisch empfunden ist. Ob nun jene äusseren Blenden
etwa bemalt gewesen sein dürften? Spuren zeigen sich wohl nirgends. Aber Aehnliches kommt ander-
wärts vor. Sehr erinnert z. B. die ganze Anlage an das Schloss Kurzweil in Südböhmen, durch die kunst-
sinnigen Rosenberge um dieselbe Zeit, gleichfalls von Italienern, erbaut.1 Auch dort ist dem Haupt-
gebäude, wennschon in kleineren Dimensionen, ein viereckiger, von Mauern umfriedeter Gartenraum
vorgelegt und diese Mauern haben Nischen, in welchen sich noch bunte Flecken als die Ueberreste
von Frescodecoration zeigen. Wir wissen, dass Wilhelm von Rosenberg mit der Pracht seines Kurz-
weiler Gartens denjenigen Kaisers Rudolf in Prag verdunkeln wollte. Auch das Neugebäude aber war
eine Bestätigung des Kunstsinnes dieses Regenten.
Die gedachten äusseren Umfassungsmauern sind mit runden Thürmen besetzt, welche sämmtlich,
wenn auch verändert, sich erhalten haben, im Ganzen zehn. An den vier Ecken stehen je einer, da-
zwischen an der gegen Wien gekehrten Fronte zwei, ebensoviele an jener gegen Kaiser-Ebersdorf— an
derjenigen gegen die Donau befand sich niemals einer, weil hier das Hauptgebäude liegt, — endlich
an der gegen den Centralfriedhof auch zwei und der später zu erwähnende Pavillon. Bei Delsenbach
1 Siehe Mittheilungen der Central-Commission, 1887, p. CCXVIIIff. und 1890, p. 173.