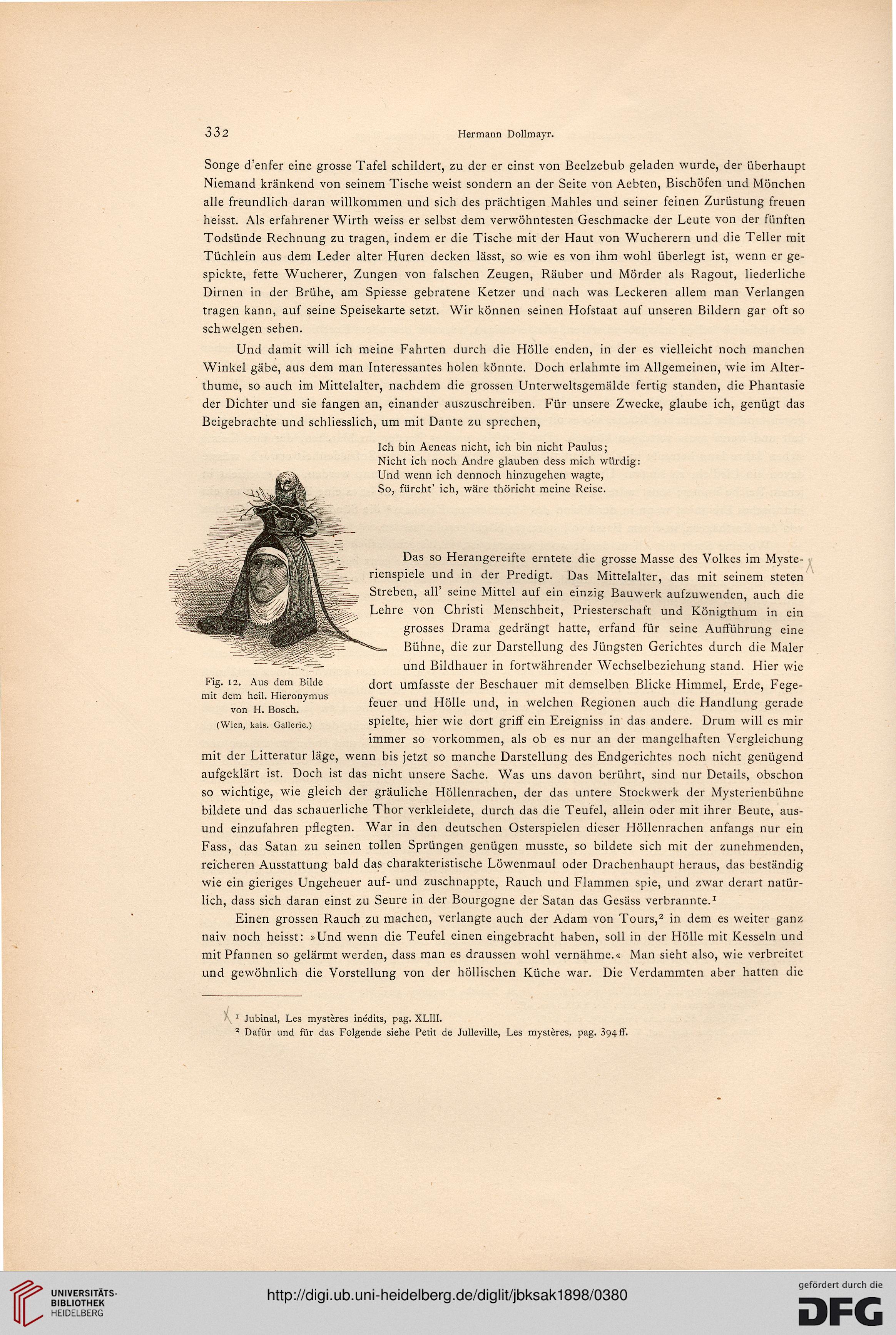332
Hermann Dollmayr.
Songe d'enfer eine grosse Tafel schildert, zu der er einst von Beelzebub geladen wurde, der überhaupt
Niemand kränkend von seinem Tische weist sondern an der Seite von Aebten, Bischöfen und Mönchen
alle freundlich daran willkommen und sich des prächtigen Mahles und seiner feinen Zurüstung freuen
heisst. Als erfahrener Wirth weiss er selbst dem verwöhntesten Geschmacke der Leute von der fünften
Todsünde Rechnung zu tragen, indem er die Tische mit der Haut von Wucherern und die Teller mit
Tüchlein aus dem Leder alter Huren decken lässt, so wie es von ihm wohl überlegt ist, wenn er ge-
spickte, fette Wucherer, Zungen von falschen Zeugen, Räuber und Mörder als Ragout, liederliche
Dirnen in der Brühe, am Spiesse gebratene Ketzer und nach was Leckeren allem man Verlangen
tragen kann, auf seine Speisekarte setzt. Wir können seinen Hofstaat auf unseren Bildern gar oft so
schwelgen sehen.
Und damit will ich meine Fahrten durch die Hölle enden, in der es vielleicht noch manchen
Winkel gäbe, aus dem man Interessantes holen könnte. Doch erlahmte im Allgemeinen, wie im Alter-
thume, so auch im Mittelalter, nachdem die grossen Unterweltsgemälde fertig standen, die Phantasie
der Dichter und sie fangen an, einander auszuschreiben. Für unsere Zwecke, glaube ich, genügt das
Beigebrachte und schliesslich, um mit Dante zu sprechen,
Ich bin Aeneas nicht, ich bin nicht Paulus;
Nicht ich noch Andre glauben dess mich würdig:
Und wenn ich dennoch hinzugehen wagte,
So, furcht' ich, wäre thöricht meine Reise.
Das so Herangereifte erntete die grosse Masse des Volkes im Myste-
rienspiele und in der Predigt. Das Mittelalter, das mit seinem steten
Streben, all' seine Mittel auf ein einzig Bauwerk aufzuwenden, auch die
Lehre von Christi Menschheit, Priesterschaft und Königthum in ein
grosses Drama gedrängt hatte, erfand für seine Aufführung eine
Bühne, die zur Darstellung des Jüngsten Gerichtes durch die Maler
und Bildhauer in fortwährender Wechselbeziehung stand. Hier wie
dort umfasste der Beschauer mit demselben Blicke Himmel, Erde, Fege-
feuer und Hölle und, in welchen Regionen auch die Handlung gerade
spielte, hier wie dort griff ein Ereigniss in das andere. Drum will es mir
immer so vorkommen, als ob es nur an der mangelhaften Vergleichung
mit der Litteratur läge, wenn bis jetzt so manche Darstellung des Endgerichtes noch nicht genügend
aufgeklärt ist. Doch ist das nicht unsere Sache. Was uns davon berührt, sind nur Details, obschon
so wichtige, wie gleich der gräuliche Höllenrachen, der das untere Stockwerk der Mysterienbühne
bildete und das schauerliche Thor verkleidete, durch das die Teufel, allein oder mit ihrer Beute, aus-
und einzufahren pflegten. War in den deutschen Osterspielen dieser Höllenrachen anfangs nur ein
Fass, das Satan zu seinen tollen Sprüngen genügen musste, so bildete sich mit der zunehmenden,
reicheren Ausstattung bald das charakteristische Löwenmaul oder Drachenhaupt heraus, das beständig
wie ein gieriges Ungeheuer auf- und zuschnappte, Rauch und Flammen spie, und zwar derart natür-
lich, dass sich daran einst zu Seure in der Bourgogne der Satan das Gesäss verbrannte.1
Einen grossen Rauch zu machen, verlangte auch der Adam von Tours,2 in dem es weiter ganz
naiv noch heisst: »Und wenn die Teufel einen eingebracht haben, soll in der Hölle mit Kesseln und
mit Pfannen so gelärmt werden, dass man es draussen wohl vernähme.« Man sieht also, wie verbreitet
und gewöhnlich die Vorstellung von der höllischen Küche war. Die Verdammten aber hatten die
Fig. 12. Aus dem Bilde
mit dem heil. Hieronymus
von H. Bosch.
(Wien, kais. Gallerie.)
-' 1 Jubinal, Les mysteres inedits, pag. XLIII.
3 Dafür und für das Folgende siehe Petit de Julleville, Les mysteres, pag. 394 ff.
Hermann Dollmayr.
Songe d'enfer eine grosse Tafel schildert, zu der er einst von Beelzebub geladen wurde, der überhaupt
Niemand kränkend von seinem Tische weist sondern an der Seite von Aebten, Bischöfen und Mönchen
alle freundlich daran willkommen und sich des prächtigen Mahles und seiner feinen Zurüstung freuen
heisst. Als erfahrener Wirth weiss er selbst dem verwöhntesten Geschmacke der Leute von der fünften
Todsünde Rechnung zu tragen, indem er die Tische mit der Haut von Wucherern und die Teller mit
Tüchlein aus dem Leder alter Huren decken lässt, so wie es von ihm wohl überlegt ist, wenn er ge-
spickte, fette Wucherer, Zungen von falschen Zeugen, Räuber und Mörder als Ragout, liederliche
Dirnen in der Brühe, am Spiesse gebratene Ketzer und nach was Leckeren allem man Verlangen
tragen kann, auf seine Speisekarte setzt. Wir können seinen Hofstaat auf unseren Bildern gar oft so
schwelgen sehen.
Und damit will ich meine Fahrten durch die Hölle enden, in der es vielleicht noch manchen
Winkel gäbe, aus dem man Interessantes holen könnte. Doch erlahmte im Allgemeinen, wie im Alter-
thume, so auch im Mittelalter, nachdem die grossen Unterweltsgemälde fertig standen, die Phantasie
der Dichter und sie fangen an, einander auszuschreiben. Für unsere Zwecke, glaube ich, genügt das
Beigebrachte und schliesslich, um mit Dante zu sprechen,
Ich bin Aeneas nicht, ich bin nicht Paulus;
Nicht ich noch Andre glauben dess mich würdig:
Und wenn ich dennoch hinzugehen wagte,
So, furcht' ich, wäre thöricht meine Reise.
Das so Herangereifte erntete die grosse Masse des Volkes im Myste-
rienspiele und in der Predigt. Das Mittelalter, das mit seinem steten
Streben, all' seine Mittel auf ein einzig Bauwerk aufzuwenden, auch die
Lehre von Christi Menschheit, Priesterschaft und Königthum in ein
grosses Drama gedrängt hatte, erfand für seine Aufführung eine
Bühne, die zur Darstellung des Jüngsten Gerichtes durch die Maler
und Bildhauer in fortwährender Wechselbeziehung stand. Hier wie
dort umfasste der Beschauer mit demselben Blicke Himmel, Erde, Fege-
feuer und Hölle und, in welchen Regionen auch die Handlung gerade
spielte, hier wie dort griff ein Ereigniss in das andere. Drum will es mir
immer so vorkommen, als ob es nur an der mangelhaften Vergleichung
mit der Litteratur läge, wenn bis jetzt so manche Darstellung des Endgerichtes noch nicht genügend
aufgeklärt ist. Doch ist das nicht unsere Sache. Was uns davon berührt, sind nur Details, obschon
so wichtige, wie gleich der gräuliche Höllenrachen, der das untere Stockwerk der Mysterienbühne
bildete und das schauerliche Thor verkleidete, durch das die Teufel, allein oder mit ihrer Beute, aus-
und einzufahren pflegten. War in den deutschen Osterspielen dieser Höllenrachen anfangs nur ein
Fass, das Satan zu seinen tollen Sprüngen genügen musste, so bildete sich mit der zunehmenden,
reicheren Ausstattung bald das charakteristische Löwenmaul oder Drachenhaupt heraus, das beständig
wie ein gieriges Ungeheuer auf- und zuschnappte, Rauch und Flammen spie, und zwar derart natür-
lich, dass sich daran einst zu Seure in der Bourgogne der Satan das Gesäss verbrannte.1
Einen grossen Rauch zu machen, verlangte auch der Adam von Tours,2 in dem es weiter ganz
naiv noch heisst: »Und wenn die Teufel einen eingebracht haben, soll in der Hölle mit Kesseln und
mit Pfannen so gelärmt werden, dass man es draussen wohl vernähme.« Man sieht also, wie verbreitet
und gewöhnlich die Vorstellung von der höllischen Küche war. Die Verdammten aber hatten die
Fig. 12. Aus dem Bilde
mit dem heil. Hieronymus
von H. Bosch.
(Wien, kais. Gallerie.)
-' 1 Jubinal, Les mysteres inedits, pag. XLIII.
3 Dafür und für das Folgende siehe Petit de Julleville, Les mysteres, pag. 394 ff.