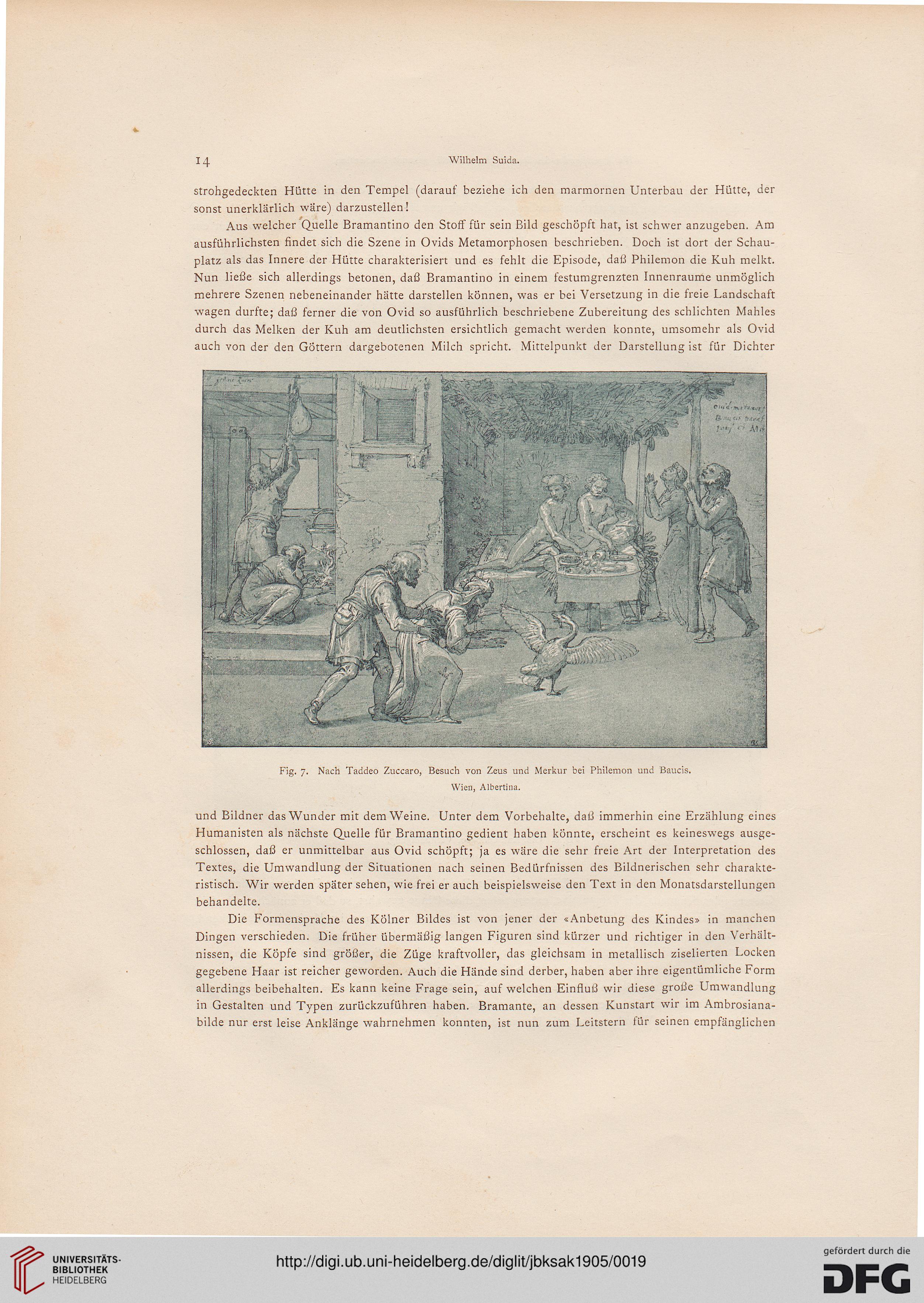14
Wilhelm Suida.
strohgedeckten Hütte in den Tempel (darauf beziehe ich den marmornen Unterbau der Hütte, der
sonst unerklärlich wäre) darzustellen!
Aus welcher Quelle Bramantino den Stoff für sein Bild geschöpft hat, ist schwer anzugeben. Am
ausführlichsten findet sich die Szene in Ovids Metamorphosen beschrieben. Doch ist dort der Schau-
platz als das Innere der Hütte charakterisiert und es fehlt die Episode, daß Philemon die Kuh melkt.
Nun ließe sich allerdings betonen, daß Bramantino in einem festumgrenzten Innenraume unmöglich
mehrere Szenen nebeneinander hätte darstellen können, was er bei Versetzung in die freie Landschaft
wagen durfte; daß ferner die von Ovid so ausführlich beschriebene Zubereitung des schlichten Mahles
durch das Melken der Kuh am deutlichsten ersichtlich gemacht werden konnte, umsomehr als Ovid
auch von der den Göttern dargebotenen Milch spricht. Mittelpunkt der Darstellung ist für Dichter
Fig. 7. Nach Taddeo Zuccaro, Besuch von Zeus und Merkur bei Philemon und Baucis.
Wien, Albertina.
und Bildner das Wunder mit dem Weine. Unter dem Vorbehalte, daß immerhin eine Erzählung eines
Humanisten als nächste Quelle für Bramantino gedient haben könnte, erscheint es keineswegs ausge-
schlossen, daß er unmittelbar aus Ovid schöpft; ja es wäre die sehr freie Art der Interpretation des
Textes, die Umwandlung der Situationen nach seinen Bedürfnissen des Bildnerischen sehr charakte-
ristisch. Wir werden später sehen, wie frei er auch beispielsweise den Text in den Monatsdarstellungen
behandelte.
Die Formensprache des Kölner Bildes ist von jener der «Anbetung des Kindes» in manchen
Dingen verschieden. Die früher übermäßig langen Figuren sind kürzer und richtiger in den Verhält-
nissen, die Köpfe sind größer, die Züge kraftvoller, das gleichsam in metallisch ziselierten Locken
gegebene Haar ist reicher geworden. Auch die Hände sind derber, haben aber ihre eigentümliche Form
allerdings beibehalten. Es kann keine Frage sein, auf welchen Einfluß wir diese große Umwandlung
in Gestalten und Typen zurückzuführen haben. Bramante, an dessen Kunstart wir im Ambrosiana-
bilde nur erst leise Anklänge wahrnehmen konnten, ist nun zum Leitstern für seinen empfänglichen
Wilhelm Suida.
strohgedeckten Hütte in den Tempel (darauf beziehe ich den marmornen Unterbau der Hütte, der
sonst unerklärlich wäre) darzustellen!
Aus welcher Quelle Bramantino den Stoff für sein Bild geschöpft hat, ist schwer anzugeben. Am
ausführlichsten findet sich die Szene in Ovids Metamorphosen beschrieben. Doch ist dort der Schau-
platz als das Innere der Hütte charakterisiert und es fehlt die Episode, daß Philemon die Kuh melkt.
Nun ließe sich allerdings betonen, daß Bramantino in einem festumgrenzten Innenraume unmöglich
mehrere Szenen nebeneinander hätte darstellen können, was er bei Versetzung in die freie Landschaft
wagen durfte; daß ferner die von Ovid so ausführlich beschriebene Zubereitung des schlichten Mahles
durch das Melken der Kuh am deutlichsten ersichtlich gemacht werden konnte, umsomehr als Ovid
auch von der den Göttern dargebotenen Milch spricht. Mittelpunkt der Darstellung ist für Dichter
Fig. 7. Nach Taddeo Zuccaro, Besuch von Zeus und Merkur bei Philemon und Baucis.
Wien, Albertina.
und Bildner das Wunder mit dem Weine. Unter dem Vorbehalte, daß immerhin eine Erzählung eines
Humanisten als nächste Quelle für Bramantino gedient haben könnte, erscheint es keineswegs ausge-
schlossen, daß er unmittelbar aus Ovid schöpft; ja es wäre die sehr freie Art der Interpretation des
Textes, die Umwandlung der Situationen nach seinen Bedürfnissen des Bildnerischen sehr charakte-
ristisch. Wir werden später sehen, wie frei er auch beispielsweise den Text in den Monatsdarstellungen
behandelte.
Die Formensprache des Kölner Bildes ist von jener der «Anbetung des Kindes» in manchen
Dingen verschieden. Die früher übermäßig langen Figuren sind kürzer und richtiger in den Verhält-
nissen, die Köpfe sind größer, die Züge kraftvoller, das gleichsam in metallisch ziselierten Locken
gegebene Haar ist reicher geworden. Auch die Hände sind derber, haben aber ihre eigentümliche Form
allerdings beibehalten. Es kann keine Frage sein, auf welchen Einfluß wir diese große Umwandlung
in Gestalten und Typen zurückzuführen haben. Bramante, an dessen Kunstart wir im Ambrosiana-
bilde nur erst leise Anklänge wahrnehmen konnten, ist nun zum Leitstern für seinen empfänglichen