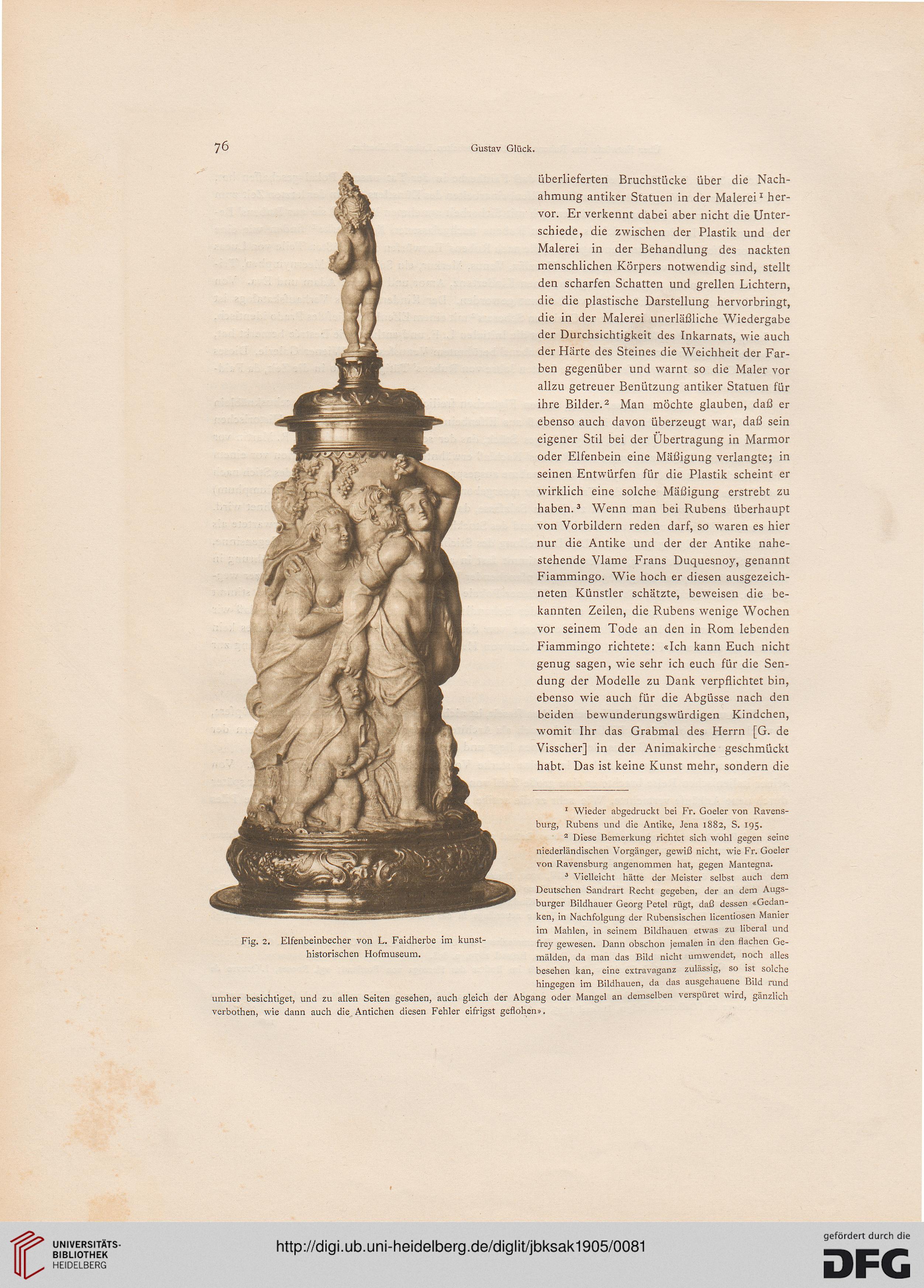76
Gustav Glück.
überlieferten Bruchstücke über die Nach-
ahmung antiker Statuen in der Malerei1 her-
vor. Er verkennt dabei aber nicht die Unter-
schiede, die zwischen der Plastik und der
Malerei in der Behandlung des nackten
menschlichen Körpers notwendig sind, stellt
den scharfen Schatten und grellen Lichtern,
die die plastische Darstellung hervorbringt,
die in der Malerei unerläßliche Wiedergabe
der Durchsichtigkeit des Inkarnats, wie auch
der Härte des Steines die Weichheit der Far-
ben gegenüber und warnt so die Maler vor
allzu getreuer Benützung antiker Statuen für
ihre Bilder.2 Man möchte glauben, daß er
ebenso auch davon überzeugt war, daß sein
eigener Stil bei der Übertragung in Marmor
oder Elfenbein eine Mäßigung verlangte; in
seinen Entwürfen für die Plastik scheint er
wirklich eine solche Mäßigung erstrebt zu
haben.3 Wenn man bei Rubens überhaupt
von Vorbildern reden darf, so waren es hier
nur die Antike und der der Antike nahe-
stehende Vlame Frans Duquesnoy, genannt
Fiammingo. Wie hoch er diesen ausgezeich-
neten Künstler schätzte, beweisen die be-
kannten Zeilen, die Rubens wenige Wochen
vor seinem Tode an den in Rom lebenden
F'iammingo richtete: «Ich kann Euch nicht
genug sagen, wie sehr ich euch für die Sen-
dung der Modelle zu Dank verpflichtet bin,
ebenso wie auch für die Abgüsse nach den
beiden bewunderungswürdigen Kindchen,
womit Ihr das Grabmal des Herrn [G. de
Visscher] in der Animakirche geschmückt
habt. Das ist keine Kunst mehr, sondern die
Fig. 2. Elfenbeinbecher von L. Faidherbe im kunst
historischen Hofmuseum.
umher besichtiget, und zu allen Seiten gesehen, au
verbothen, wie dann auch die Antichen diesen Fehler eifrigst geflohen
1 Wieder abgedruckt bei Fr. Goeler von Ravens-
burg, Rubens und die Antike, Jena 1882, S. 195.
2 Diese Bemerkung richtet sich wohl gegen seine
niederländischen Vorgänger, gewiß nicht, wie Fr. Goeler
von Ravensburg angenommen hat, gegen Mantegna.
3 Vielleicht hätte der Meister selbst auch dem
Deutschen Sandrart Recht gegeben, der an dem Augs-
burger Bildhauer Georg Pctel rügt, daß dessen «Gedan-
ken, in Nachfolgung der Rubensischen licentiosen Manier
im Mahlen, in seinem Bildhauen etwas zu liberal und
frey gewesen. Dann obschon jemalen in den flachen Ge-
mälden, da man das Bild nicht umwendet, noch alles
besehen kan, eine extravaganz zulässig, so ist solche
hingegen im Bildhauen, da das ausgehauene Bild rund
ch gleich der Abgang oder Mangel an demselben verspüret wird, gänzlich
|
Gustav Glück.
überlieferten Bruchstücke über die Nach-
ahmung antiker Statuen in der Malerei1 her-
vor. Er verkennt dabei aber nicht die Unter-
schiede, die zwischen der Plastik und der
Malerei in der Behandlung des nackten
menschlichen Körpers notwendig sind, stellt
den scharfen Schatten und grellen Lichtern,
die die plastische Darstellung hervorbringt,
die in der Malerei unerläßliche Wiedergabe
der Durchsichtigkeit des Inkarnats, wie auch
der Härte des Steines die Weichheit der Far-
ben gegenüber und warnt so die Maler vor
allzu getreuer Benützung antiker Statuen für
ihre Bilder.2 Man möchte glauben, daß er
ebenso auch davon überzeugt war, daß sein
eigener Stil bei der Übertragung in Marmor
oder Elfenbein eine Mäßigung verlangte; in
seinen Entwürfen für die Plastik scheint er
wirklich eine solche Mäßigung erstrebt zu
haben.3 Wenn man bei Rubens überhaupt
von Vorbildern reden darf, so waren es hier
nur die Antike und der der Antike nahe-
stehende Vlame Frans Duquesnoy, genannt
Fiammingo. Wie hoch er diesen ausgezeich-
neten Künstler schätzte, beweisen die be-
kannten Zeilen, die Rubens wenige Wochen
vor seinem Tode an den in Rom lebenden
F'iammingo richtete: «Ich kann Euch nicht
genug sagen, wie sehr ich euch für die Sen-
dung der Modelle zu Dank verpflichtet bin,
ebenso wie auch für die Abgüsse nach den
beiden bewunderungswürdigen Kindchen,
womit Ihr das Grabmal des Herrn [G. de
Visscher] in der Animakirche geschmückt
habt. Das ist keine Kunst mehr, sondern die
Fig. 2. Elfenbeinbecher von L. Faidherbe im kunst
historischen Hofmuseum.
umher besichtiget, und zu allen Seiten gesehen, au
verbothen, wie dann auch die Antichen diesen Fehler eifrigst geflohen
1 Wieder abgedruckt bei Fr. Goeler von Ravens-
burg, Rubens und die Antike, Jena 1882, S. 195.
2 Diese Bemerkung richtet sich wohl gegen seine
niederländischen Vorgänger, gewiß nicht, wie Fr. Goeler
von Ravensburg angenommen hat, gegen Mantegna.
3 Vielleicht hätte der Meister selbst auch dem
Deutschen Sandrart Recht gegeben, der an dem Augs-
burger Bildhauer Georg Pctel rügt, daß dessen «Gedan-
ken, in Nachfolgung der Rubensischen licentiosen Manier
im Mahlen, in seinem Bildhauen etwas zu liberal und
frey gewesen. Dann obschon jemalen in den flachen Ge-
mälden, da man das Bild nicht umwendet, noch alles
besehen kan, eine extravaganz zulässig, so ist solche
hingegen im Bildhauen, da das ausgehauene Bild rund
ch gleich der Abgang oder Mangel an demselben verspüret wird, gänzlich
|