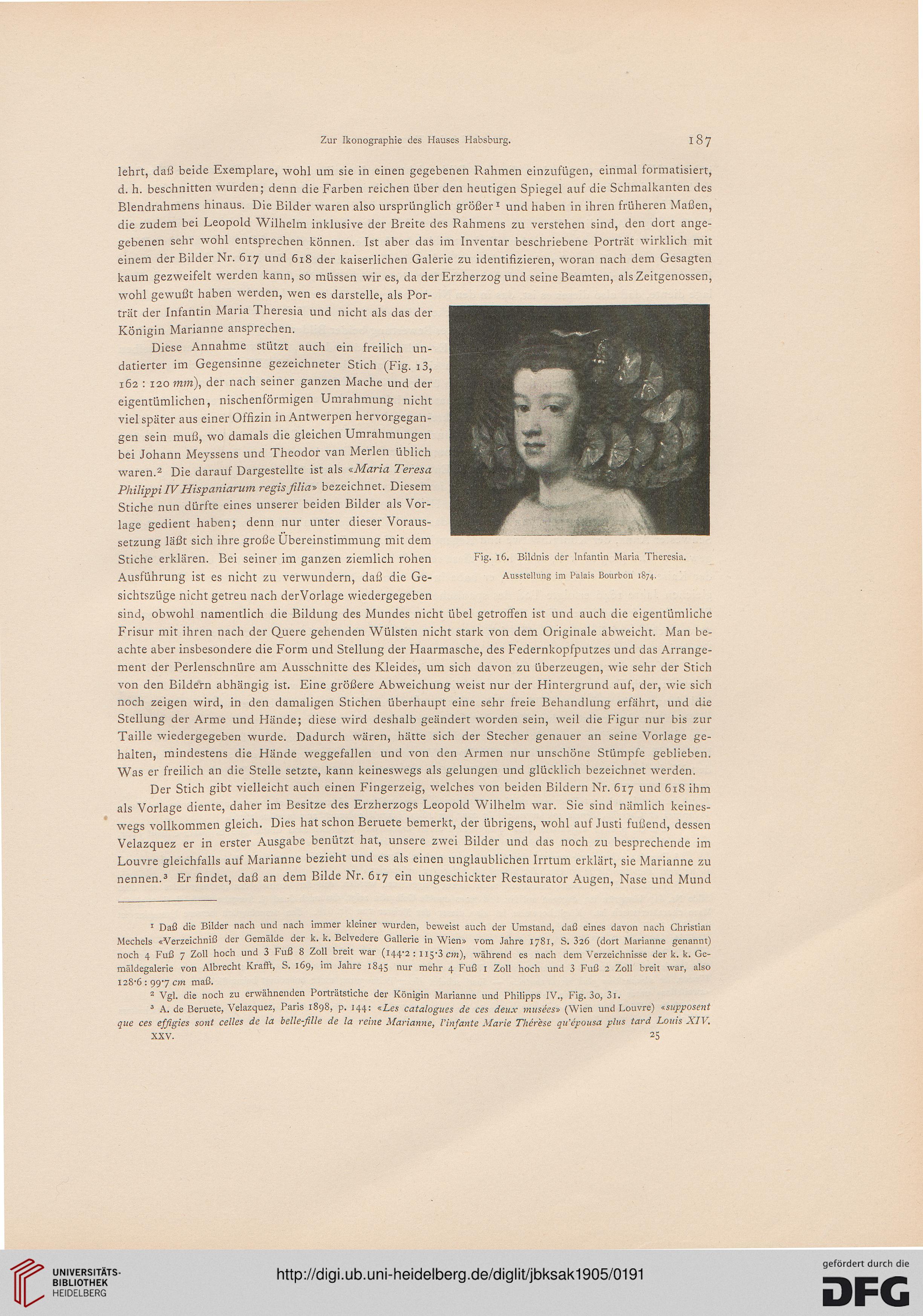Zur Ikonographie des Hauses Habsburg.
I87
lehrt, daß beide Exemplare, wohl um sie in einen gegebenen Rahmen einzufügen, einmal formalisiert,
d. h. beschnitten wurden; denn die Farben reichen über den heutigen Spiegel auf die Schmalkanten des
Blendrahmens hinaus. Die Bilder waren also ursprünglich größer1 und haben in ihren früheren Maßen,
die zudem bei Leopold Wilhelm inklusive der Breite des Rahmens zu verstehen sind, den dort ange-
gebenen sehr wohl entsprechen können. Ist aber das im Inventar beschriebene Porträt wirklich mit
einem der Bilder Nr. 617 und 618 der kaiserlichen Galerie zu identifizieren, woran nach dem Gesagten
kaum gezweifelt werden kann, so müssen wir es, da der Erzherzog und seine Beamten, als Zeitgenossen,
wohl gewußt haben werden, wen es darstelle, als Por-
trät der Infantin Maria Theresia und nicht als das der
Königin Marianne ansprechen.
Diese Annahme stützt auch ein freilich un-
datierter im Gegensinne gezeichneter Stich (Fig. i3,
162 : 120 mm), der nach seiner ganzen Mache und der
eigentümlichen, nischenförmigen Umrahmung nicht
viel später aus einer Offizin in Antwerpen hervorgegan-
gen sein muß, wo damals die gleichen Umrahmungen
bei Johann Meyssens und Theodor van Merlen üblich
waren.-2 Die darauf Dargestellte ist als «Maria Teresa
PhilippilVHispaniarum regisfilia* bezeichnet. Diesem
Stiche nun dürfte eines unserer beiden Bilder als Vor-
lage gedient haben; denn nur unter dieser Voraus-
setzung läßt sich ihre große Ubereinstimmung mit dem
Stiche erklären. Bei seiner im ganzen ziemlich rohen Fig. 16. Bildnis der Infantin Maria Theresia.
Ausführung ist es nicht zu verwundern, daß die Ge- Ausstellung im Palais Bourbon 187+.
sichtszüge nicht getreu nach derVorlage wiedergegeben
sind, obwohl namentlich die Bildung des Mundes nicht übel getroffen ist und auch die eigentümliche
Frisur mit ihren nach der Quere gehenden Wülsten nicht stark von dem Originale abweicht. Man be-
achte aber insbesondere die Form und Stellung der Haarmasche, des Federnkopfputzes und das Arrange-
ment der Perlenschnüre am Ausschnitte des Kleides, um sich davon zu überzeugen, wie sehr der Stich
von den Bildern abhängig ist. Eine größere Abweichung weist nur der Hintergrund auf, der, wie sich
noch zeigen wird, in den damaligen Stichen überhaupt eine sehr freie Behandlung erfährt, und die
Stellung der Arme und Hände; diese wird deshalb geändert worden sein, weil die Figur nur bis zur
Taille wiedergegeben wurde. Dadurch wären, hätte sich der Stecher genauer an seine Vorlage ge-
halten, mindestens die Hände weggefallen und von den Armen nur unschöne Stümpfe geblieben.
Was er freilich an die Stelle setzte, kann keineswegs als gelungen und glücklich bezeichnet werden.
Der Stich gibt vielleicht auch einen Fingerzeig, welches von beiden Bildern Nr. 617 und 618 ihm
als Vorlage diente, daher im Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm war. Sie sind nämlich keines-
wegs vollkommen gleich. Dies hat schon Beruete bemerkt, der übrigens, wohl auf Justi fußend, dessen
Velazquez er in erster Ausgabe benützt hat, unsere zwei Bilder und das noch zu besprechende im
Louvre gleichfalls auf Marianne bezieht und es als einen unglaublichen Irrtum erklärt, sie Marianne zu
nennen.3 Er findet, daß an dem Bilde Nr. 617 ein ungeschickter Restaurator Augen, Nase und Mund
1 Daß die Bilder nach und nach immer kleiner wurden, beweist auch der Umstand, daß eines davon nach Christian
Mechels «Verzeichnis der Gemälde der k. k. Belvedere Gallerie in Wien» vom Jahre 1781, S. 326 (dort Marianne genannt)
noch 4 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 8 Zoll breit war (144-2 : 115-3 cm), während es nach dem Verzeichnisse der k. k. Ge-
mäldegalerie von Albrecht Krafl't, S. 169, im Jahre 1845 nur mehr 4 Fuß 1 Zoll hoch und 3 Fuß 2 Zoll breit war, also
128-6 : 99-7 cm maß.
2 Vgl. die noch zu erwähnenden Porträtstiche der Königin Marianne und Philipps IV., Fig. 3o, 3l.
3 A. de Beruete, Velazquez, Paris 1898, p. 144: «Les catalogues de ces deux musees* (Wien und Louvre) «supposent
que ces efflgies sont Celles de la belle-fille de la reine Marianne, Vinfante Marie Therese qu'epousa plus tard Louis XIV.
XXV. 25
I87
lehrt, daß beide Exemplare, wohl um sie in einen gegebenen Rahmen einzufügen, einmal formalisiert,
d. h. beschnitten wurden; denn die Farben reichen über den heutigen Spiegel auf die Schmalkanten des
Blendrahmens hinaus. Die Bilder waren also ursprünglich größer1 und haben in ihren früheren Maßen,
die zudem bei Leopold Wilhelm inklusive der Breite des Rahmens zu verstehen sind, den dort ange-
gebenen sehr wohl entsprechen können. Ist aber das im Inventar beschriebene Porträt wirklich mit
einem der Bilder Nr. 617 und 618 der kaiserlichen Galerie zu identifizieren, woran nach dem Gesagten
kaum gezweifelt werden kann, so müssen wir es, da der Erzherzog und seine Beamten, als Zeitgenossen,
wohl gewußt haben werden, wen es darstelle, als Por-
trät der Infantin Maria Theresia und nicht als das der
Königin Marianne ansprechen.
Diese Annahme stützt auch ein freilich un-
datierter im Gegensinne gezeichneter Stich (Fig. i3,
162 : 120 mm), der nach seiner ganzen Mache und der
eigentümlichen, nischenförmigen Umrahmung nicht
viel später aus einer Offizin in Antwerpen hervorgegan-
gen sein muß, wo damals die gleichen Umrahmungen
bei Johann Meyssens und Theodor van Merlen üblich
waren.-2 Die darauf Dargestellte ist als «Maria Teresa
PhilippilVHispaniarum regisfilia* bezeichnet. Diesem
Stiche nun dürfte eines unserer beiden Bilder als Vor-
lage gedient haben; denn nur unter dieser Voraus-
setzung läßt sich ihre große Ubereinstimmung mit dem
Stiche erklären. Bei seiner im ganzen ziemlich rohen Fig. 16. Bildnis der Infantin Maria Theresia.
Ausführung ist es nicht zu verwundern, daß die Ge- Ausstellung im Palais Bourbon 187+.
sichtszüge nicht getreu nach derVorlage wiedergegeben
sind, obwohl namentlich die Bildung des Mundes nicht übel getroffen ist und auch die eigentümliche
Frisur mit ihren nach der Quere gehenden Wülsten nicht stark von dem Originale abweicht. Man be-
achte aber insbesondere die Form und Stellung der Haarmasche, des Federnkopfputzes und das Arrange-
ment der Perlenschnüre am Ausschnitte des Kleides, um sich davon zu überzeugen, wie sehr der Stich
von den Bildern abhängig ist. Eine größere Abweichung weist nur der Hintergrund auf, der, wie sich
noch zeigen wird, in den damaligen Stichen überhaupt eine sehr freie Behandlung erfährt, und die
Stellung der Arme und Hände; diese wird deshalb geändert worden sein, weil die Figur nur bis zur
Taille wiedergegeben wurde. Dadurch wären, hätte sich der Stecher genauer an seine Vorlage ge-
halten, mindestens die Hände weggefallen und von den Armen nur unschöne Stümpfe geblieben.
Was er freilich an die Stelle setzte, kann keineswegs als gelungen und glücklich bezeichnet werden.
Der Stich gibt vielleicht auch einen Fingerzeig, welches von beiden Bildern Nr. 617 und 618 ihm
als Vorlage diente, daher im Besitze des Erzherzogs Leopold Wilhelm war. Sie sind nämlich keines-
wegs vollkommen gleich. Dies hat schon Beruete bemerkt, der übrigens, wohl auf Justi fußend, dessen
Velazquez er in erster Ausgabe benützt hat, unsere zwei Bilder und das noch zu besprechende im
Louvre gleichfalls auf Marianne bezieht und es als einen unglaublichen Irrtum erklärt, sie Marianne zu
nennen.3 Er findet, daß an dem Bilde Nr. 617 ein ungeschickter Restaurator Augen, Nase und Mund
1 Daß die Bilder nach und nach immer kleiner wurden, beweist auch der Umstand, daß eines davon nach Christian
Mechels «Verzeichnis der Gemälde der k. k. Belvedere Gallerie in Wien» vom Jahre 1781, S. 326 (dort Marianne genannt)
noch 4 Fuß 7 Zoll hoch und 3 Fuß 8 Zoll breit war (144-2 : 115-3 cm), während es nach dem Verzeichnisse der k. k. Ge-
mäldegalerie von Albrecht Krafl't, S. 169, im Jahre 1845 nur mehr 4 Fuß 1 Zoll hoch und 3 Fuß 2 Zoll breit war, also
128-6 : 99-7 cm maß.
2 Vgl. die noch zu erwähnenden Porträtstiche der Königin Marianne und Philipps IV., Fig. 3o, 3l.
3 A. de Beruete, Velazquez, Paris 1898, p. 144: «Les catalogues de ces deux musees* (Wien und Louvre) «supposent
que ces efflgies sont Celles de la belle-fille de la reine Marianne, Vinfante Marie Therese qu'epousa plus tard Louis XIV.
XXV. 25